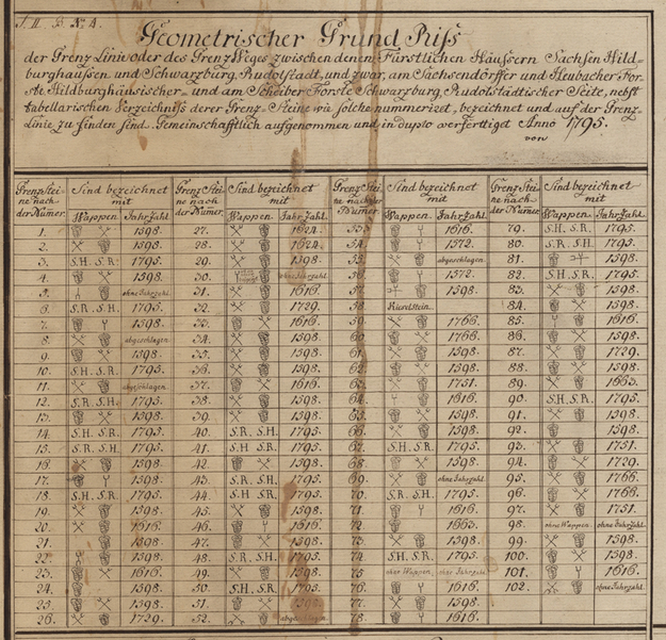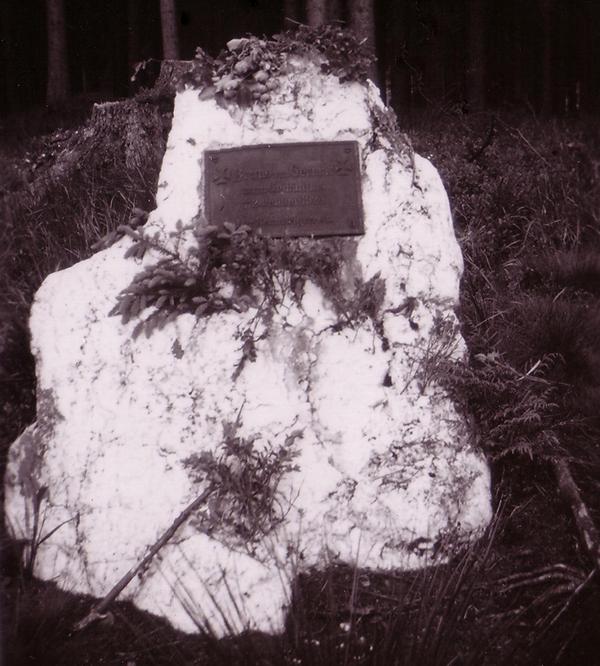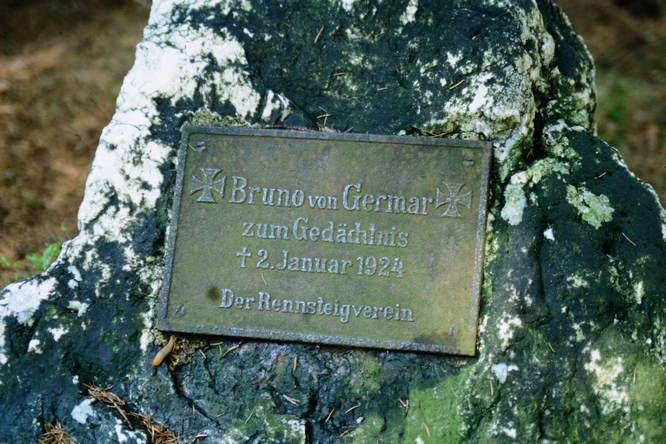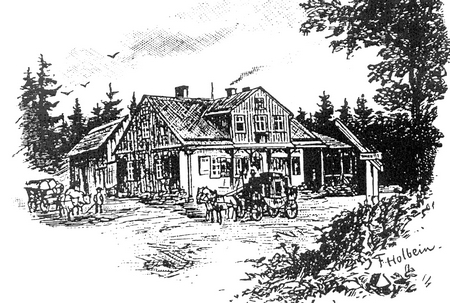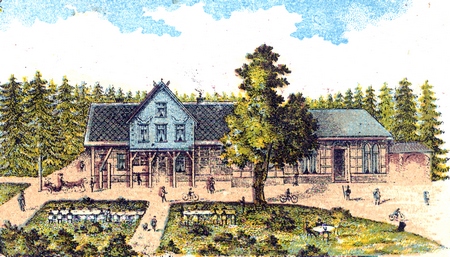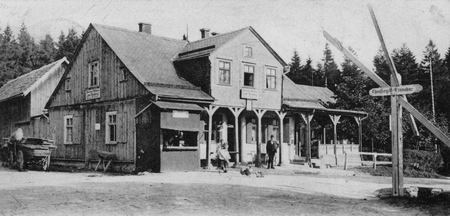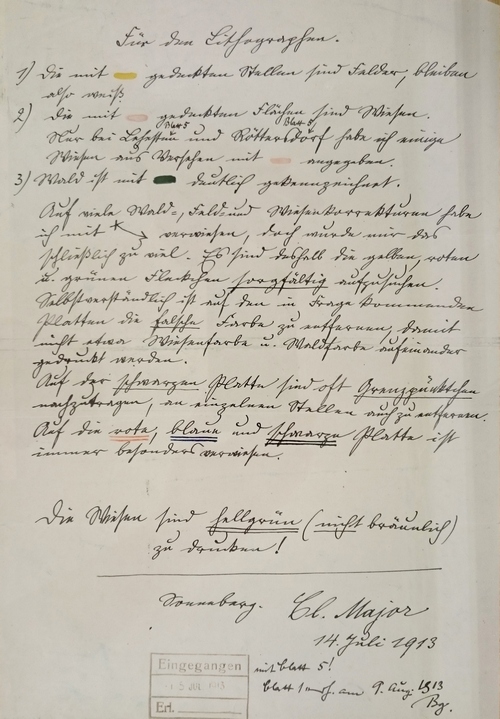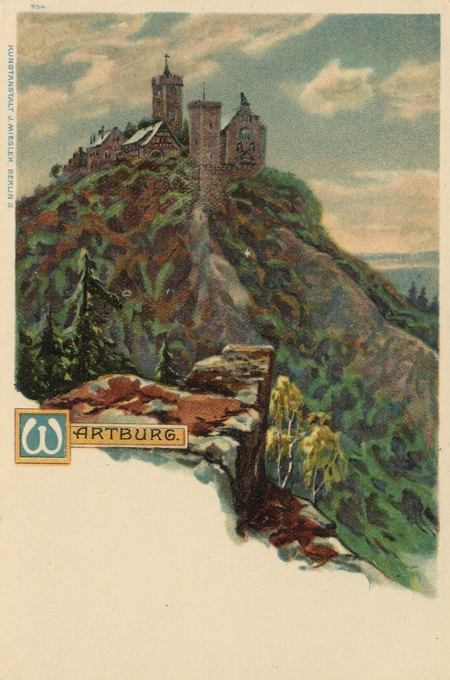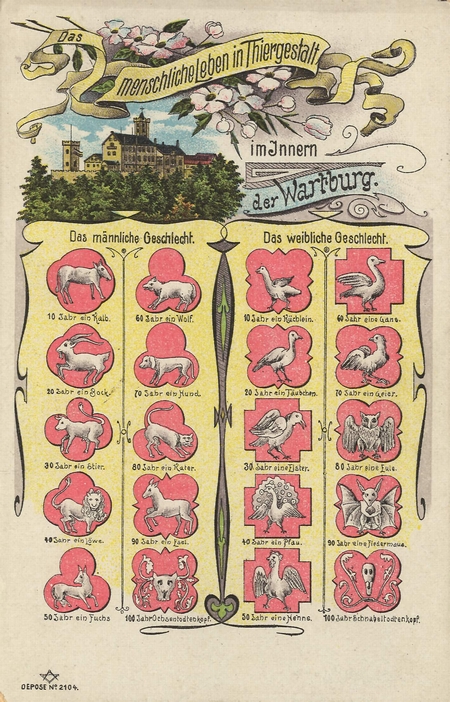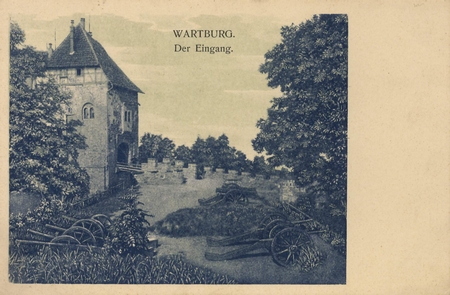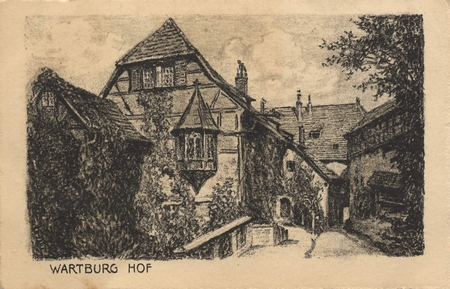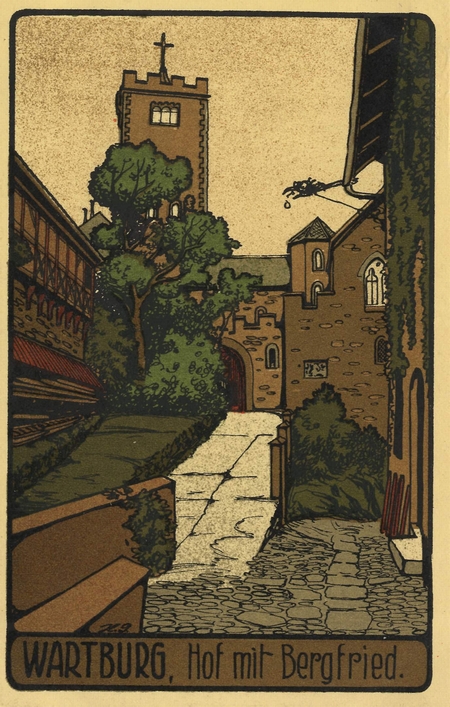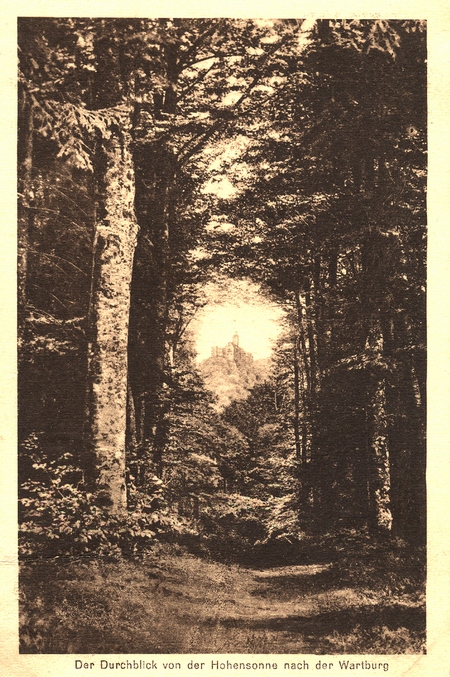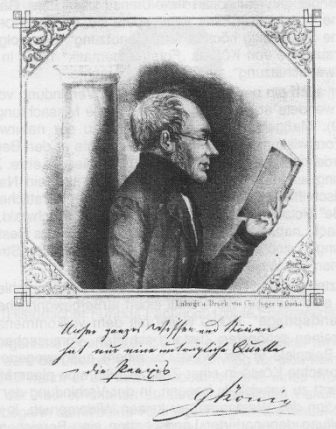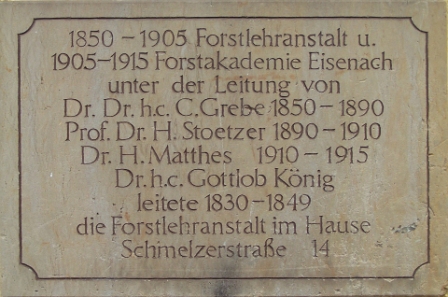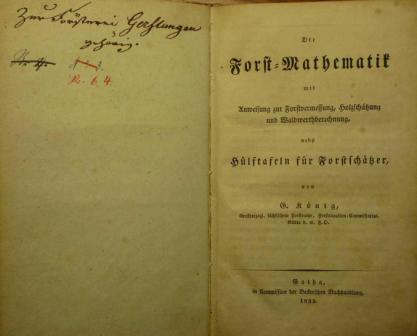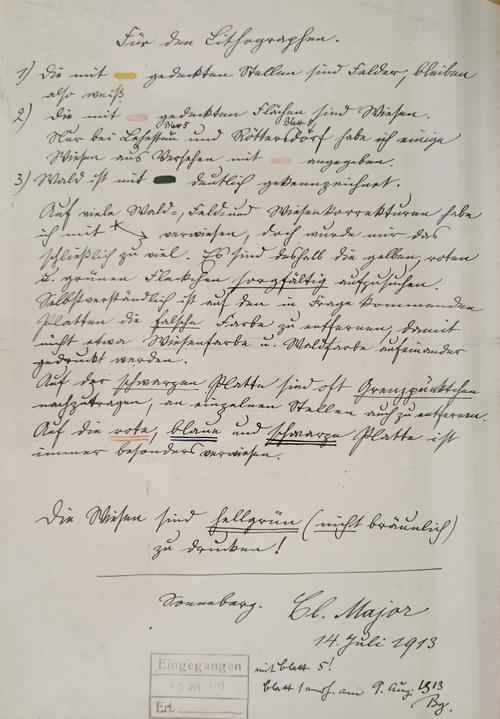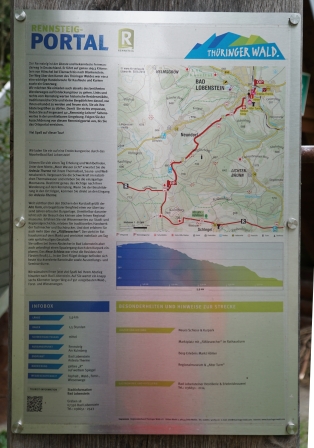ANMERKUNG ZU DIESEM MENÜPUNKT
Der Menüpunkt Wissenswertes vom Rennsteig wird ständig erweitert und ergänzt. Wie in einem Lexikon versuche ich hier in Zukunft Begriffe zu erklären, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Rennsteig stehen.
Absang
Der Name Absang wird in der Literatur unterschiedlich erklärt:
- Nach Georg Brückner ist der Name auf die sich zur Selbitz absenkende Bergwand zurückzuführen.
- Sieber erklärt in seiner Beschreibung der Reußischen Forsten Absang als eine durch Feuer (absengen) bewirkte Rodung.
- Pfarrer Goldhahn aus Harra hingegen erläutert im Mareile vom Juli 1929, dass die volkstümliche Bezeichnung von Absang Moos- oder Maasanger, wahrscheinlicher aber Aasanger war und brachte den Ort mit dem Schindanger als Richtstätte in Verbindung.

Bei Absang, gleich oberhalb von Blankenstein, treffen wir auf eine streckenmäßig geringe Abweichung des Rennsteiges von seinem Originalverlauf.
Der geänderte Verlauf und die Originalstrecke sind eindeutig und ohne umfangreiche Nachforschungen nachvollziehbar.
Im Zuge der Neuvermessung des Rennsteiges wurden dabei folgende Messwerte ermittelt:
- Originalrennsteig: 343,25 m
- Umgehung: 454,97 m
Die Umverlegung erfolgte in guter Absicht, offenbar aufgrund des starken Fahrverkehrs, besonders durch die Holztransporte zur Blankensteiner Zellstofffabrik.
Eine Abstimmung mit dem Rennsteigverein erfolgte offensichtlich nicht. Die neue Trasse wendet sich ca. 130 m vor dem Einzelgehöft an der Straße (dem ursprünglichen Rennsteigverlauf) in westliche Richtung auf einen Schotterweg, der zum Bärwinkel führt. Nach etwa 170 m biegen wir im weiteren Verlauf in Richtung Nordwesten ab und passieren den rechts vom Weg liegenden Hof von Absang. Der Schotterweg wendet sich unmittelbar nach dem Hof in nördlicher Richtung und trifft nach 180 m wieder auf den Originalrennsteig, die Fahrstraße von Blankenstein nach Kießling.
Aufgrund der verkehrsberuhigten Lage der Ausweichtrasse, ist diese Wegführung der Begehung der Originaltrasse vorzuziehen.

Strassenverlauf: Originalrennsteig, Weg links ab: Umgehung

Abzweig des aktuellen Rennsteigwanderweges

Gehöft an der Straße (Originalverlauf)

Umleitung trifft wieder auf Straße
Denkmalschutz
Denkmalschutz und Rennsteig - Gesetzliche Grundlagen
Auf Initiative des Vereins für Schmalkaldische Geschichte und Landeskunde wurde der Rennsteig, hier Plänckner’scher Rennsteig, im September 1997 unter Denkmalschutz gestellt. Die aktuellen gesetzlichen Grundlagen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Auszügen.
Thüringer Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale
(Thüringer Denkmalschutzgesetz - ThürDSchG) i.d.F. vom 14. April 2004 (GVBl. S. 465), zuletzt geändert durch das Erste Gesetz zur Änderung des Thüringer Denkmalschutzgesetztes vom 23. November 2005 (GVBl. S. 359) - Auszüge
§ 2
Kulturdenkmale
(1) Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind Sachen, Sachgesamtheiten oder Sachteile, an
deren Erhaltung aus geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen, technischen,
volkskundlichen oder städtebaulichen Gründen sowie aus Gründen der historischen Dorfbildpflege ein
öffentliches Interesse besteht. Kulturdenkmale sind auch Denkmalensembles (Absatz 2) und
Bodendenkmale (Absatz 7).
(2) Denkmalensembles können sein:
1. bauliche Gesamtanlagen (Absatz 3),
2. kennzeichnende Straßen-, Platz- und Ortsbilder (Absatz 4),
3. kennzeichnende Ortsgrundrisse (Absatz 5),
4. historische Park- und Gartenanlagen (Absatz 6),
5. historische Produktionsstätten und -anlagen.
Nicht erforderlich ist, dass jeder einzelne Teil des Denkmalensembles ein Kulturdenkmal darstellt.
(3) Bauliche Gesamtanlagen sind insbesondere Gebäudegruppen, einheitlich gestaltete Quartiere und
Siedlungen und historische Ortskerne einschließlich der mit ihnen verbundenen Pflanzen, Frei- und
Wasserflächen.
(4) Ein kennzeichnendes Straßen-, Platz- oder Ortsbild ist insbesondere gegeben, wenn das
Erscheinungsbild der Anlage für eine bestimmte Epoche oder Entwicklung oder für eine
charakteristische Bauweise mit auch unterschiedlichen Stilarten kennzeichnend ist.
(5) Ein kennzeichnender Ortsgrundriss ist gegeben, wenn das Erscheinungsbild der Anlage für eine
bestimmte Epoche oder Entwicklung charakteristisch ist, insbesondere im Hinblick auf Orts- und
Siedlungsformen, Straßenführungen, Parzellenstrukturen und Festungsanlagen.
(6) Historische Park- und Gartenanlagen sind Werke der Gartenbaukunst, deren Lage sowie
architektonische und pflanzliche Gestaltung von der Funktion der Anlage als Lebensraum und
Selbstdarstellung früherer Gesellschaftsformen und der von ihr getragenen Kultur Zeugnis geben.
Dazu zählen auch Tier- und botanische Gärten, soweit sie eine eigene historische und
architektonische Gesamtgestaltung besitzen.
(7) Bodendenkmale sind bewegliche oder unbewegliche Sachen, bei denen es sich um Zeugnisse,
Überreste oder Spuren menschlicher Kultur (archäologische Denkmale) oder tierischen oder
pflanzlichen Lebens (paläontologische Denkmale) handelt, die im Boden verborgen sind oder waren.
§ 13
Erlaubnis
(1) Einer Erlaubnis der Denkmalschutzbehörde bedarf,
1. wer ein Kulturdenkmal oder Teile davon
a) zerstören, beseitigen oder an einen anderen Ort verbringen,
b) umgestalten, instand setzen oder im äußeren Erscheinungsbild verändern oder
c) mit Werbe- oder sonstigen Anlagen versehen will,
2. wer in der Umgebung eines unbeweglichen Kulturdenkmals Anlagen errichten, verändern oder
beseitigen will, wenn sich dies auf den Bestand oder das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals
auswirken kann,
3. wer Erdarbeiten an einer Stelle vornehmen will, von der bekannt ist oder vermutet wird oder den
Umständen nach anzunehmen ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden.
(2) Die Erlaubnis kann versagt werden, soweit gewichtige Gründe des Denkmalschutzes für die
unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustandes sprechen. Im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 kann
die Erlaubnis darüber hinaus nur versagt werden, soweit das Vorhaben zu einer Beeinträchtigung des
Wesens, des überlieferten Erscheinungsbildes oder der künstlerischen Wirkung eines Kulturdenkmals
führen würde und gewichtige Gründe des Denkmalschutzes für die unveränderte Beibehaltung des
bisherigen Zustandes sprechen.
(3) Der Inhaber einer Erlaubnis nach Absatz 1 Nr. 3 ist im Rahmen des Zumutbaren verpflichtet, die
Kosten für die denkmalfachliche Begleitung der Erdarbeiten, für die Sicherung und Behandlung von
Funden und für die Dokumentation der Denkmalfachbehörde zu erstatten.
§ 14
Erlaubnisverfahren
(1) Der Erlaubnisantrag ist der zuständigen Denkmalschutzbehörde schriftlich mit allen für die
Beurteilung des Vorhabens und der Bearbeitung des Antrags erforderlichen Unterlagen einzureichen.
Die Denkmalschutzbehörde prüft den Antrag innerhalb von zwei Wochen auf Vollständigkeit und teilt
dem Antragsteller den Eingang des Antrags mit. Ist der Antrag unvollständig oder weist er sonstige
erhebliche Mängel auf, fordert die Denkmalschutzbehörde den Antragsteller zur Behebung der Mängel
innerhalb einer angemessenen Frist auf. Werden die Mängel innerhalb der Frist nicht behoben, gilt der
Antrag als zurückgenommen. Die Denkmalschutzbehörde kann verlangen, dass der Antrag durch
denkmalpflegerische Zielstellungen oder vorbereitende Untersuchungen am Kulturdenkmal ergänzt
wird. Die Kosten dieser vorbereitenden Untersuchungen hat der Antragsteller zu tragen.
(2) Soweit die besondere Eigenart, die Bedeutung des Kulturdenkmals oder die Schwierigkeit der
Maßnahme es erfordert, soll die Leitung oder Ausführung der vorbereitenden Untersuchung oder die
Durchführung von Arbeiten, die besondere Erfahrungen und Kenntnisse voraussetzen, durch
denkmalfachlich geeignete Personen zur Auflage einer Erlaubnis gemacht werden.
(3) Die untere Denkmalschutzbehörde entscheidet über einen Erlaubnisantrag nach Anhörung der
Denkmalfachbehörde innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Vorlage der vollständigen
Antragsunterlagen; die Denkmalschutzbehörde kann diese Frist gegenüber dem Antragsteller aus
wichtigem Grund um bis zu zwei Monate verlängern. Der Antrag gilt als genehmigt, wenn über ihn
nicht innerhalb der nach Satz 1 maßgeblichen Frist entschieden worden ist. Die fachliche
Stellungnahme der Denkmalfachbehörde ist grundsätzlich innerhalb von sechs Wochen gegenüber
der unteren Denkmalschutzbehörde zu erteilen. Diese ist an die fachliche Stellungnahme der
Denkmalfachbehörde gebunden. Beabsichtigt die untere Denkmalschutzbehörde von der
Stellungnahme abzuweichen und kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet die obere
Denkmalschutzbehörde nach Anhörung der Denkmalfachbehörde. Sofern die Gemeinden einen
Denkmalpflegeplan erstellt haben (§ 3), entscheidet die untere Denkmalschutzbehörde über die
Erlaubnisanträge allein. Die Denkmalfachbehörde kann wegen der Bedeutung des Objekts und des
Vorhabens im Einzelfall die fachliche Beteiligung verlangen. Entsprechendes gilt für die fachliche
Beteiligung im Falle des § 12 Abs. 3.
(4) Die Erlaubnis erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der
Ausführung begonnen oder die Ausführung ein Jahr unterbrochen worden ist. Die Fristen nach Satz 1
können auf schriftlichen Antrag jeweils um bis zu einem Jahr verlängert werden.
(5) Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten übt die Rechte und Pflichten der unteren
Denkmalschutzbehörde für von ihr betreute oder verwaltete Kulturdenkmale aus.
§ 15
Beseitigung
widerrechtlicher Maßnahmen
Wer eine Maßnahme, die nach diesem Gesetz der Erlaubnis oder Genehmigung bedarf, ohne die
erforderliche Genehmigung oder im Widerspruch zu den bei der Genehmigung erteilten Auflagen
durchführt, ist auf Anordnung der Denkmalschutzbehörde verpflichtet, den alten Zustand
wiederherzustellen oder das Kulturdenkmal auf andere Weise entsprechend den Auflagen der
Denkmalschutzbehörde instand zu setzen. Die Denkmalschutzbehörden können die Einstellung der
Maßnahmen anordnen.
§ 29
Bußgeldbestimmungen
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. erlaubnispflichtige Maßnahmen entgegen § 13, § 18 Satz 1 oder § 19 Abs. 2 Satz 1 ohne Erlaubnis
beginnt oder durchführt oder einer von der zuständigen Behörde mit der Erlaubnis erteilten Auflage
zuwiderhandelt;
2. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2 Maßnahmen der Denkmalschutzbehörde zur Abwendung einer
unmittelbaren Gefahr für den Bestand eines Kulturdenkmals nicht duldet;
3. der Auskunftspflicht nach § 9 Abs. 1 nicht nachkommt oder entgegen § 9 Abs. 2 Satz 1 den
Beauftragten der zuständigen Behörde das Betreten von Grundstücken oder Besichtigen von
Kulturdenkmalen nicht gestattet;
4. entgegen § 8 Abs. 2 den Eigentumswechsel eines beweglichen eingetragenen Kulturdenkmals
nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt;
5. einer Einstellungsanordnung nach § 15 Satz 2 zuwiderhandelt;
6. entgegen § 16 Abs. 1 Satz 1 einen Fund nicht unverzüglich anzeigt;
7. entgegen § 16 Abs. 3 den Fund oder die Fundstelle nicht bis zum Ablauf einer Woche nach der
Anzeige in unverändertem Zustand lässt;
8. den von der Denkmalfachbehörde erlassenen, vollziehbaren Anordnungen zur Bergung,
Auswertung und zur wissenschaftlichen Bearbeitung nach § 16 Abs. 4 zuwiderhandelt;
9. einer Nutzungsbeschränkung nach § 20 Abs. 1 zuwiderhandelt.
(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1, mit Ausnahme der Zuwiderhandlungen nach § 13 Abs.
1 Nr. 1 Buchst. a, sowie Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 2 bis 9 können mit einer Geldbuße
bis zu einhundertfünfzigtausend Euro geahndet werden. Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1
können im Falle der Zuwiderhandlung gegen § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a mit einer Geldbuße bis zu
fünfhunderttausend Euro geahndet werden.
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist
die untere Denkmalschutzbehörde. Abweichend von Satz 1 ist die obere Denkmalschutzbehörde
zuständig, wenn gegen eine Maßnahme dieser Behörde verstoßen wird.
(4) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 begangen worden, so können die zur Vorbereitung
oder Begehung gebrauchten oder bestimmten Gegenstände eingezogen werden. § 19 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.
Thüringer Staatsanzeiger - Eintragung von Denkmalensembles in das Denkmalbuch
hier: Denkmalensemble "Pläncknerscher Rennsteig" (Thüringer Rennsteig) INV/001/99
Bezug: gemäß § 2 Abs. 2 ThDSchG in der Fassung vom 07.01.1992 (GVBl. S. 17 ff.)
Ausweisung am 23.09.1997 z.H.
- Thüringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur,
- Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt,
- Thüringer Innenministerium,
- Thüringer Landesverwaltungsamt/Obere Denkmalschutzbehörde u. Landesvermessungsamt,
- Landrat des Wartburgkreises,
- Landrat des Kreises Schmalkalden-Meiningen,
- Landrat des Kreises Gotha,
- Oberbürgermeister der Stadt Suhl,
- Landrat des Ilm-Kreises,
- Landrat des Kreises Hildburghausen,
- Landrat des Kreises Sonneberg,
- Landrat des Kreises Saalfeld-Rudolstadt,
- Landrat des Saale-Orla-Kreises erfolgt;
Ausweisungskriterien nach dem Thüringer Denkmalschutzgesetz:
§ 2 Absatz 3 ThDSchG — "bauliche Gesamtanlage",
Geltungsbereich:
gesamter Streckenabschnitt innerhalb und auf den Landesgrenzen des Freistaates Thüringen (Stadtund
Landkreise Wartburgkreis, Schmalkalden-Meiningen, Gotha, Suhl, Ilm-Kreis, Hildburghausen,
Sonneberg, Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla-Kreis)
von 99819 Hörschel (Rennsteig-km 0,0) bis 07366 Blankenstein/Saale (Rennsteig-km 168,3)
Aufgrund des auf den Freistaat Thüringen begrenzten Geltungsbereiches des Thüringer
Denkmalschutzgesetzes (ThDSchG) bleiben die im rechtlichen Zuständigkeitsbereich des Freistaates
Bayern befindlichen Streckenabschnitte von dieser Ausweisung als Kulturdenkmal unberührt.
Folgende Abschnitte des "Pläncknerschen Rennsteiges" sind noch weitgehend im originalen Zustand
erhalten. In diesen Abschnitten reicht der Gültigkeitsbereich des Kulturdenkmalensembles auf beiden
Seiten des Rennsteiges jeweils 50 Meter:
- Hörschel — Clausberg
- Vachaer Stein — Glasbach
- Gr. Weißenberg — Gr. Jagdberg bis Abzweig zur Tanzbuche
- Spießberg — Dreiherrenstein am Hangweg
- Neue Ausspanne — Ausspanne Neuhöfer Wiesen
- Ausspanne Neuhöfer Wiesen — Wachsenrasen
- Wachsenrasen — Abzweig Karin-Hütte
- Rondell — Schmücke
- Schmücke — Mordfleck
- Allzunah — Gr. Dreiherrenstein
- Limbach — Ortseingang Neuhaus (Rennsteig-km 110 — 116,0)
- Bahnhof Ernstthal — Waldstraße Piesau/Brandstraße (Rennsteig-km 120,8 — 125,0)
- Waldrand vor Spechtsbrunn — Kalte Küche (Rennsteig-km 127,5 — 129,5)
- Waldrand südöstlich "Kalte Küche" — Schildwiese (Rennsteig-km 130,0 — 132,0)
- Zwischen Kurfürstenstein und Blankenstein sind insbesondere die Abschnitte Rennsteig-km 144,3 —
148,2 sowie 148,5 — 155,3 sowie 160,6 — 161,7 sowie 163,5 — 164,2 sowie 167,5 — 168,3
unverändert.
Dagegen sind die nachfolgenden Abschnitte bereits verändert und somit von geringerem
Denkmalwert. In diesen Abschnitten reicht der Gültigkeitsbereich des Kulturdenkmalensembles auf
beiden Seiten des Rennsteiges jeweils 20 Meter:
- Clausberg — Vachaer Stein (Trassenführung durch Anlage eines Parallel-Weges verändert)
- Glasbach — Kleiner Weißenberg (Trassenführung durch Anlage eines Parallel-Weges verändert)
- Abzweig Tanzbuche — Heuberg (Trassenführung durch Anlage eines Parallel-Weges verändert)
- Heuberg — Abzweig Spießberghaus (Trassenführung durch Anlage eines Parallel-Weges verändert)
- Karin-Hütte — Grenzadler (chaussiert/Schotterstraße)
- Grenzadler — Rondell (durch Versorgungsleitungen stark verbreitert)
- Mordfleck — Allzunah (Trassenführung durch Anlage eines Parallel-Weges verändert)
- Stadtgebiet Neuhaus: historische Wegeführung verändert (Rennsteig-km 117,0 — 119,0)
- Gebiet Bahnhof Ernstthal, historische Wegeführung verändert
- Waldstraße Piesau — Brandstraße, historische Trassenführung verändert (Rennsteig-km 125,0 —
126,0)
- Gebiet Roter Berg vor Spechtsbrunn, historische Trassenführung verändert (Rennsteig-km 126,5 —
127,5)
- Kalte Küche — Waldrand, Kolonnenweg asphaltiert (Rennsteig-km 129,5 — 130,0)
- innerhalb der Teilstrecke Kurfürstenstein — Blankenstein sind folgende Abschnitte stärker verändert:
146,0 — 146,5 sowie 148,2 (Friedhof Brennersgrün) — 149,0 (Ochsenhut Brennersgrün) sowie 159,8
— 160,5 sowie 161,5 — 163,5 sowie 164,2 — 167,5
Erfurt, 23.09.1997.
Landesamt für Denkmalpflege
Erfurt, 29.06.1999
Az.:INV/001/99
ThürStAnz Nr.
Eintragung von Denkmalensembles in das Denkmalbuch – Korrektur
hier: Denkmalensemble „Plänckner’scher Rennsteig“ (Thüringer Rennsteig) INV/014/08
veröffentlicht im ThürStAnz Nr. 30/1999 (INV/001/99)
Bezug:
gemäß § 2 Abs. 2 ThürDSchG in der Fassung der Neubekanntmachung vom
14. April 2004 (GVBl. Nr. 10/2004 S. 465), geändert durch Gesetz vom
23. November 2005
(GVBl. 16/2005 S. 359)
In Abstimmung mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt werden aus denkmalrechtlichen Gründen
folgende Korrekturen vorgenommen:
1. Der „Thüringer Rennsteig“ wird nicht wie bisher als Denkmalensemble § 2 Abs. 2
ausgewiesen, sondern als Einzel-Kulturdenkmal im Sinne einer Sachgesamtheit § 2 Abs. 1.
2. Der in der Beschreibung des Kulturdenkmals (Anlage 1) aufgeführte Geltungsbereich auf
beiden Seiten des Rennsteigs von 50 Metern und 20 Metern in jeweils unterschiedlichen
Streckenabschnitten wird aufgehoben und ersatzlos gestrichen. Das bedeutet, dass sich der
Denkmalschutz ausschließlich auf den historischen Verlauf des Rennsteigs sowie seine
Sachteile Grenzsteine, Wegweiser, Gedenksteine und Schrifttafeln sowie Wegkreuzungen,
Pässe und Raststätten bezieht.
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie
Erfurt, 09.06.2008
Az.: INV/014/08
ThürStAnz. Nr. 26/2008 S. 992
30/1999 S. 1665-1666
Die historische Entwicklung des Denkmalschutzes und Naturschutzes am Rennsteig
Mit der Unterschutzstellung werden die über ein Jahrhundert andauernden Bemühungen zahlreicher Rennsteigforscher und interessierter Freunde der Region belohnt, welche sich um die Schutzwürdigkeit einer reizvollen Landschaft bisher bemühten. Solange die Grenzsteine Ländergrenzen markierten, war deren Existenz durch Verordnungen und Gesetze geschützt und ihre Bedeutung eindeutig definiert.
Mit dem Wegfall der Kleinstaaterei in Thüringen nach 1918, verloren die Steine ihre ursprüngliche Bedeutung, zumindest dort, wo sie nicht unmittelbar eine weiter bestehende Grenze markierten. Dies war auch für den überwiegenden Teil des Rennsteiges der Fall, in welchem die ehemalige Landesgrenze durch die Mitte des Rennsteigs gebildet wurde.
Durch die verstärkt aufkommende Rennsteigbewegung wurde über eine Organisation nachgedacht und so bildete sich 1896 der Rennsteigverein. Besonders auf Initiative dieses Vereines wurden regelmäßige Inventuren des Grenzsteinbestandes durchgeführt. Leider kam es nie zu einer kompletten Veröffentlichung der Ergebnisse der Erhebungen.
Beispielsweise wurde in der Bekanntmachung der Ordnung zur 25. Pfingstrennfahrt 1926, Blankenstein - Hörschel über eine geplante
...gemeinsame Überprüfung der Grenzsteinstrecke 1-136, Dreiherrenstein Hoher
Lach- Limbach, auf Vollständigkeit und Erhaltungszustand der Grenzsteine (Nummer
oder Doppelnummer, Wappenform, Jahreszahlen, Richtungsstriche oder- winkel)...
Quelle: Mareile Bote des Rennsteigvereins. II. Jahrgang Nr. 2 vom 1.Mai 1926. S. 74-75. berichtet.
In der Folge wird im Mareile immer wieder über eine Katalogisierung diskutiert. Unter dem Titel: Freiwillige vor, wird in der Ausgabe Nr. 3 vom 1. August 1926 von Johannes Bühring eine Anleitung zur einheitlichen Steininventur vorgeschlagen.
Besondere Verdienste bei diesen Arbeiten haben sich Elisabeth Streller und Prof. Hermann Böttger erworben. Elisabeth Streller erstellte einen Arbeitsplan zur generellen Erfassung aller relevanten Daten des Rennsteiges.
Quelle: Mareile Bote des Rennsteigvereins. I. Jahrgang Nr. 2 vom 1. März 1927. S. 11-12.
In den Folgejahren wurde die Grenzsteininventur immer wieder aktualisiert. Leider sind die Unterlagen aber nicht mehr auffindbar.
Natürlich gab es auch Aktivitäten anderer Art, die den Bestand der Grenzsteine am Rennsteig akut gefährdeten.
Unter der Überschrift: Die Republikanische Beschwerdestelle und die Rennsteiggrenzsteine, veröffentlicht das Mareile Nr. 1 vom 01. Februar 1926 nachfolgend ungekürzt wiedergegebene Artikel:
Thüringisches Ministerium für Inneres und Wirtschaft, Abt. Inneres Weimar,
an die Republikanische Beschwerdestelle, Berlin.
Auf Ihr eingeschriebenes Schreiben vom 9. November wegen Beseitigung
von Grenzsteinen am Rennsteig haben wir sofort den Kreisdirektor in
Arnstadt beauftragt, die nötigen Ermittlungen vorzunehmen. Dieser hat uns
berichtet, dass infolge des auf dem Thüringer Walde liegenden Schnees
zurzeit die Wege dort nahezu völlig unpassierbar und auch die Steine, die
Ihren Anstoß erregt haben, unter dem Schnee fast ganz verschwunden sind.
Es ist uns deshalb zurzeit zu unserem größten Bedauern leider nicht
möglich, genauere Feststellungen zu machen, um so mehr, als die beiden
von Ihnen genannten Steine nicht die einzigen Grenzsteine auf dem
Rennsteig im Landkreise Arnstadt sind, die noch die alten
Hoheitsbezeichnungen tragen. Wir sind deshalb zu unserem größten
Bedauern genötigt, die wichtige Angelegenheit bis zum Eintritt besseren
Wetters zurückzustellen. Wir werden aber die Witterung auf dem Thüringer
Walde mit größter Aufmerksamkeit verfolgen und werden, sobald es uns
möglich ist, weitere Feststellungen zu treffen versuchen. Wir werden Ihnen
dann sofort Nachricht geben.
gez.: Dr. Sattler
Die Republikanische Beschwerdestelle, Berlin, an das Thüringische
Ministerium, Abt. Inneres, Weimar.
Den gefl. amtlichen Bescheid vom 11. Dezember haben wir mit großem
Vergnügen erhalten. Wir nahmen gern davon Kenntnis, daß der Herr
Minister Dr. Sattler sich bereit erklärt hat, die Grenzsteine mit der
monarchistischen Bezeichnung entfernen zu lassen. Was die
angeschnittene Witterungsfrage auf dem Thüringer Walde anlangt, so sind
wir der Meinung, dass das dortige Ministerium bei der Bearbeitung der vielen
wichtigen Dinge vielleicht nicht in der Lage sein dürfte, gerade diese
Angelegenheit genau im Auge zu behalten. Wir werden uns deshalb
gestatten, diese Sache für einige Monate zurückzustellen und bei Beginn
des Frühjahres, wenn die Schneemassen verschwunden sind, dann diesen
Fall dem Herrn Staatsminister Dr. Sattler oder dem dann amtierenden Herrn
Minister des Innern erneut vorzulegen.
gez. Republikanische Beschwerdestelle.
Hier wird deutlich, welche Wirkung eine fehlende Sachkenntnis der geschichtlichen Hintergründe hervorbringen kann. Die Unwissenheit war aber nur der Vorbote einer noch schlimmeren Entwicklung während der Hitlerdiktatur. Am 15. November 1933 erschien in der Nr. 268 der Suhler Zeitung folgender Artikel:
Jugend kennt keine innerdeutschen Grenzen
„Unter dem gewaltigen Eindruck der Einigung aller Deutschen begab sich
eine Abteilung der Hitlerjugend aus Mainz zu den preußisch-hessischen
Grenzsteinen, um sie kurzerhand zu beseitigen“.
Der ständigen Intervention des Rennsteigvereins in Zusammenarbeit mit den Forstund Katasterämtern war es zu verdanken, dass größerer Schaden am Steinbestand vermieden wurde. Bei sogenannten Landesgrenzbegehungen wurden alle Steine kontrolliert, nötigenfalls gerichtet oder tiefer gesetzt.
Am 19. Mai 1934 wird auf der Jahreshauptversammlung des Rennsteigvereines in Blankenburg a.d. Saale unter Punkt 5 der Tagesordnung über den Schutz des Rennsteiges diskutiert.
Quelle: Mareile Bote des Rennsteigvereins. II. Jahrgang Nr.4 vom 1.Juli 1934. S. 131-132.
In der Folge wird am 31. August 1940 eine Vorläufige Anordnung über die einstweilige Sicherstellung von Landschaftsteilen beiderseits des Rennsteiges verabschiedet. Damit würdigt man erstmalig den Schutz des Rennsteiges als Gesamtheit.
Nachfolgend der Text dieser Anordnung im Originalwortlaut:
Vorläufige Anordnung über einstweilige Sicherstellung von Landschaftsteilen
beiderseits des Rennsteiges
Auf Grund der §§ 5, 17 und 19 des Reichsnaturschutzgesetzes vom
26.6.1935 (RGBl . 1, S . 821) in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur
Änderung und Ergänzung des Reichsnaturschutzgesetzes vom 1.12.1936
(RGBl. 1, S. 1001) und des Dritten Gesetzes zur Änderung des
Reichsnaturschutzgesetzes vom 20.1.1938 (RGBl.1, S. 36), sowie des § 11
Abs. 3 und des § 13 der Durchführungsverordnung vom 31.10.1935 (RGBl.
1, S. 1275) wird mit Ermächtigung der Obersten Naturschutzbehörde
zugleich für die in den Regierungsbezirken Erfurt, Kassel und Ansbach
gelegenen Landschaftsteile zur einstweiligen Sicherstellung des im § 1
näher bezeichneten Geländes folgendes verordnet:
§ 1
Die in der Landschaftsschutzkarte bei der höheren Naturschutzbehörde in
Weimar eingetragenen Landschaftsteile beiderseits des Rennsteiges
zwischen Eisenach und Blankenstein a. d. Saale werden in einer Tiefe von
durchschnittlich 500 m einstweilig sichergestellt.
§ 2
1. Es ist verboten, innerhalb der Geländestreifen von 500 m beiderseits des
Rennsteigs zwischen Eisenach und Blankenstein a. d. Saale Änderungen
vorzunehmen, die geeignet sind, die Natur zu schädigen, den Naturgenuss
zu beeinträchtigen oder das Landschaftsbild zu verunstalten.
2. Im besonderen ist verboten:
a) innerhalb der geschützten Geländeteile Gehölze, Bäume und Hecken,
Tümpel und Seen oder sonstige für das Landschaftsbild wichtige
Landschaftsbestandteile zu verändern, zu beschädigen oder zu beseitigen.
b) Bauwerke aller Art, einschließlich von Mauern und Zäunen, zu errichten
oder zu verändern: - (die für den laufenden Betrieb der Forstverwaltung
notwendigen Vorrichtungen wie Kulturgatter und Wildzäune werden
hierdurch nicht berührt) - ;
c) Müll oder Schutt abzulagern oder Sand- und Kiesgruben, Steinbrüche und
dergl. anzulegen;
d) oberirdische Drahtleitungen zu erstellen;
e) Inschriften anzubringen, soweit sie nicht auf den Naturschutz oder die
Wegebezeichnung Bezug haben;
f) grundstücksweise außerhalb des bisherigen Waldes aufzuforsten;
g) solche Eingriffe im Walde vorzunehmen, die das Landschaftsbild
verunstalten.
§ 3
1. Unberührt von Vorschriften im § 2 bleibt die land- und forstwirtschaftliche
Nutzung, soweit sie dem Inhalt und Zweck dieser Anordnung nicht
widerspricht.
2. Ausnahmen von den Vorschriften dieser Anordnung können von mir in
besonderen Fällen im Einvernehmen mit den beteiligten Behörden
genehmigt werden.
§ 4
Wer den Bestimmungen dieser Anordnung zuwiderhandelt, wird nach §§ 21
und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes und dem § 16 der
Durchführungsverordnung bestraft.
§ 5
Diese Anordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe in Kraft.
Weimar, den 31.August 1940.
Der Reichsstatthalter in Thüringen.
Der Staatssekretär und Leiter des Thüringischen Ministeriums des Innern -
als höhere Naturschutzbehörde -
P a b s t i . A .
- III A 3106
Leider kam es durch den 2. Weltkrieg zu einer Interessenverschiebung, so dass dieser Gesetzesvorstoß im Prinzip nur Makulatur war. Auch auf dem Territorium der ehemaligen DDR waren Natur- und Denkmalschutz gesetzlich geregelt. Wirtschaftliche, politische und militärische Interessen aber verhinderten oftmals ihre umfassende Durchsetzung. So verläuft eine Hauptgastrasse über weite Strecken auf dem Rennsteig. Viele der heute fehlenden Steine fielen den damaligen Erdarbeiten zum Opfer. Bei Forstarbeiten wurden einige Steine durch umstürzende Bäume beschädigt oder vernichtet. Aus dem Jahre 1978 stammen beispielsweise Dokumente zur Verlegung des Rennsteiges in Neuhaus a. Rwg. Die Verlegung erfolgte im Zusammenhang mit dem Beginn der Bauarbeiten am Pumpspeicherwerk Goldisthal.
Zu diesem Zweck wurden seinerzeit großflächige Abholzungen im Bereich des Herrnberges vorgenommen. Der Originalrennsteig verläuft genau durch das Gebiet. Mit etwas planerischem Geschick hätte hier größerer Schaden vermieden werden können. Die Umverlegung wurde durchgeführt und im Rahmen von Schulungen der sozialistischen Kader diskutiert. Nachfolgend, auszugsweise eine Einladung für eine solche Schulung:
Einladung
In Vorbereitung der 26. Tagung der Stadtverordnetenversammlung findet zur
weiteren Qualifizierung der Abgeordneten und weiterer Führungskräfte die
nächste Schulung lt. Schulungsplan am
Donnerstag, dem 20.07.1978, 16.00 Uhr im Röhrenwerk Neuhaus -
Abgeordnetenkabinett -
mit dem Thema:
„Die Rolle der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit für die Erhöhung der
Effektivität in der staatlichen Leitungstätigkeit und Beratung über Probleme,
die im Zusammenhang mit dem Bau des Pumpspeicherwerkes Goldisthal,
Teilobjekt Umschlagplatz Herrnberg, wie z. B. Verlegung des Rennsteiges
usw. stehen“
statt.
Referent: Koll . ............ , Rat des Kreises, Plankommission
Wir laden Sie dazu ein und bitten um Ihre Teilnahme.
Wir weisen darauf hin, dass in der Stadtverordnetenversammlung am
27.07.1978 wegen der Verlegung des Rennsteiges ein Beschluss gefasst
werden soll und dass es sich deshalb unbedingt notwendig macht, an dieser
Beratung teilzunehmen.
Zur besseren Orientierung übersenden wir in der Anlage drei Vorschläge
(Information Nr. 3 - 5 / 1978) zur Verlegung des Rennsteiges, wobei wir den
Vorschlag Nr. 2 als Vorzugsvariante angeben.
Wir bitten Sie, in der Abgeordneten - Schulung Ihre Meinung dazu zu
äußern.
Außerdem bitten wir Sie, die Einladung an der Wache des VEB Röhrenwerk
vorzuzeigen und pünktlich zu erscheinen.
3 Anlagen


Holzeinschlag am Herrnberg bei Neuhaus am Rennweg (oben), Gasleitungsbau Limbach (unten)
hist. Fotos, G. Weiss
Positiv ist zu bewerten, dass alle in diesem Bereich sichtbaren Steine sichergestellt und im Geißlermuseum in Neuhaus am Rennweg eingelagert worden sind. Drei Grenzsteine erhielten an der favorisierten Ausweichstrecke zwischen Neuhaus und Bernhardsthal einen neuen Standort und wurden somit ihrer eigentlichen Funktion beraubt, denn diese Grenzsteine waren ursprünglich keine Wegemarkierung für Rennsteigwanderer, sondern durch den Steinsatz wurden Grenzen eindrucksvoll dokumentiert, die auch beim Bau des Umschlagplatzes für das Pumpspeicherwerk noch völlige Gültigkeit besaßen. Die Arbeiten am Umschlagplatz wurden in den 80iger Jahren des 20. Jahrhunderts wegen Kapazitätsmangel eingestellt. Zurück blieben neben der Zerstörung wertvoller Grenzzeugen auch nie wieder gut zu machende Schäden an Natur und Umwelt. Ein Trost für alle Verfechter der
damaligen Ideologie bleibt aber, dass nach der politischen Wende die Arbeiten an der gleichen Stelle wieder aufgenommen wurden. Der Rennsteig wurde als Medientrasse für die Arbeiten im Zusammenhang mit den neu entstehenden Gewerbegebieten in unmittelbarer Nachbarschaft genutzt, umverlegt und in seiner ursprünglichen Trasse völlig zerstört.
Mit der fortschreitenden Vernichtung wertvollen Kulturgutes beiderseits des Rennsteiges wird einerseits die geschichtlich gewachsene Rennsteigbewegung ignoriert, andererseits werden Teile der Haupttourismusattraktion in Thüringen, welche nun einmal der Rennsteig ist, zerstört.
Wahrscheinlich ist es aber einfacher Sponsorengelder aufzutreiben, um Zerstörtes wieder instand zu setzen, als im Vorgriff einvernehmliche Lösungen zu finden, die eine solche Entwicklung verhindern. Diese Entwicklung macht offenbar vor gesellschaftlichen Systemen keinen Unterschied - eine traurige Gemeinsamkeit.


Schwarzburger Meilenstein in Igelshieb (oben), Rennsteiglauf um 1970 in Limbach (unten)
hist. Fotos, G. Weiss
Maßgebend für die Durchsetzung des Natur- und Denkmalschutzes in der DDR waren meistens die Mitglieder des ehemaligen Kulturbundes. Es passte so gar nicht in das Konzept des real existierenden Sozialismus, dass es Menschen gab, die sich mit der Geschichte des Steinsatzes beschäftigten, war diese Geschichte doch ein Relikt der verpönten monarchistischen Kleinstaaterei. Auf lokaler Ebene wurden die interessierten Bürger häufig als Volks- oder Heimattümler bezeichnet. Aber gerade der Hilfe dieser Freunde ist es zu verdanken, dass in schweren Zeiten, ein historisches Kulturgut bewahrt wurde. Stellvertretend für Alle sind hier Werner Messing und Günther Weiss zu nennen, die in regelmäßigen Abständen den Steinbestand kontrollierten und darüber Protokoll führten.
In Kleinschmalkalden war es besonders Helmut Köllner, welcher den Nachlass von Werner Messing auswertete und zur Dokumentation zusammenstellte. Die Freunde des Vereins für Schmalkaldische Geschichte und Landeskunde e.V. waren es auch, die federführend bei der Unterschutzstellung mitwirkten. Unter ihrer Regie wurden die gesamten notwendigen Unterlagen zusammengestellt und zur Bearbeitung an das Landesamt für Denkmalpflege übergeben. Um diese aufwändigen Arbeiten auch weiterhin durchführen zu können, ist es wichtig, jüngere Menschen zu mobilisieren und für die aktive Unterstützung zum Erhalt der Grenzsteine zu gewinnen. Über die schulische Ausbildung kann das Engagement für die örtliche Geschichte gefördert werden, damit interessierte Jugendliche gewonnen werden, die später einmal die Arbeit der früheren Generationen fortsetzen können.



Werner Messing, Helmut Köllner, Erich Röder (v.li.n.re.),
Günther Weiss (oben rechts), Landschaftsschutzschild nach G. Weiss
hist. Fotos, G. Weiss
Seit dem Jahre 2004 kämpfen wir dafür, das denkmalgeschützte Inventar des Rennsteiges auch als Denkmal zu kennzeichnen. Auch hier können wir nicht im größeren Umfang auf die Hilfe aller beteiligten öffentlichen Institutionen bauen. Thüringen ist eines der wenigen Bundesländer, die die Pflicht zur Kennzeichnung der Denkmale nicht im Denkmalschutzgesetz verankert hat. Ist es Dummheit oder Berechnung?
Auch die Initiative zur Kennzeichnung der Denkmale verblieb bei uns. Bereits im Jahre 2004 ermittelten wir durch einen Wettbewerb das Schild, welches wir erstmals im Spätherbst 2009 in der Nähe besonders gefährdeter Grenzsteine im Neustädter Raum angebracht haben. Ganze 4 Jahre waren vergangen, bevor das erste Schild zur Kennzeichnung angebracht werden konnte.
Nachfolgend erstmals in der Rennsteiggeschichte eine Veröffentlichung aller 17 im Jahre 2004 eingereichten Wettbewerbsvorschläge.

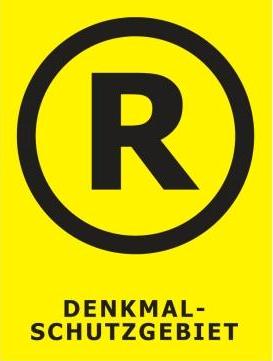
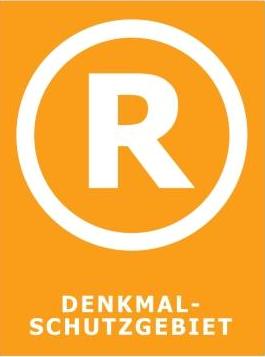
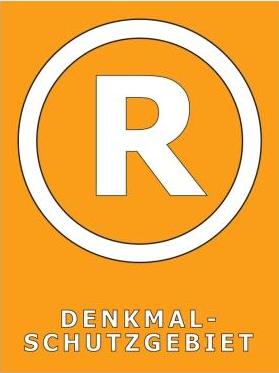






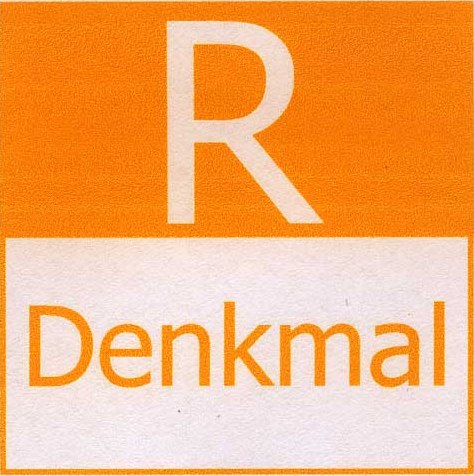
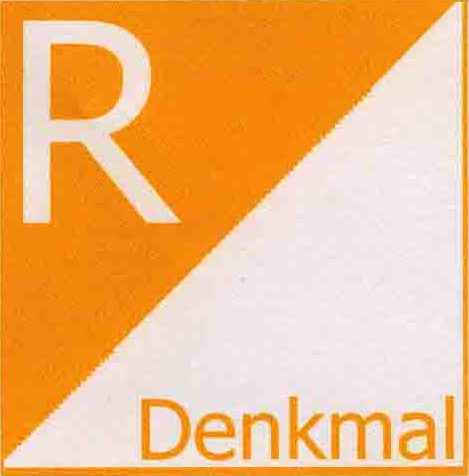
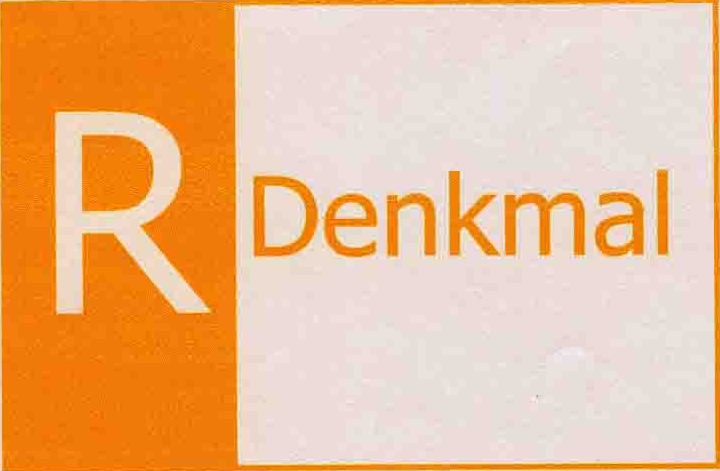
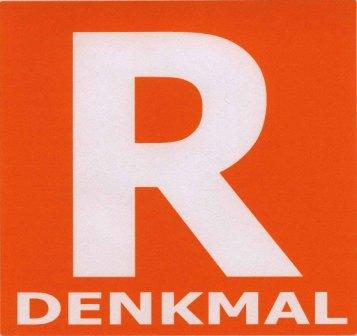
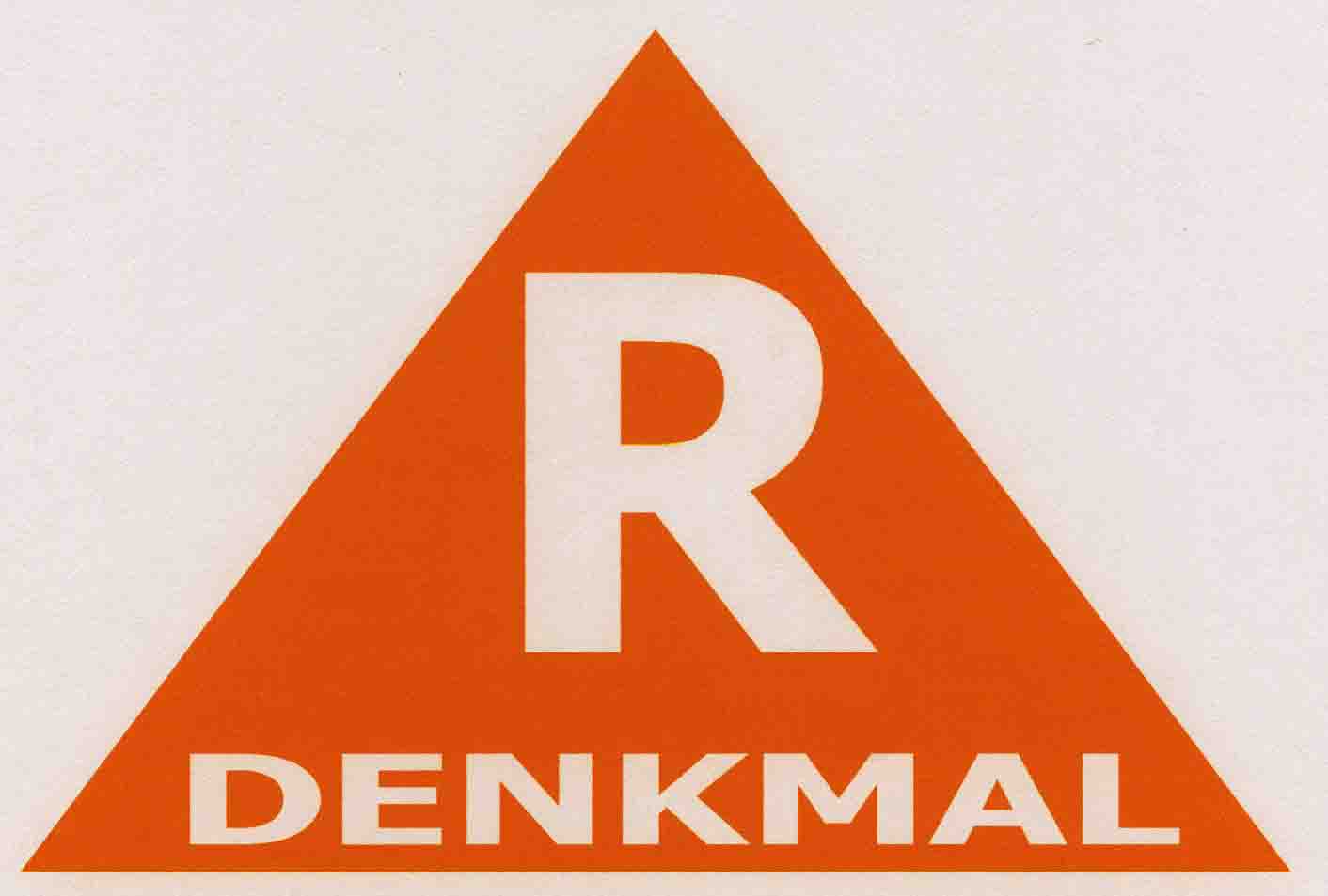

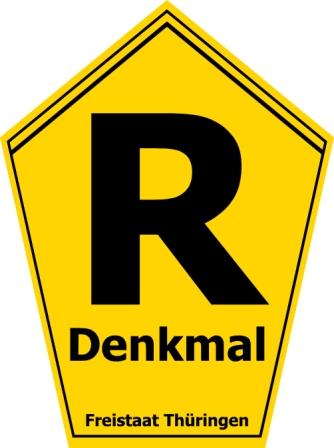
Der Gewinner! (Bild 17) - schwarzes R auf gelbem Grund
So ist es kein Wunder, dass die im mit Schreiben des Landesamtes für Denkmalpflege angekündigte Änderung (Abschaffung) der Schutzzonen des Rennsteiges an die in Thüringen zuständigen Behörden mit Datum vom 25.09.2006 , erst am 09.06.2008 im Thüringer Staatsanzeiger veröffentlicht wurde (s. oben: Eintragung von Denkmalensembles in das Denkmalbuch – Korrektur).
Das geschah auf mein Veto hin, weil es einfach vergessen worden ist!
Ein weiteres Beispiel aus dem täglichen Leben ist bezeichnend für den Wert des Denkmalschutzes am Rennsteig:
Am 25. Januar 2000 reichte ich die Unterlagen für den Thüringer Denkmalschutzpreis 2000 über das Landratsamt Sonneberg beim Thüringer Landesamt für Denkmalpflege Erfurt ein.
Grundanliegen des Beitrages war die in den voran gegangenen Jahren durchgeführte Sanierung historischer Landesgrenzsteine, die seit dem Jahre 1997 unter Denkmalschutz stehen, durch Mitarbeiter des damaligen Katasteramtes Neuhaus am Rennweg. Insgesamt sanierten die Mitarbeiter, vor allem die Auszubildenden, fast 200 historische Landesgrenzsteine in ihrer Freizeit. Im Rahmen der Ausbildung zum Vermessungstechniker wurden die Grenzsteinstandorte vermessen. Die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb sollte eine Auszeichnung für den geleisteten persönlichen Einsatz während der Sanierungsarbeiten sein.
Der Beitrag wurde nicht bearbeitet, eine schriftliche Stellungnahme seitens des damaligen Landesamtes für Denkmalpflege ist nie erfolgt. Er blieb über ein Jahr unbearbeitet in den Schubladen einer bekannten Mitarbeiterin des Landesamtes liegen.
Übrigens ist im Bundesland Sachsen-Anhalt ein ähnlicher Beitrag dortiger Grenzsteinforscher mit dem Denkmalschutzpreis ausgezeichnet worden. Dort stehen die Grenzsteine aber nicht unter Denkmalschutz.
Freysoldt, August
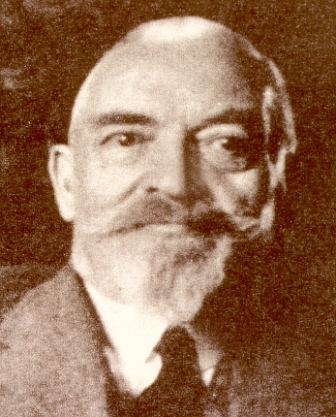
*18. Januar 1856, Kranichfeld
†09. März 1932, Sonneberg
Ich muß bei der Arbeit bleiben , denn wenn man sich ausschaltet , so wird man rasch überständig.
(Freysoldt am 03.01.1931 an Felix Weßling)
Am 18. Januar 1856 wurde August Freysoldt in Kranichfeld geboren. Nach dem Studium war er als Praktikant in Neuenbau und Gösselsdorf tätig. Weitere Stationen seines beruflichen Wirkens waren Steinach und Trostadt bei Themar. 1912 wurde ihm die Leitung der Oberförsterei und der Forstschule Sonneberg übertragen. Hier arbeitete er bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1925.
Noch zu Lebzeiten wurde Freysoldt, dessen Verdienste bereits damals hoch geschätzt wurden, ein Denkmal gesetzt. Am 20. September weihten Mitglieder des Verschönerungsvereines Sonneberg im Beisein von Freysoldt unweit vom Berlagrund auf halber Höhe zwischen der Sonneberger Altstadt und Neufang die Forstmeister- Freysoldts- Ruhe ein.[1]


Freysoldt's Ruh oberhalb der Sonneberger Altstadt im verwahrlostem Zustand
August Freysoldt verstarb am 09. März 1932 in Sonneberg.
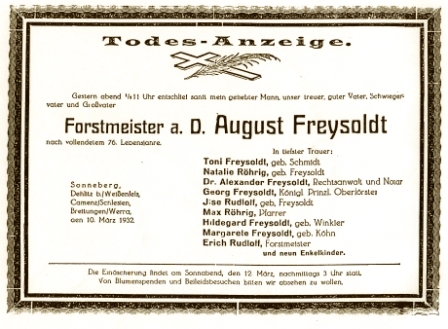

evangelische Kirche zu Sonneberg in Thüringen

Familiengrab der Freysoldt's auf dem Sonneberger Hauptfriedhof
Freysoldt war ein unermüdlicher Forscher, der sich nie mit Erreichtem zufrieden gab. Er versuchte die Entwicklung der Forstgeschichte unserer Region umfassend darzustellen. Breiten Raum bei seiner Forschungsarbeit nahm dabei die Aufarbeitung von geschichtlichen Daten der Rennsteigregion ein.
Mit der laufenden Nummer 80 wurde der damalige Forstassessor Freysoldt am 14.10.1898 Mitglied im Rennsteigverein 1896.[2]
Zahlreiche fachliche Artikel erschienen seitdem im Mareile, dem Boten des Rennsteigvereins.
Die Qualität der dort veröffentlichten Fachbeiträge hatte durchaus ein sehr hohes Niveau. Ein ständiger Diskurs über die Deutung bestimmter historischer Zusammenhänge bezüglich der Rennsteigfrage wirkte sich günstig auf dieses hohe Niveau aus.
Freysoldts Abhandlungen standen hier neben so großen Namen wie Johannes Bühring, Ludwig Hertel, Luise Gerbing, Bruno von Germar, Max Kroebel, Felix Weßling, Heinrich Hess oder Regel und Werneburg, Riehl und Mitzschke. All diese Forscher machten sich verdient bei der Erforschung des Rennsteiges.
Schon ein Jahr nachdem Freysoldt Mitglied im Rennsteigverein wurde, erschien im Mareile sein erster Artikel: Die Berge am Rennsteig im Fürstentum Sachsen- Coburg.[3]
Zu diesem Zeitpunkt war Freysoldt noch als Forstassessor in Gösselsdorf bei Reichmannsdorf eingesetzt.
Umfangreiche Quellenstudien im Coburger Haus- und Staatsarchiv bildeten die Grundlage für diesen Artikel. Ausgangspunkt war die vom Coburger Herzog Casimir 1569 verordnete Grenzbereitung im Sonneberger Oberland an der Grenze zum Schwarzburgischen. Im Beitrag wird auch Bezug genommen auf die damals schon vorhandene Versteinung der Landesgrenze am Rennsteig.[4]
Die aufkommenden glas- und holzverarbeitenden Betriebe des Oberlandes waren auf das Holz als Rohstoff und Brennmaterial angewiesen. Durch regelmäßige Bereitungen wurde gewährleistet, dass eine ausreichende Kontrolle der Bestände vorgenommen wurde. Das damalige Oberland war nahezu vollständig mit Wald bedeckt.
Man kann ohne Zweifel sagen, dass dieser Artikel bereits als Vorgedanke zu dem 1904 erschienenen Hauptwerk Freysoldts Die Fränkischen Wälder zu sehen ist.
Doch bis zum Erscheinen dieses Werkes war Freysoldt nicht untätig.
Im Februar 1900 berichtet Freysoldt über den Rückzug der Reichsarmee nach der Schlacht bei Roßbach (den 5.Nov. 1757 ) über den Thüringer Wald im Siebenjährigen Krieg.[5]
Der rechte Flügel der Armee zog sich bei Igelshieb über den Rennsteig zurück und lagerte u.a. am 11. November auch im Sonneberger Oberland bei Steinach und Lauscha. Das Zentrum der Armee überschritt auf der Kalten Küche den Rennsteig.
Ein weiterer Meilenstein im Schaffen von August Freysoldt war seine Abhandlung in den Schriften des Vereins für Sachsen- Meiningische Geschichte und Landeskunde im Jahre 1901: Der Rennsteig des Thüringer Waldes in seinem östlichen Teile eine Heerstraße und ein Verkehrsweg im Mittelalter.[6]
Anhand zahlreicher historischen Belege versucht Freysoldt nachzuweisen, dass der Rennsteig in seinem östlichen Teil die Berechtigung als Verkehrsweg im Mittelalter hatte. Er verglich die Breite des Weges an verschiedenen Punkten mit der Spurbreite von mittelalterlichen Fuhrwerken. Im Laufe der Jahrhunderte prägten sich auf bestimmten Teilen des Rennsteiges Fahrspuren von Fuhrwerken im Boden ein , welche ebenfalls mit in die Untersuchungen einbezogen wurden. War ein solcher Weg für Fuhrwerke nutzbar, hatte er natürlich auch strate-gische Bedeutung. Die Bestrebungen von Herzog Ernst dem Frommen, einen Weg für Truppenbewegungen von Hessen über den Höhenzug des Thüringer Waldes nach Böhmen zu suchen, bestärkte Freysoldt in seiner Theorie, dass der Rennsteig auch eine wichtige strategische Bedeutung hatte. In die Überlegungen von Freysoldt flossen auch noch geschichtliche Ereignisse aus dem 15. Jahrhundert ein, die die Theorie Freysoldts bestätigen sollten.
Freysoldt kannte man immer als aktives Mitglied im Rennsteigverein. Er berichtete z.T. auch über interessante Details im Zusammenhang mit der geschichtlichen Entwicklung in seinem unmittelbaren Wirkungsbereich. So finden wir im Mareile vom 01.09.1908 einem interessanten Kurzbericht über einen Silbermünzenfund bei Ernstthal am Rennsteig.[7]
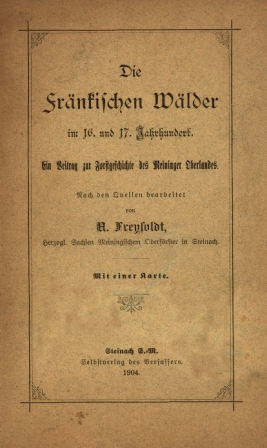
1904 erschien dann seine Hauptarbeit: Die Fränkischen Wälder im 16. und 17. Jahrhundert.
Für die Bearbeitung war ein umfassendes Quellenstudium notwendig. Da Freysoldt bereits bei seinem Artikel von 1899 über die Berge des Coburger Oberlandes ausreichend Erfahrung gesammelt und wichtige Vorarbeit geleistet hatte, konnte er sich bei der neuen Aufgabe hervorragend auf diese Erkenntnisse berufen.
Neben einer Zustandsanalyse des Waldes, einer Beschreibung der Forstämter und verschiedener anderer Details, befasste er sich wieder ausführlich mit den regelmäßigen Grenzbereitungen der damaligen Zeit im Rennsteiggebiet.
Die „Schnebelichte Buche“ im Zusammenhang mit dem um 1548 gesetzten Dreiherrenstein Hoher Lach sowie die „Schmale Buche“, werden in den Forst- und Grenzbereitungen als markante Punkte immer wieder genannt. Besonders das Gebiet um die „Schnebelichte Buche“ war ein beliebtes Streitobjekt bei den damaligen Herrschern der Anliegerstaaten.
Urkunden in den Archiven von Rudolstadt, Meiningen und Coburg wiesen Markscheidungen nach, die sich bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts zurückverfolgen lassen.[8]
Waren es anfänglich Lach- oder Malbäume, die die Grenze markierten, wurden diese Grenzen seit Ende des 15. Jahrhunderts zunehmend mit festen Grenzzeichen vermarkt. Die aufgrund der Verweslichkeit unsicheren Mal-bäume waren nicht zuletzt oft der Anlass zu Streitigkeiten über den Grenzverlauf. Ein Grenzstein, ab etwa 1500, mit den Hoheitszeichen der Anliegerstaaten dagegen, bot weit bessere Sicherheiten. Im Rennsteigabschnitt zwischen Hoher Lach und Hoher Heide existiert als ältester Stein auf der Pechleite hinter Friedrichshöhe wahrscheinlich ein Stein aus dem Jahre 1526.[9]
Als Anlage zu seinem Werk über die Fränkischen Wälder liefert Freysoldt eine Karte der Situation um 1555. Die Karte zeichnet sich übrigens durch eine hohe Lagegenauigkeit in Bezug auf die aktuelle Top. Karte 1:50000 des Thüringer Landesvermessungsamtes aus.
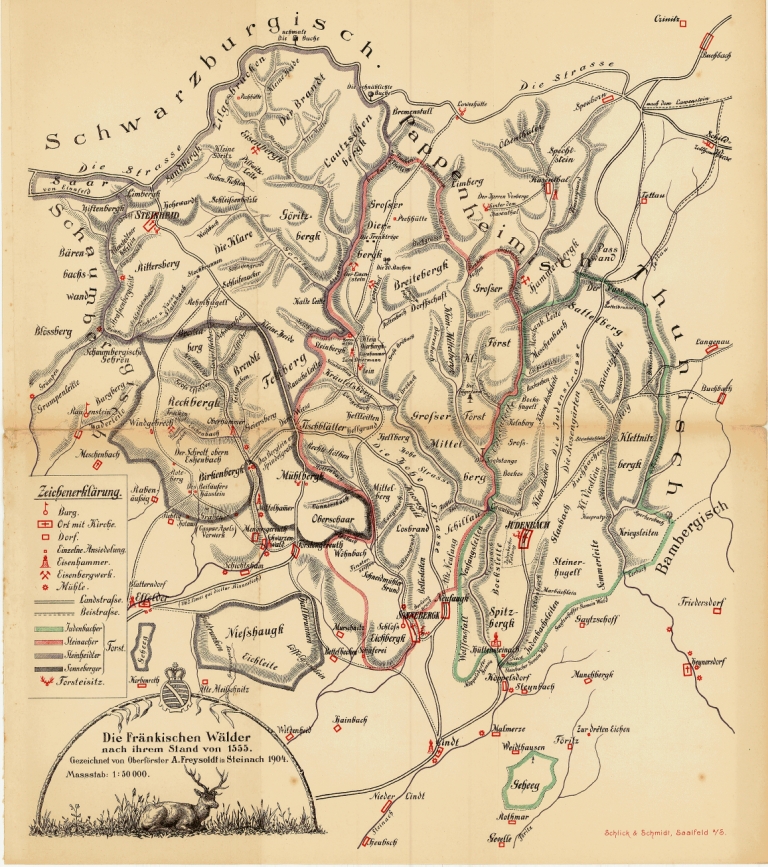
Wir schreiben das Jahr 1912. Freysoldt veröffentlicht im Mareile einen Beitrag über den ursprünglichen Zweck der Rennwege.[10]
Erstmals kommt es zur kritischen Auseinandersetzung, die, wie eingangs erwähnt, durchaus der Rennsteigforschung dienlich war. Die unterschiedlichen Auffassungen der Forschung zur Bedeutung des Wortes Rennsteig trug wesentlich zum qualitativ hohen Standard des veröffentlichten Schriftgutes bei.
Freysoldt und C. Riehl[11] bildeten mit ihrer konträren Meinung zu diesem Thema keine Ausnahme.
Zwischen 1906 und 1907 veröffentlichte Freysoldt einige interessante Artikel über regionale Details der Rennsteigregion. Der Bericht über Neustadt am Rennsteig[12] und die Laubeshütte[13] werden hier genannt.
Im Artikel: Des Weidewerks Rennwege[14] befasst sich Freysoldt wieder mit der alten Frage der jagdlichen Bedeutung des Höhenweges.
Ein weiterer Höhepunkt im Schaffen des Forstmannes war seine Veröffentlichung Alte Hufeisen.[15]
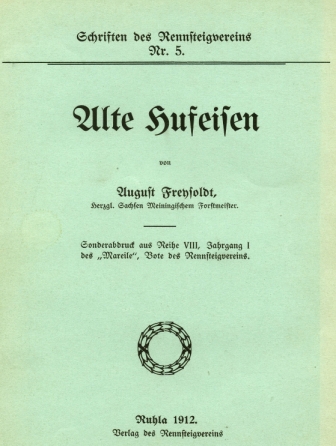
Diese erschien als Fortsetzungsserie im Mareile des Jahres 1912. Die hohe Qualität dieses Aufsatzes dokumentiert sich darin, dass der Rennsteigverein die Abhandlung in der Nr. 5 seiner wissenschaftlichen Schriftenreihe aufnahm. Die Arbeit war eine Fleißarbeit, da sie ohnehin ein Randgebiet der wissenschaftlichen Heimatforschung berührte, für das nicht gerade reich gesegnete Forschungsquellen vorhanden waren.
Freysoldt beabsichtigte mit den angeführten Untersuchungen über das Alter von Hufeisenfunden in der Rennsteigregion, Rückschlüsse auf das Alter und die ehemalige Bedeutung des Höhenweges ziehen zu können. Natürlich kann man nicht anhand von Einzelfunden sofort auf das Alter des Weges schließen, schon gar nicht Rückschlüsse auf seine ehemalige Bedeutung ziehen. Die Summe der Funde, die Vergleichbarkeit und die Zuordnung zu bestimmten Epochen zeichnen diese Forschungsarbeit aus. Erst dann gewinnt man gesicherte Ergebnisse, die wiederum aber nur einen kleinen Teil der Rennsteigforschung ausmachen. Alleine aus den Hufeisenfunden kann man nicht die Bedeutung des Weges ableiten, wohl aber den Zeitraum der erstmaligen Nutzung des Rennsteiges eingrenzen - und das war es, was Freysoldt erreichen wollte. Auch nach seinen Untersuchungen wird klar, der Rennsteig ist mit großer Sicherheit älter, als seine erste urkundliche Erwähnung im Kaufbrief vom 10. August 1330.
Freysoldts schöpferische Energie hatte sich bei den Fachleuten herumgesprochen. So verwundert es auch nicht, dass er 1912 nach Sonneberg übersiedelte und ihm hier die Leitung der Oberförsterei und der Forstschule am Eichberghof übertragen wurde. Hier arbeitete Freysold bis zu seiner Pensionierung 1925.

Sonneberger Forstamt
Es war eine Zeit, in der er durch seine Arbeit in Forstamt und Schule stark gefordert wurde. Trotzdem hielt er immer seinen Kollegen aus der Vereinigung der Altertumsfreunde die Treue. Seine Vorträge in dieser Zeit waren gut besucht und hatten durchweg gute Kritiken.
Im Nachruf auf Freysoldt wird ausdrücklich auf seinen positiven Einfluss in der Vereinigung hingewiesen.[16]
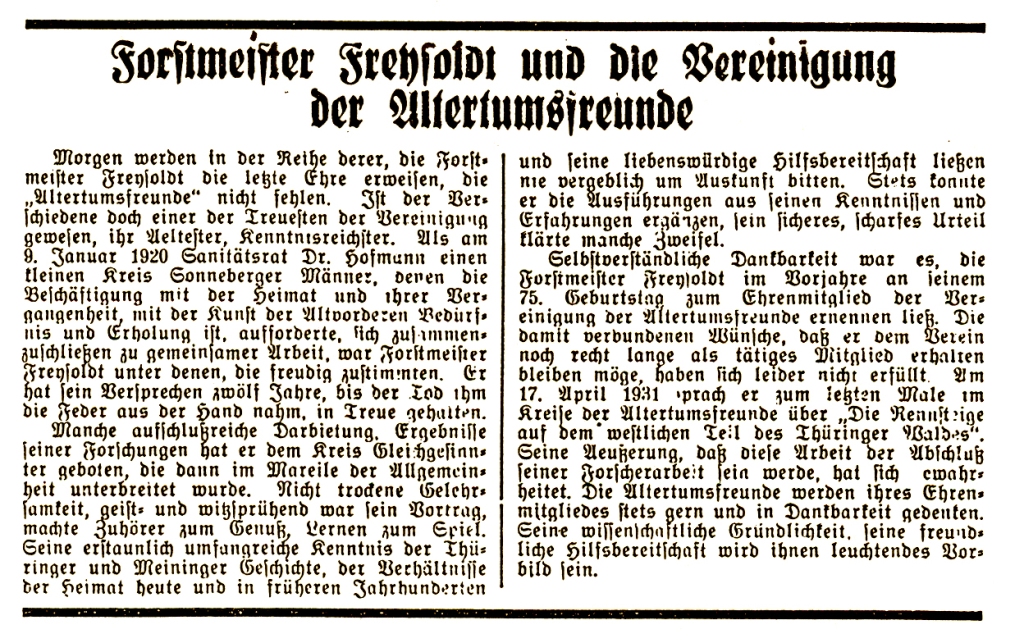
Nach seiner Pensionierung fand Freysoldt die Zeit, auch im Mareile wieder aktiv zu werden.
Am 10.Mai 1924 erscheint in der Beilage zur Sonneberger Zeitung von einem Mitstreiter Freysoldts im Rennsteigverein, Max Kroebel aus Suhl, ein Artikel über die Grenzen des Gefellwaldes und des Heidewaldes und dessen Rennsteiges im Jahre 1162.
Kroebel, als streitbarer Zeitgenosse im Rennsteigverein bestens bekannt, setzte sich ebenfalls seit geraumer Zeit mit der Rennsteigfrage auseinander. Bemerkenswert sind seine Forschungen zur Geschichte des mittleren Renn-steiges. Kroebel war ein Verfechter der Grenzgraben- und Scheidewegtheorie.
Freysoldts Artikel Die Rennsteigurkunde von 1162[17] vom März 1930, setzte sich kritisch mit der Auffassung von Kroebel auseinander. Es ging um eine unterschiedliche Interpretation der Urkunde aus dem Jahre 1162 zwischen dem Abt von Banz und dem Grafen Wolfeswac. Strittig zwischen Kroebel und Freysoldt war der Verlauf der Grenze dieser Jagdgründe. Freysoldts kritischer Beitrag folgte im Mareile, nachdem Kroebel seinen Aufsatz von 1924 im Januar 1930 nochmals im Mareile veröffentlichte.
Noch zweimal veröffentlicht Freysoldt im Mareile, dem Boten des Rennsteigvereins, Arbeiten über seine Forschungen zur Rennsteigregion. Vom Januar bis Mai 1931 erscheint sein hochinteressanter Beitrag über den Wald der Ortlande in Franken und seine nördliche Grenze.
Unverkennbar in diesem Beitrag ist die enge Verbindung zu seinen Ausführungen über die Fränkischen Wälder. Hier schildert er die Situation der Wälder in den nördlichen Gebieten der ehemaligen Ämter Sonneberg und Eisfeld, welche in der damaligen Zeit auch als Ortlande bezeichnet werden.[18]
Sein letzter Artikel über die Jagdrennsteige auf dem westlichen Teil des Thüringerwaldes erscheint im September 1931. Auch hier stellt Freysoldt wieder die Verbindung des Rennsteiges zu einer alten historischen Jagdgrenze her.[19] Noch vor der Drucklegung dieses Artikels im Mareile referierte Freysoldt zu diesem Thema am 17. April 1931 letztmalig vor seinen Freunden der Altertumsvereinigung.
Mit ihm hat Sonneberg einen großartigen, nimmermüden Heimatforscher verloren. Nur Wenigen wurde bereits seit Lebzeiten ein Denkmal gesetzt. Freysoldt gehörte zu diesen Wenigen.
Mit wem er Freundschaft geschlossen, dem war er Freund in allen Le-benslagen. Er war einer von altem Schrot und Korn, der das Herz auf dem richtigen Fleck hatte, der sein Vaterland über alles liebte und schwer unter dessen Niedergang litt. Wir aber können stolz sein, dass er einer der unsrigen war. Sein Lebensgang und sein Wirken sollen uns Jüngeren Ansporn sein. Die Segnungen, die von seiner Persönlichkeit ausstrahlen, mögen uns Kraft geben zu unserem Tun. Freysoldt aber möge in Frieden ruhen und der Wald sein ewiges Lied über seine Grabstätte rauschen.[20]

Zeichnung des Gösselsdorfer Forsthauses aus dem Jahre 1946. Hier arbeitete er von 1891
bis März 1901 als Forstassessor (Bild: archiv - rueger, Repro)
Nachweise, Quellen
[1] Nach einer Karte bearbeitet vom Vermessungsdienst Thüringen. 153. Druck: K 134. VEB Geogr. Kartogr. Anstalt Gotha 3000. Maßatab 1: 10000.
[2] Mareile, Bote des Rennsteigvereins. 1. Jahrgang. Nr. 7 vom 01.12.1898. Bekanntmachungen.
[3] Wie vor. Nr. 10 vom 10.05.1899. Seite 4-8 und Nr. 11 vom 01.07.1899. Seite 4-6.
[4] Thüringisches Staatsarchiv Rudolstadt.
A VIII,2c,No.29. Amtsbuch von 1545.
[5] Mareile, Bote des Rennsteigvereins. 2. Reihe. Nr. 1 vom 25.02.1900. Seite 5-6.
[6] Schriften des Vereins für Sachsen-Meiningische Geschichte und Landeskunde. 1901. Heft Nr. 38. Seite 3-26.
[7] Mareile, Bote des Rennsteigvereins. 3. Reihe. Nr. 10 vom 01.09.1903. Seite 116.
[8] Ulrich Rüger: Die historischen Grenzsteine des Rennsteiges in der Neuhäuser Region. Erfurt 2003. Schriftenreihe des Thüringer Landesvermessungs-amtes Erfurt. Nr. 2.
[9] Ulrich Rüger: Felderfassung aller historischen Grenzsteine des Thüringer Rennsteiges. Handschrift. Teil 3: Saarzipfel bis Hohe Heide.
[10] Mareile, Bote des Rennsteigvereins. 5. Reihe. Nr. 1 vom 01.01.1906. Seite 1-9.
[11] Wie vor: 5. Reihe. Nr. 2 vom 01.03.1906. Seite 33-34.
[12] Wie vor: Seite 31-33.
[13] Wie vor: 5. Reihe. Nr. 8 vom 01.03.1907. Seite 116-118.
[14] Wie vor: 5. Reihe. Nr. 11 vom 01.09.1907. Seite 151-161.
[15] Schriften des Rennsteigvereins. Nr. 5. Ruhla 1912. (auch als Fortsetzungsbeitrag im Mareile von 1912 erschienen).
[16] Sonneberger Zeitung vom 11.03.1932. Beilage.
[17] Mareile, Bote des Rennsteigvereins. 15. Reihe. 2. Jahrgang. Nr. 2 vom 01.03.1930. Seite 86-92.
[18] Wie vor: 16. Reihe. 1. Jahrgang. Nr. 1-Nr.3 von Januar –Mai 1931.
[19] Wie vor: 16. Reihe. 1. Jahrgang. Nr. 5 vom 01.09.1931. Seite 81-88.
[20] Mareile, Bote des Rennsteigvereins. 16. Reihe. 2. Jahrgang. Nr. 3 vom 01.05.1932. Seite 27-28. Nachwort von Julius Kober.
Gustav Freytag
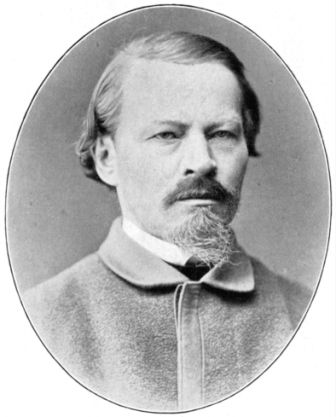
Am 13.07.1816 wird Gustav Freytag in Kreuzburg (Schlesien) geboren.
Von 1817 bis 1818 wohnt er in Pitschen
Seit Ostern 1829 wohnt Gustav Freytag bei seinem Onkel Karl Freytag in Oels, um das dortige Gymnasium zu besuchen.
Am 30.05. 1835 besteht er sein Abitur in Oels.
Von April 1835 bis Okt.1836, das heißt Sommersemester 1835 bis Sommersemester 1836 studiert er Philologie in Breslau.
Seine Lehrer in Breslau sind u. a.: Hoffmann von Fallersleben (mittelhochdeutsch), Schneider (grammatische Interpretationen), Ambrosch (römisch antiquarische Vorlesungen).
Gustav Freytag tritt in das Studentenkorps der Borussen ein. Obwohl Schlesier, fühlte er sich immer zu Preußen hingezogen.
Ab dem Wintersemester 1836/37 studiert Freytag in Berlin. Seine Lehrer in Berlin sind u.a.: Böckh, Bopp, v. Hagen und Lachmann
Erste dramatische Versuche mit: "Der Hussit" (1837), "Die Sühne der Falkensteiner" (1838), beide nicht aufgeführt und auch nicht erschienen.
Am 30.06.1838 promoviert Freytag mit seiner Dissertation: "De initiis scenicae poesis apud Germanos."
In seiner Promotion versuchte Freytag die Anfänge des deutschen Dramas in den Veranstaltungen bei den urgermanischen Johannis- und Erntefesten zu finden, und seine Ausführungen gipfeln in dem Satze: 'das deutsche Drama habe sich aus einer frühzeitigen Verschmelzung der altheidnischen Volksgebräuche und der christlichen Kirchenbräuche entwickelt, sein Ursprung sei eigen, einheimisch und habe nichts mit der antiken Dichtung zu schaffen.' (Nach Konrad Alberti)
Er schließt Freundschaft mit Adalbert Kuhn, dem späteren Herausgeber der "Zeitschrift für vergleichende Sprachenkunde".
Am 01.05.1839 wird Freytag mit der Arbeit: "De Hrosuitha poetria. Adjecta est comoedia Abraham inscripta in Breslau habilitiert. Die Antrittsvorlesung findet am 1. Mai statt.
Aus dem Schluß der Einleitung der Habilitationsschrift:
"Die toga candida der Römer wurde zerschnitten und zur Mönchskutte umgewandelt. Aber warum über jene heiligen Männer spotten? Das antike Kleid steht ihnen und sie bewegen sich ganz bequem darin, natürlich gehen sie auf ihre eigene Art in demselben und freuen sich, daß sie keine Römer sind. Man erkläre dieses Bild nicht für albern, weil es aus der Schneiderwerkstatt entlehnt ist. Jene Gelehrten, die sich mit den Wissenschaften und der Kunst des Altertums beschäftigen, sind ja in einer Art auch Schneider, indem sie jene idealen Gewänder, in denen der Volksgeist durch die Jahrhunderte schreitet, aus den Ueberbleibseln und Lappen, die uns aufbewahrt sind, mit Fleiß wieder zusammenflicken und für das große Publikum entfalten." (Übersetzung: Alberti)
Ab dem Sommersemester 1839 bis 1844 ist Freytag Dozent in Breslau.
[Freytag] "..betrat nicht selten mit hellen Handschuhen das Katheder, was ihm von seiten der älteren Kollegen Kränkungen genug zuzog." (Alberti)
Engeren Umgang unter Kollegen pflegte er u. a. mit Hoffmann v. Fallersleben und Dr. Geyder. Zusammen sammelten sie Volkslieder, angeregt durch die Brüder Grimm.
1841 Drama: "Die Brautfahrt oder Kunz von der Rosen" (Buchveröffentlichung 1844) Die 'Brautfahrt' erhielt den zweiten Preis für Dramen. (ausgeschrieben von Friedrich Wilhelm II)
Im Herbst 1842 lernt Freytag im Urlaub auf Helgoland die Frau des Grafen Dyhrn, Emilie kennen, die später seine Frau wird.
In Breslau erregten Hoffmann von Fallerslebens "Unpolitische Lieder" großes Aufsehen, was Freytag große Schwierigkeiten bereitete, da diese 'Lieder' politisch bedenklich erschienen und Freytag über sie las:
"Mit klugem Tact suchte Freytag alles zu vermeiden, was ihn in den Wirren auf irgend eine Seite hätte bloßstellen können, er wollte den Gegnern nicht den Triumph gönnen, zwei Vorkämpfer der liberalen Sache auf einmal zu unterdrücken"
Freytag hielt eine Vorlesung über moderne Literatur im Saale der Börse auf dem Blücherplatz: "vor einem ausgewählten Laienpublikum."
'Als nun Hoffmann an die Reihe kam, war er [Freytag] klug genug, vorher beim Polizeipräsidenten Heinke, der zugleich Curator der Universität war, anzufragen, ob er auch über die "Unpolitischen Lieder" sprechen dürfe. "Oh ja", meinte dieser, "wenn Sie sie weiter nicht loben wollen."
Im Jahre 1843 wurde Hoffmann von Fallerslebens aufgrund der 'unpolitischen Lieder' aus seinem Amt entfernt. Freytag schrieb ihm einen Brief mit seinem Hilfsanerbieten, das jedoch ohne Wirkung blieb.
Im Februar 1843 bewirbt sich dann Freytag um die außerordentliche Professur, in der Nachfolge Hoffmann von Fallerslebens, die Stelle erhält jedoch Theodor Jacobi.
1843 Drama: "Die Tscherkessin" (zu Lebzeiten Freytags nicht veröffentlicht).
1844 Drama: "Der Gelehrte" (veröffentlicht im Poetischen Taschenbuch für 1848).
1845 Erste (und zugleich letzte) Versuche als Lyriker: "In Breslau" (Gedichte)
Am 08.09.1845 wird: "Deutsche Geister. Festspiel. Zur Feier der 9. Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe" auf dem Stadttheater von Breslau aufgeführt.
1846 Drama: "Die Valentine" (1847 als Buch erschienen)
"... denn als Plural sollte man den Titel [Valentine] richtig gebrauchen, da er von der Sitte des Valentinstages, nicht vom Namen der Heldin genommen - "
"Bertha Unzelmann (...) führte bei Gelegenheit ihres Gastspiels im Mai 1847 auch das Stück zuerst in Berlin ein. Mit ihr, Hendrichs (Saalfeld) und Döring (Benjamin) erzielte das Stück beim Publikum wie bei der Kritik große Erfolge, selbst Rötscher, der damals das große dramaturgische Wort führte, begrüßte das Stück freundlich..."
Bei der Aufführung des Stückes in Dresden hatte Gutzkow, der damalige Dramaturg des Theaters erhebliche Schwierigkeiten:
"Der Intendant, Herr von Lüttichau, entgegnete ihm, das Stück sei unmoralisch, Prinz Johann sei gewöhnt, seine Kinder ins Theater zu schicken, und ein derartiges Gebahren eines Hoffräuleins sei nichts für die Augen junger Prinzen."
Die Valentine wurde auch ins Norwegische übersetzt und im Theater Christiania unter Ibsens Leitung aufgeführt.
Angeregt durch seine Beziehungen zu Lachmann und den Arbeiten der Brüder Grimm, plante Freytag eine Vorlesung über Kulturgeschichte:
"Da geschah ein Unerwartetes, eine Art Gewaltstreich, wie ihn nur das verknöcherte Professorenthum eines Stenzel und Consorten führen konnte: auf Antrag des genannten, der damals Dekan der philosophischen Facultät war, wurde ihm das Lesen dieses Collegs untersagt."
Freytag verließ nach diesem Verbot seines Kollegs die Universität und ging 1846 nach Leipzig, um sich mit dem Theaterwesen vertraut zu machen.
1847 zieht Freytag nach Dresden.
Die Gräfin Dyhrn (inzwischen geschieden) folgte ihm nach Dresden. Freytag bekam Kontakt mit Ludwig Tieck und Eduard Devrient, der 'zugleich Schauspieler, dramatischer Lehrer, Theaterdichter und Theaterhistoriker' war. Zu seinem Dresdener Freundeskreis gehörten noch Julius Fröbel und Arnold Ruge.
Im Herbst 1847 heiratet Gustav Freytag Emilie Scholz, geschiedene Gräfin Dyhrn.
1847 Drama: "Graf Waldemar", das zuerst Aktweise in den Grenzboten" veröffentlicht wurde.
1848 Umzug nach Leipzig
1848 Bekanntschaft mit Julian Schmidt
Julian Schmidt, war "... dem großen Publikum besonders als eifriger Mitarbeiter der 'Nationalzeitung' und der 'Preuß. Jahrbücher' bekannt," "Durch Ruges Vermittlung waren die beiden [Freytag und Schmidt] zusammengekommen."
Am 01.07.1848 übernehmen Julian Schmidt und Gustav Freytag die Zeitschrift "Grenzboten". Die Grenzboten waren eine österreichische, von Ignaz Kuranda gegründete, politische Zeitschrift, die 1849 in Österreich verboten wurde. Mitarbeiter der Grenzboten waren:
"...da war Dr. Moritz Busch, heut aller Welt bekannt durch seine intimen Mittheilungen über den Reichskanzler Fürsten Bismarck und seine meisterhaften Arbeiten zur Geschichte des deutschen Volkshumors, ferner Max Jordan, gegenwärtig Direktor der Nationalgalerie in Berlin, Professor Alfred Dove in Breslau, J. Eckhardt, später Redacteur des 'Hamburg. Corresp.', Karl Mathy, der damals noch ganz auf liberalem Boden stehende Heinrich v. Treitschke u.am. Die eigenartigste Figur bildet jedoch Jakob Kaufmann, der Freytag auch persönlich sehr nahe gestanden hat. Er war ein wunderlicher Heiliger, von Geburt Jude, eine durchaus ideal angelegte Natur, ruhelos, von nicht gasnz fester Gesundheit,...er ging hinüber nach London, um an Max Schlesingers Seite für die 'Autographierte Correspondenz' zu wirken, einem ausschließlich für Redactionen bestimmten Blatte, welches den deutschen Zeitungen die Londoner Ereignisse und Stimmungen in wahrheitsgetreuer Darstellung übermitteln sollte. So vergingen sechzehn Jahre. Als Freytag im Jahre 1867 in Soden von dem Sterbelager eines nahen Verwandten hinaus ins Freie trat, fühlte er sich am plötzlich am Rockzipfel gefaßt. Er wandte sich um, Kaufmann stand vor ihm. 'Das war sein liebes treues Gesicht, das gutherzige Lächeln, das dunkle Haar so voll und lockig wie sonst, aber über den faltigen Zügen lag der graue Schatten, welchem die Nacht folgt.'" [Alberti]
1848 Tod des Vaters
1848 "Dramatische Werke" 2 Bde.
1850 "Graf Waldemar" (als Buch erschienen)
Am 02.07.1851 kauft Gustav Freytag "die gute Schmiede", ein Landhaus in Siebleben.
1852 Lustspiel: "Die Journalisten" (Buchveröffentlichung 1854.
Erstaufführung der 'Journalisten' in Breslau am 8. 12. 1852:
"Es ist keine Uebertreibung, wenn ich sage, daß die damalige Breslauer Aufführung des Freytag'schen Stückes die vorzüglichste in Deutschland war und daß ich ihr auch in gleicher Vorzüglichkeit niemals wieder begegnet bin. Es war, als hätte ein glücklicher Zufall gerade diejenigen Schauspieler hier zusammengeführt, die für die Verkörperung sämmtlicher Gestalten in den 'Journalisten' die geeignetste Individualität besessen. Es war nämlich der Direction gelungen, den früheren Liebling des Schauspiels, Wilhelm Baumeister" - einen der genialsten deutschen Schauspieler, heut eine Zierde und Säule der Wiener Burg - "aus Hamburg wieder nach Breslau zu locken und ihn durch ein mehrjähriges Engagement zu fesseln. Sein 'Conrad Bolz' ist niemals übertroffen worden, und selbst Emil Devrient stand ihm in dieser Rolle weit nach." (Max Kurnick, 'Ein Menschenalter Theatererinnerungen' S. 63)
Freytag schließt Bekanntschaft und lebenslange Freundschaft mit Herzog Ernst II. von Sachsen Coburg und Gotha.
1855 erscheint Freytags erfolgreichster Roman: "Soll und Haben":
"Zahlreiche Uebersetzungen desselben in fremde Sprachen liegen vor. 1857 erschienen in England gleichzeitig drei derselben, von diesen nur eine, die gelungenste, mit Autorisation des Verfassers, die zweite mit einer Vorrede von J. Bunsen, die dritte und schlechteste sonderbarerweise angekündigt als 'a sort of German Uncle Toms Cabin'. Etwas besseres glaubte der Uebersetzer zur Empfehlung des Werkes nicht vorbringen zu können, als es ein Seitenstück des zu einem der plattesten und langweiligsten aller Tendenzromane zu nennen, mit denen je die Welt überschwemmt worden ist!" "In demselben Jahre erschien auch u. v. a. auch eine russische Uebersetzung in den Heften der Otetschestwennyja Sapiski."
1855 Tod der Mutter
21.10.1858 stirbt sein Bruders Reinhold.
Im Jahre 1861 scheidet Julian Schmidt bei den Grenzboten aus und geht nach Berlin.
|
1858 erscheinen seine "Dramatische Werke" (vermehrte Neuauflage). |
|
|
1859 erscheinen seine kulturhistorischen Schriften: "Bilder aus der deutschen Vergangenheit (2 Teile - 16. u. 17. Jh.) |
|
|
1859 Trauerspiel: "Die Fabier" |
|
|
1862 erscheinen seine kulturhistorischen Schriften: "Neue Bilder aus dem Leben des deutschen Volkes" (18. u. 19. Jh.) |
|
|
1863 erscheint "Die Technik des Dramas" (Von Dilthey positiv rezensiert, dient die 'Technik' heute noch als Vorlage für Dramentheorien, besonders in Schulbüchern und Lexika, meist ohne auf die Urheberschaft Freytag zu verweisen) |
|
|
1864 Roman: "Die verlorene Handschrift" |
|
|
1866 Politische Broschüre: "Was wird aus Sachsen" (anonym). |
|
|
1866 Kulturhistorische Schrift: "Aus dem Mittelalter" |
|
|
1867 Die Neuauflage: "Bilder aus der deutschen Vergangenheit" in 5 Bänden erschienen. |
Ende Febr. 1867 - Mitte April 1867 ist Freytag als Abgeordneter im konstituierenden Reichstag in Berlin.
Vom 01.08.1870 bis zum 10.09.1870 begleitete Freytag seinen Freund, den Kronprinzen von Preußen, als Kriegsberichterstatter im Kriege 1870/71 gegen Frankreich.
"Am 30. August, nach der Schlacht von Beaumont vermißte man Freytag plötzlich im Hauptquartier. Wo man auch suchte und Erkundigungen einzog, er war nirgends zu entdecken. Man gab sich bereits ernsten Besorgnissen hin, man befürchtete, daß ihn jenes Schicksal ereilt haben könne, welches einem andern deutschen Schriftsteller Th. Fontane, später wirklich wurde, denn Freytag pflegte sich auf seinem leichten, einspännigen offenen Wägelchen bis weit hinaus zu den äußersten Vorposten zu wagen. (Die Behauptung in den Briefen Auerbachs, er habe nie mit den gemeinen Soldaten verkehrt, ist ganz unrichtig) Endlich nach 36 Stunden fand man ihn bei Stonne, wo kurz vorher Napoleon campirte wieder. Er hatte mit dem Regimente der 58er bivouakirt, das ihn natürlich begeistert aufgenommen hatte. Er war ganz enthusiasmirt von den Eindrücken, die er empfangen, konnte den Heldenmuth der Soldaten nicht genug rühmen und rief einmal über das andere aus: 'Das sind die modernen Spartaner.'"
1870 erscheint die Biographie über seinen Freund: "Karl Mathy. Geschichte seines Lebens"
Am 31.12.1870 scheidet Freytag bei den "Grenzboten" aus. An Holtzendorff schrieb Freytag am 10. Oktober 1870:
"Die 'Grenzboten' und ich trennen uns. Ich verliere das Blatt. Habe dem Verleger für seine Hälfte vergebens 13200 Reichstaler geboten. Er hat mit 13300 Jordan und mich überboten. Höre auf, in den 'Grünen' Tugend zu predigen. [...] ich werde mich fortan anders zu dem Blatte stellen, in das ich schreibe. Von den 'Grünen' muß ich scheiden [...]". (STO, S. 301, Anm. 116.)
Am 01. 01. 1871 erscheint die Zeitschrift "Im neuen Reich", herausgegeben von Freytags Freund und Verleger Salomon Hirzel, praktisch als 'Ersatz' für die verlorenen 'Grenzboten'.
Von 1872 bis 1880 erscheint Freytags historischer Romanzyklus "Die Ahnen":
|
1872 "Ingo und Ingraban" |
|
|
1873 "Das Nest der Zaunkönige" |
|
|
1874 "Die Brüder vom deutschen Hauses" |
|
|
1876 "Marcus König" |
|
|
1878 "Die Geschwister" |
|
|
1880 "Aus einer kleinen Stadt" |
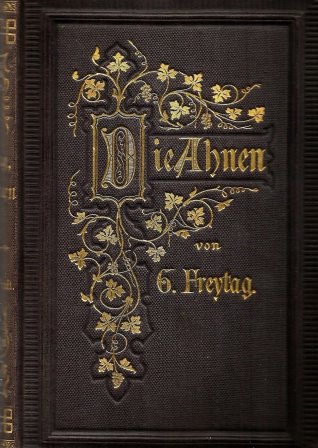
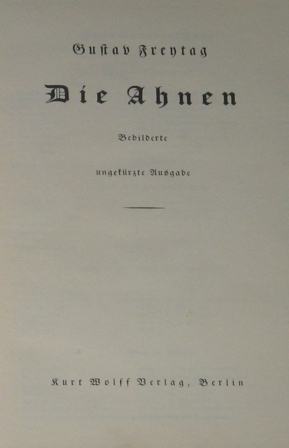
Am 13. Oktober 1875 stirbt seine Frau Emilie und Freytag schreibt an seinen Freund Salomon Hirzel:
"Lieber Freund.
Meine Frau ist gestern Mittag von mir geschieden. Ihr Ende war mild u. ohne Schmerzen. Das ist das Manuskript, welches ich Ihnen sende. Der Roman, den ich seit meiner Jugend geschrieben ist aus, und ich lege müde die Feder hin ..."
(Hirzel II, S. 249)
- 16. 08. 1876 Geburt seines Sohnes Gustav Willibald in Heddernheim bei Frankfurt
ab Dez. 1876 wohnt Freytag in Wiesbaden im Hotel zur Rose.
- 08. 02. 1877 Tod seines Verlegers und Freundes Salomon Hirzel.
1877 Geburt seines Sohnes Waldemar (wahrscheinlich im Herbst).
Am 22. 02. 1879 heiratet Gustav Freytag Marie Kunigunde Dietrich (geboren am 02. 11. 1846 in Birkenfeld, gestorben am 04. 03. 1896). Die Hochzeit fand wahrscheinlich in Siebleben statt. Erst in einem Brief vom 14. 04. 1879 teilt er Heinrich Hirzel (Sohn Salomon Hirzels) mit, daß er geheiratet hat:
"Lieber Heinrich. Es geschah sehr gegen meinen Willen, daß Sie und die lieben Ihrigen durch Gerücht u. Zeitungsklatsch Nachricht von meiner Verheirathung erhielten, bevor ich selbst diese Ihnen mitzutheilen in der Lage war."
Im Jahre 1881 kauft Freytag ein Haus in Wiesbaden.
Am 19. 01. 1884 stirbt sein Sohn Waldemar.
Am 18. 05. 1884 wird seine Frau, Marie Kunigunde in eine Nervenklinik eingeliefert.
Seit 1884 Bekanntschaft mit Anna Strakosch.
Von 1886 bis 1888 gibt Freytag seine "Gesammelten Werke" (22 Bde., Hirzel) heraus
Am 27. 03. 1886 stirbt sein Freundes Julian Schmidt.
1887 "Erinnerungen aus meinem Leben" mit einer Widmung an Anna Strakosch (Separatdurck des 1. Bandes der Gesammelten Werke) erscheinen.
Am 15. 06. 1888 stirbt sein Freund Kaiser Friedrich.
Am 30. 06. 1888 50jähriges "Doktorjubiläum" Freytags.
1888 "Gesammelte Aufsätze" (Separatdruck der Bände 15 und 16 der Gesammelten Werke)
1889 "Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone"
- 29. 09. 1890 Scheidung von Marie Kunigunde Dietrich.
- 13. 10. 1890 "Sühnetermin" zwischen den Eheleuten Alexander und Anna Strakosch.
- 26. 11. 1890 Scheidung der Eheleute Strakosch.
Am 10. 03. 1891 heiratet Gustav Freytag Anna Strakosch (geboren am 09. 04. 1852, gestorben 1911). Hochzeitsreise im April 1891 nach Nizza (Hotel des Anglais) und die oberitalienischen Seen.
Am 21. 05. 1893 erscheint Freytags Aufsatz: "Ueber den Antisemitismus, Eine Pfingstbetrachtung", in der 'Neuen Freien Presse' (Wien); im gleichen Jahr wird er als Broschüre vom Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens herausgegeben.
Am 30. 04. 1895 stirbt Gustav Freytag in Wiesbaden, Überführung nach Siebleben.
Gasthöfe
Zum Falken, Kahlert
Anfang März 2016 begann man mit den Abbrucharbeiten am Gasthof "Zum Falken" in Kahlert.

2010

März 2016, Foto: Uwe Albrecht, Kahlert
Die Geschichte des Gasthofes und der Brauerei begann im Jahre 1727:
Am 24. Mai erhält der Wirt zu Crock, Christoph Kahlert, die Gastungs- und Braugerechtigkeit auf ein zwischen Gießübel und Neustadt an der Landstraße zu erbauendes Wohnhaus.
In der Konzessionsurkunde heißt es:
Dem Gesuchsteller soll zu seinem Vorhaben, einen Gasthof an der Straße bei der Schwarzburger Grenze zu errichten, ein geeigneter Platz zugemessen und versteinet und ihm auch ein öffentliches Schild mit dem Zeichen und Namen eines Falken auszuhängen genehmigt sein, desgleichen auch ein Malz- und Brauhaus dabei zu bauen, darin gesundes und tüchtiges Bier zu brauen und solches allda zu verzapfen oder maß- und faßweise an ausländische Orte zu geben.
Weiterhin wird festgelegt, dass diese Konzession weder zum Zechen noch Saufen, besonders auf Sonn- und Festtagen zu brauchen ist, woraus Fluchen, Zank und Schlägerei zu entstehen pflegen. (Quelle: Thüringisches Staatsarchiv Meiningen, Kreis Hildburghausen. 19, 706.)
Für die am 24. Mai erteilte Konzession waren 50 Gulden, an jährlichen Erbzins 6 Gulden und zu einem Steuertermin 1 Gulden zu entrichten. Von allen anderen Beschwerden und Anlagen sollte das Gasthaus befreiet sein.
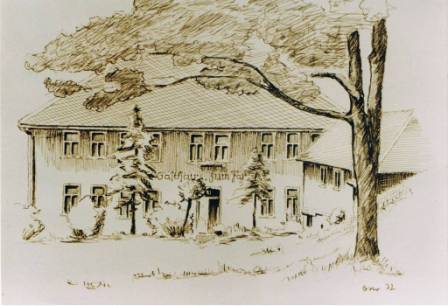
1765: Kahlert verkaufte den Gasthof einschließlich der Braurechte an die Vorfahren der Familie Heinz.
1776: Am Wirtshaus "Zum Falken" führte damals die viel befahrene "Hohe Straße" vorbei. Da das Wirtshaus gleichzeitig als Ausspanne genutzt werden konnte, wurde hier eine Poststation eingerichtet.
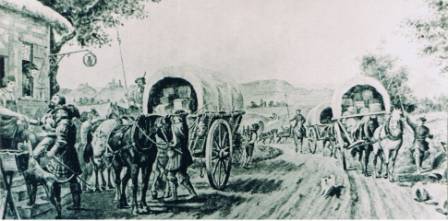
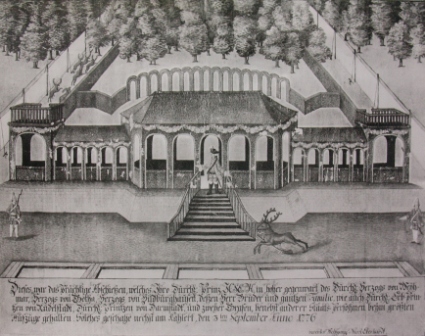
3. September 1776
1776: Prinz Joseph von Sachsen-Hildburghausen führte in der Nähe des Wirtshauses ein "Abschießen" von Rotwild durch. Der Chronist schreibt dazu (s. Bild oben):Dieses war das prächtige Abschießen, welches Ihro Durchl. Prinz JOSEPH in hoher gegenwart des Durchl. Herzogs von Weyhmar, Herzogs von Gotha, Herzogs von Hildburghausen, deßen Bruder und gantzen Familie, wie auch Durchl. Erb-Printzen von Rudolstadt, Durchl. Printzen von Darmstadt und zweyer Grafen benebst anderer Staats-Persohnen beym größten Aufzuge gehalten. Solches geschahe nechst am Kahlert, den 3ten September Anno 1776.
1788: Waldarbeiter siedelten sich rund um das Wirtshaus an. Der kleine Ort Kahlert entstand auf der Sachsen-Meiningischen Seite, hier direkt an der Landesgrenze zu Schwarzburg.
1810: In einem Bericht des Amtsverwalters Habermann über den Stand des Braugewerbes im Amte Eisfeld im Herbst steht: Kahlert: Die Brau- und Schenkgerechtigkeit gehört dem Gasthof zum Falken. Posthalter Lutz hat niemals gutes Bier gehabt. Das Hauptgeschäft der Fam. Lutz war auch nicht die Bierproduktion, sondern die Posthalterei. Zeitweise unterhielt sie bis zu 20 Pferde, die für Vorspanndienste eingesetzt wurden, in der Hauptsache für den Postkutschenverkehr.
In Kahlert auf der Kreuzung stand damals eine sächsische Postmeilensäule, die leider nicht mehr vorhanden ist.
1820: Familie Heinz, die nun schon in der 4. Generation Besitzer von Brauerei und Gasthof war, übernahm die Posthalterstation von Fam. Lutz.
1868: Richard Heinz wurde erster Bierbrauer und Büttner in Kahlert.
1896: Der Gasthof "Zum Falken" wurde Opfer eines Feuers. Es war damals die drittälteste Gaststätte Neustadts. In den Folgejahren wurden umfangreiche Rekonstruktionsmaßnahmen am Gebäudebestand durchgeführt.
1897: Der Gasthof wurde in seinem heutigen Aussehen aufgebaut und durch einen Tanzsaal ergänzt.
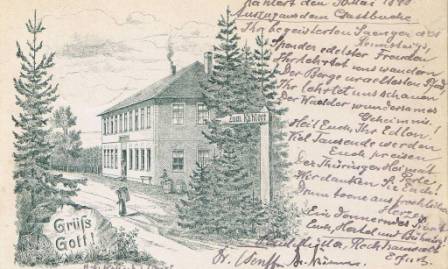
1898, Hertel und Bühring zu Gast im "Falken"
1906: Der Falke wurde ein beliebtes Ausflugslokal. Kahlert erhält Telefonanschluss.

um 1912


1946: Die Brauerei nimmt nach dem 2. Weltkrieg die Produktion wieder auf. Eine neue, moderne Kühlanlage wurde gebaut.


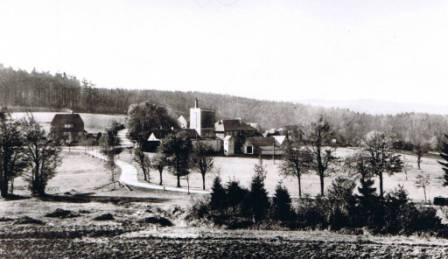

1957: Rekonstruktion der Brauerei in Kahlert. Das Bier wurde nun trchnisch gekühlt.
1962: Durch vorangegangene Rekonstruktionsmaßnahmen war es nun möglich, jährlich bis zu 6000hl Bier zu brauen.
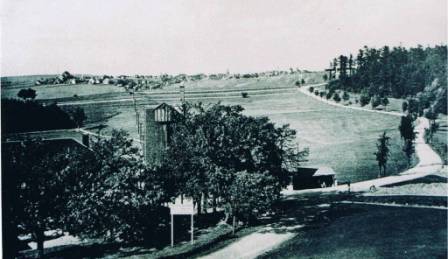
1970: Die Flaschenabfüllung der Brauerei wurde rekonstruiert und am 21. Juni in Betrieb genommen. Durch die Zwangskollektivierung ging der Betrieb im Getränkekombinat des Bezirkes Suhl auf und wurde der Schmiedefelder Brauerei zugeordnet. Das hatte die Einstellung der Bierproduktion in Kahlert zur Folge. Das Bier, welches nun in Schmiedefeld gebraut wurde, fuhr man mit Tankwagen nach Kahlert in die Abfüllanlage.

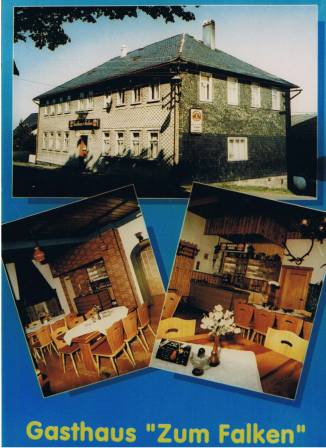
1977: Die Brauerei wird Teil des VEB Getränkekombinat Meiningen. Die 250-Jahr-Feier wurde begangen, ein Produktionsausstoss von 10.000hl Bier wurde erreicht.
1981: Am 31. Januar wurde die Flaschenbierabfüllung in Kahlert eingestellt.
1986: Die Brauerei Kahlert schließt am 15. Februar. Zuletzt haben hier noch 7 Personen gearbeitet.
Nach der Wiedervereinigung konnte der Besitzer Horst Heinz sein Markenbier "Falkenbräu" nach altem Rezept bei einer auswärtigen Brauerei weiterbrauen lassen. Der Vertrieb erfolgte über einen eigenen Getränkehandel mit Laden-geschäft im umgebauten Brauhaus. 1998 wurde der Kühlturm zurückgebaut.
Mit dem Abriss endet die Geschichte eines beliebten Gasthauses am Rennsteig.


2010
Germar, Bruno von
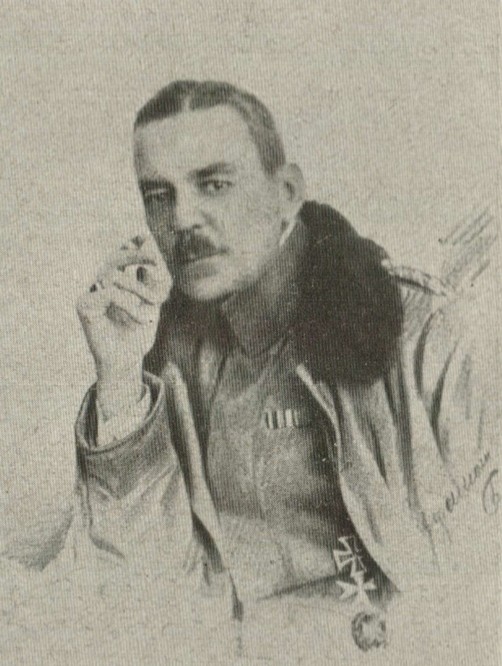

(Mareile, Bote des Rennsteigvereins, 12. Reihe, IV.JG., Nr. 2, nach Seite 128, 1824.)
Was der Rennsteig mir war, können Sie sich wohl denken. Er war mir Erlösung von aller Arbeit… Pfingstmorgen, Buchenwald, Thüringen, Frohsinn und alle Menschen verstehen, das hat mich dem Rennsteigverein schätzen gelehrt.
(Mareile, Bote des Rennsteigvereins, 12. Reihe, IV. Jg., Nr.1, 1924, Seite 112.)
Am 02. Januar vor 100 Jahren starb Bruno von Germar an den Folgen einer schweren Kopfverletzung zu Beginn des 1. Weltkrieges.
Germar stammt aus einer militärisch orientierten Adelsfamilie, deren Stammbaum sich in Nordthüringen bis in das Jahr 1130 zurückverfolgen lässt.
Hier einige Eckdaten aus seinem Leben:
- Bruno von Germar wird am 19. November 1873 in Dessau geboren
- Eine militärische Ausbildung als Kadett erfuhr er in Potsdam und Lichterfelde
- Soldat der preußischen Armee
- Liebe zur Natur, Wald und Jagd
- Dichterische Begabung
- Seit dem 09.09.1905 Mitglied im Rennsteigverein (Nr. 306)
- 1909 unternahm er eine komplette Runst von Hörschel nach Blankenstein. Im Laufe seines weiteren Lebens nahm er als Runstbegleitung an zahlreichen Runsten teil
- Verletzung (Kopfschuss) am 20.09.1914 bei Paris
- Eisernes Kreuz 1. Klasse
- Nach Erholungsphase, auch am Rennsteig, nochmaliger Fronteinsatz, 1916, 1917, 1918.
- Nach dem Krieg Wohnungswechsel nach Friedichroda
- Beschäftigt beim Grenzschutz 1919/20
- 1922 Umzug nach Wernigerode
- 1922 Teilnahme an der Weihe des Ehrenmals am Glöckner
- 1923 Kuraufenthalt in Wildungen
- Ende 1923 werden die körperlichen Gebrechen durch die Kriegsverletzung immer stärker. Sein Wunsch, den Rennsteig in Ruhla oder in Limbach noch einmal zu sehen, wird durch seinen Tod am 02.01.1924 in Wernigerode nicht mehr erfüllt.
Bruno von Germar veröffentlichte zahlreiche Artikel im Mareile, dem Boten des Rennsteigvereins:
- Ein uralter Grenzstein auf der Pechleite, November 1912.
- Neues vom alten Rennsteig und Hebbel am Rennsteig, Mai 1913.
- Die Lauenhainer Ziegelhütte, Juli 1913.
- Hörschel, Juli 1913.
- Genealogische-Heraldisches vom Rennsteig, September 1913.
- Hund von Wenckheim, November 1913.
- Gegen Nees-für Plänckner, September 1914.
- Hinweise auf das Alter von Neustadt, September 1914.
- Rote Runst, Januar 1915.
- Ludwig Hertel als Jüngling am Rennsteig, März/ Mai 1915.
- Nachruf auf Albert Helms, Januar 1917.
- Rennsteiggedanken, Mai 1917.
- Am Rennsteig vor einem halben Jahrhundert, Januar 1918.
- Oberhof um 1836, Januar 1921.
- Unsere Stiftungsfeier auf dem Inselberg, Juli/ September 1921.
- Eiserne Jugend u.a., Juli/ September 1921.
- Die Weihe unseres Ehrenmales, Juli/ September 1922.
Darüber hinaus verfasste er noch mehrere Schriften, zum Teil im Eigenverlag.
Auch seine Gedichte im Mareile, machten Germar als begnadeten Poeten weit über den Rennsteigverein hinaus bekannt.
Bruno von Germar war im Herzen ein Soldat. Seine Aufenthalte am Rennsteig lenkten ab, von dem was er auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges erlebte. Am Rennsteig konnte er abseits von den schrecklichen Ereignissen des Krieges neue Kraft tanken. So verband er seine miltärische Laufbahn mit seinem Wirken als Naturliebhaber, Dichter und Poet und Geschichtsforscher.
Nach seinem Tode veröffentlichte Prof. Johannes Bühring Germars Abhandlung über den Rennsteig im Reußischen Oberland, der im Mareile, dem Boten des Rennsteigvereins wie folgt erschien:
- Teil: 2.JG. Nr. 1 vom 01.01.1928. Seite 87-90.
- Teil: 2.JG. Nr. 2 vom 01.03.1928. Seite 102-103.
- Teil: 2. JG. Nr. 3 vom 01.05.1928, Seite 133-116.
- Teil: 2. JG. Nr. 4 vom 01.07.1928. Seite 133-137.
Anlässlich der Pfingstrunst des Rennsteigvereins im Jahre 1925, traf man sich am 06. Juni zwischen 13 Uhr bis 13.40 Uhr am Kiesel auf der Pechleite zwischen Friedichshöhe und der Eisfelder Ausspanne, um im Gedenken an Bruno von Germar sein Wirken mit einer eigens angefertigten Gedenkplatte zu ehren. An der Weihe nahmen außer den Pfingstrennern auch Vertreter der Forstverwaltung, Masserberger Bürger, der Thüringerwald Verein und der Kriegerverein teil. Paul Clingestein gedachte dem Freund Bruno von Germar und übergab die Gedenktafel an Forstmeister Spengler. Der Masserberger Pfarrer Dr. Traue legte im Namen der Masserberger Ortsgruppe des Rennsteigvereins einen Kranz mit der Inschrift:
Dem Führer der Lebenden – dem Vorbilde der Nachfahren – Gut Runst allewege!
nieder. Die Dankesrede hielt anschließend Prof. Johannes Bühring. Danach brachten die Kriegsteilnehmer einen letzten Gruß aus:
Ich hatte einen Kameraden
Mit diesem Lied fand die Feierstunde einen würdigen Abschluss.
(auszugsweise: Mareile, Bote des Rennsteigvereins, 13. Reihe, I. Jg., Nr., 1925, Seite 38.)


Bruno von Germar, Bild Kieselstein. Mareile, Bote des Rennsteigvereins: 8. Reihe, I. JG., Nr. 6, 1912, Seite 111

Eigene Fotomontage einer Gabel, die es so nichtgegeben haben kann

2006
Germar befasste sich ebenfalls sehr intensiv mit historischen Fragen in Verbindung mit dem Rennsteig. Seine Nachforschungen zur Bedeutung des Kieselsteines auf der Pechleite sind hierbei besonders interessant, aber auch kritisch zu hinterfragen.
Ausgangspunkt für die Überlegungen von Germar war eine Anfrage von Prof. Johannes Bühring, die er im Mareile zur Diskussion stellte:
Bühring bezeichnete dabei den Kieselstein auf der Pechleite richtigerweise auch als „gewachsenen Stein“.
(Mareile, Bote des Rennsteigvereins, 8. Reihe, I. Jg., Nr. 4, 1912, Seite 76.)
Er lässt aber offen, ob sich am Stein auf der Schwarzburger Seite, eine umgedrehte Gabel befindet, obwohl er das auf Grund seiner Orts- und Fachkenntnisse wissen müsste und schlägt vor, das nachzuprüfen.
Germar hingegen vermutet, dass der Kiesel, ähnlich wie das Possenröder Kreuz, evtl. ein Kreuz sein könnte und kein Grenzstein. Er fotografiert eine Gabel, die er am Kieselstein festgestellt hatte. Um die Gabel besser zu visualisieren, hatte er vorher den Stein gereinigt und die Konturen hervorgehoben.
(Mareile, Bote des Rennsteigvereins, 8. Reihe, I.JG., Nr. 6, 1912, Seite 111.)
Ich vertrete zur Herkunft und Bedeutung folgende Ansicht:
- Bei dem Kieselstein auf der Pechleite handelt es sich eindeutig um einen Grenzstein, als „gewachsener“ Stein, der sogar heute noch Grenzfunktion besitzt. Der Kieselstein steht auf der ehemalig „sächsischen“ Seite des Rennsteiges. Grenze selbst war und ist die Mitte des Weges, die auf die Grenzsteine eingegemessen wurde. Die Nutzung solcher „gewachsenen“ Steine als Grenzzeichen war seit Beginn der Kennzeichnung von Grenzen mit sogenannten „unverweslichen“ Markierungen seit dem späten Mittelalter durchaus üblich und gewollt, da sie dauerhaft waren. Vergleicht man die Grenzaufzeichnungen jener Zeit, ist festzustellen, dass der Anteil an Markierungen von Bäumen oder markanten Bäumen als Grenzpunkte, immer weiter zurückging, da sie zu vielen Einflüssen ausgesetzt waren, die ihre Existenz bedrohten.
- In Vertrag zwischen Sachsen und Schwarzburg, wegen der Grenze und Markung auf dem Thüringer Wald vom 10. Oktober 1548 (Text angepasst) steht:
…Ein Kieslestein an der Strassen uff der herzogischen Seyten …. Von dem Kieselstein die Straß hienunter....
(Staatsarchiv Coburg: LA D 110, Seite 4, 1548.)
Also existierte der Grenzpunkt „Kiesel“ bereits im Jahre 1548. Wenn ich davon ausgehe, dass der Stein bereits vorher schon 15. Jahrhundert zur Bezeichnung der Grenze zwischen Schwarzburg und Sachsen verwendet wurde, dürfte es sich beim Kieselstein auf der Pechleite mit um den ältesten Grenzstein am Rennsteig handeln, der heute noch vorhanden ist.
- Gehen wir weiter in das Jahr 1596. Auch hier wird in einer wichtigen Urkunde über die Markscheidung des Thüringer Waldes zwischen dem Großen Dreiherrenstein und dem Dreiherrenstein Hoher Lach auf den Kieselstein als Grenzpunkt hingewiesen:
…. Ein Kieslestein sächsisch an der Eßfelder Straß…
(Thüringisches Staatsarchiv Rudolstadt: Amt Gehren, Sig. 130, Blatt 8, 1596.)
- Die Nachweise und Erwähnungen des Kieselsteines werden auch in den entsprechenden Urkunden der benachbarten Herrschaften erwähnt und finden sich fasst mit gleichem Wortlaut auch in den Urkunden der nachfolgenden Jahrhunderte wieder.
Bezeichnend ist aber, dass in keiner Urkunde das Vorhandensein einer Gabel erwähnt wird.
Beispielgebend hierfür möchte ich noch die Legende in einer Karte (Schwarzburgische Karte) aus dem Jahre 1795, die im Katasterbereich Saalfeld unter der Nummer: E-8-2776-0-1-1-1795 archiviert wurde, hinweisen:
Auch hier wird unter Bezugnahme zu den Hoheitskennzeichen auf den Grenzsteinen zwischen dem Dreiherrenstein am Saarzipfel und dem Dreiherrenstein Hohe Heide unter der Nummer 58 ein Kieselstein genannt, der keine Wappendarstellung (Gabel) enthält. In der laufenden Nummerierung der Grenzsteine trägt der Kiesel heute noch die Nummer 58 in den Kataster-unterlagen.
Ein letzter Hinweis sei mir gestattet:
Ein Ausschreiben der Herzoglichen Landesregierung vom 13. Februar 1843 betreffend die Sicherstellung der Landesgrenzen und das dabei zu beobachtende Verfahren beschreibt im § 19, Nr.8 für die sächsische Seite das Aussehen neu zusetzender Grenzsteine.
Für die andere Hoheitsseite, in diesem Fall Schwarzburg-Rudolstadt, werden außer der Hoheitsbezeichnung, in diesem Falle S.R. (im Ausschreiben N.N., da es ja allgemein gehalten ist und auch für andere Grenzen gelten soll), keine weiteren Angaben gemacht.
Da der Kiesel ohnehin über Jahrhunderte ohne Hoheitskennzeichnung an der Pechleite stand (nachweisbar bis 1795), gehe ich davon aus, dass auch nie eine Gabel, egal in welcher Form, auf der Schwarzburger Seite eingehauen war. Bereits Bühring konnte es trotz seiner Fachkenntnis nicht eindeutig belegen.
Vergleicht man die Größe der heutigen Tafel am Kieselstein mit der vermeintlichen Gabel von Germar, ist es eigentlich offensichtlich, dass Teile der Gabel heute noch unterhalb der angebrachten Tafel sichtbar sein müssten, was aber nicht der Fall ist.
Deshalb gehe ich unter Bezugnahme meiner vorangehenden Ausführungen davon aus, dass am Kieselstein auf der Pechleite keine offizielle Gabeldarstellung vorhanden war.
Das Foto von Bruno von Germar bleibt dabei unkommentiert, auch das Anbringen einer Gedenktafel an einem Grenzstein, der Grenzfunktion besitzt und somit dem Abmarkungsrecht unterliegt.
Abschließend noch einige Fotos aus der Geschichte des Kieselsteines:
um 1940, Verfasser unbekannt

1958, Günter Weiss

1999
1999

2004

2006
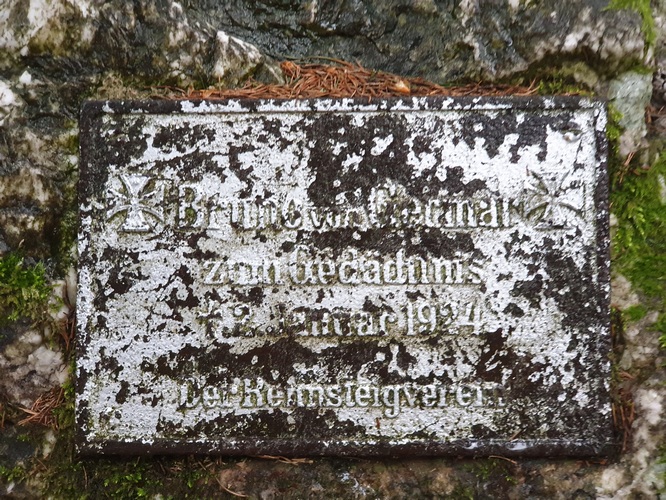
2019

2023: Wahrscheinlich wurde um 2004 die Tafel letzmalig saniert. Aufgrund des Gedenkens zum 100. Todestaf von Bruno von Germar
wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, die Platte noch einmal grundlegend zu sanieren.
Glücksthal, Bernhardsthal
Zur Geschichte der Glashüttensiedlung Glücksthal und der Tafelglashütte Bernhardsthal (unter Verwendung von Forschungen von Dr. Kühnert und eigenen Recherchen) - mit Anmerkungen zur regionalgeschichtlichen Entwicklung
Abschrift mit freundlicher Genehmigung des verstorbenen Ortschronisten Adolf Bräutigam Neuhaus am Rennweg
„Ein Unglück soll es gewesen sein, so in dasiger Gegend ein Insekt die Bäume benagte und vergiftete, dass sie alle abstarben“, schrieb 1781 Kessler von Sprengseysen in seiner Topographie des Herzoglichen Sachsen-Coburg-Meiningischen Antheils am Herzogthum Coburg- und es muß angenommen werden, dass der Borkenkäfer oder ein anderer Forstschädling die Wälder vernichtet hatte.
Die beiden Lauschaer Glasmacher Stephan und Johann Greiner suchten bei der Landesherrschaft in Meiningen um eine Konzession für das Betreiben einer Glashütte nach, die sie „Glücksthal“ nennen wollten.
Das vom Forstschädling übrig gebliebene Holz konnte man für die Glasherstellung verwenden.
Sie erhielten 1737 die Konzession. Man rodete das Land, baute Wohnhäuser, eine Glashütte und Nebengebäude und legte Äcker und Wiesen an. Bei der Be-wohnbarmachung der Glashüttensiedlung „Glücksthal“ stellte man bei der Gründung der Häuser fest, dass dort schon Behausungen gestanden haben müssen, vermutlich eine Schmiede. Auch fand man im Boden Pechreste, vermutlich von einer ehemaligen Pechhütte. In der Nähe der Siedlung fand man Reste von ehemaligen Hammerwerken.
Am 13. August 1738 begann man mit der Glasherstellung. Es wurden u.a. Wein- und Biergläser hergestellt. Das Glas, wird berichtet, soll von guter Qualität gewesen sein, es behielt seinen Glanz und seine Reinheit und wurde nicht blind.
Das Geschäft ging gut, man exportierte die Waren sogar nach Rußland, Spanien und in die Türkei. Solange das Bruchholz reichte, arbeiteten 24 Männer am Ofen, doch schon 1768 ging das Schadholz zu Ende und der Meininger Hof kürzte die Holzzuweisung auf ein Drittel.
Dazu kam, dass in dieser Zeit z.B. in Preußen und Rußland eigene Glashütten gegründet wurden und sich die Hungerjahre 1771 bis 1773 ungünstig auf den Absatz der Gläser auswirkten.
Um 1800 ging die Produktion weiter zurück. Damals lebten 27 Erwachsene und 4 Kinder in der Glashüttensiedlung „Glücksthal“.
Die Nachkommen der beiden Greiners, Johann, Traugott und Schwester Friedericke Schreiter haben 1809 einen Erbvertrag gut zu Ende gebracht, doch die Wirren der Napoleonzeit und der frühe Tod Traugott Greiners beschleunigten den Niedergang.
Noch einmal versuchte die nächste Generation, einen Aufschwung zu erreichen. Man ersuchte den Meininger Herzog Bernhard Erich Freund um Holz und Konzession für eine weitere Hütte „unter dem alten Gründleinsteich“. Die Konzession wurde ab 1829 erteilt und man nannte die Glashütte „Bernhardsthal“. Daneben produzierte man in „Glücksthal“ weiter.
1834 verkaufte Justus Greiner seine Anteile an „Bernhardsthal“, um in „Glücksthal“ rentabler zu produzieren. Er forderte auch die Glücksthaler Holzrechte zurück.
Auch Geschehnisse umrankten die Glashüttengeschichte. So ist aus Aufzeichnungen des damaligen Feldjägers Stier zu erfahren, dass am 14. Juni 1838 in der Tafelglashütte „Bernhardsthal“ eingebrochen wurde und die Diebe mit einer Beute von 900 Gulden das Weite suchten.
Nach ca. 1 Jahr, hier endeten die Aufzeichnungen des Feldjägers Stier, war der Einbruchsdiebstahl noch nicht aufgeklärt. Ob er je aufgeklärt wurde, ist nicht bekannt.
Großes Aufsehen in der ganzen Gegend machte ein Verbrechen im Jahre 1844 in Bernhardsthal, das als „Adamsschlacht“ in die Geschichte einging, weil der Mörder und Selbstmörder Adam Büttner hieß.
Aus einem Brief an den Schullehrer Hugo Walter in Wernshausen, geschrieben von seinem Vater am 06. März 1844, geht u.a. dazu folgendes hervor:
„In kurzer Zeit sind in unserer Gegend mehrere schauderhafte Geschichten vorgefallen. So hat vor einigen Wochen ein lediges Weibsbild von Steinheide ihr neugeborenes Kind umgebracht. Sie sitzt im Gefängnis, ihr Urtheil erwartend.“
Im Vorwort der Moritat heißt es u.a.: „Adam Büttner, gebürtig aus Neundorf bei Schalkau im Herzogthum Sachsen-Meiningen hatte, so viel man weiß, in seiner Kindheit religiösen Schulunterricht genossen, nach seinen Schuljahren sich hier und da mit ökonomischen Arbeiten beschäftigt, bei herangenahten Jünglingsjahren sich unter das Militär begeben und mehreren Feldzügen jener Zeit mit beigewohnt; nach erhaltenen Abschiede vermiethete sich derselbe bei den Herrn Hauptmann Greiner in Glücksthal als Dienstknecht, verheiratete sich nachher und erwarb immer durch Fleiß und Thätigkeit in verschiedenen Arbeiten auf der Glastafelhütte sein dürftiges Auskommen.
Am 27. Februar 1844 morgens gegen ... Uhr, ermordete er in seiner Wohnung zu Bernhardsthal nicht nur allein seine Gattin, von 42 Jahren, welcher er mit dem Beil den Kopf zerspalten, sondern auch seine 4 unmündigen Kinder auf die gleiche Weise, wovon theils mit 2 und theils mit 3 Hiebwunden ganz unkenntlich zugerichtet waren und zögerte nicht, nach vollbrachter schauderhafter That seine schwarze Seele durch sein eigenes Schießgewehr der Welt zu entziehen.
Niemand in dieser Gegend kann auf den Grund der Ursache gelangen.“
Auch heute gibt es grausige Verbrechen, sicherlich mehr als zur damaligen Zeit. Die elektronischen Medien, Zeitungen und die Boulevardpresse verbreiten sie in Windeseile um die ganze Welt.
Moritaten darüber haben sich aus diesem Grund längst überholt. Die Vielzahl der Ereignisse lässt sie auch nur begrenzt in das Bewusstsein der Menschen unserer Zeit eindringen. Die Schnellebigkeit unserer Zeit und die Informationsübersättigung führen dazu, dass viele der Informationen über solche Geschehnisse nur oberflächlich aufgenommen werden.
1845 brannte Bernhardsthal ab. In diesem Jahr starb auch der letzte Hüttenmeister Traugott Christian Greiner, der mit anderen Bewohnern auf dem kleinen Waldfriedhof in Glücksthal beerdigt ist.
Das Ende von „Glücksthal“ und „Bernhardsthal“ kam immer näher. 1860/61 wurden die beiden Glashüttenstandorte geschleift.
2 Häuser aus „Glücksthal“ wurden nachweislich in Wallendorf, heute Lichte, Kreis Saalfeld- Rudolstadt, wieder aufgebaut, darunter das Hüttenmeisterhaus von „Glücksthal“, das noch heute am „Piesau-Viadukt“ steht.
Um 1900 schrieb der Leherer L. Pfeifer aus Rudolstadt einen Artikel mit dem Titel „Rennsteigbilder- Neuhaus und Umgebung“, in dem es u.a. heißt: „Mit welcher Pietät die Bewohner des Waldes Erinnerungsstätten von längst vergangenen Zeiten pflegen, davon zum Schluß einige Beispiele: Zwischen Neuhaus und Lauscha liegt links der Straße auf grüner Bergwiese Glücksthal. Früher befand sich hier eine Glashütte, in der fleißige Arbeiter früh und spät die Hände regten. Nun ist die Hütte verschwunden, die Wohnhäuser sind abgebrochen und anderswo wieder aufgebaut, aber der schlichte Friedhof ist geblieben. Hart am Waldrande grüßt der eingefriedete, von stattlichen Tannen beschattete Platz, wo die ehemaligen Bewohner ihre letzte Ruhe gefunden. Mehr denn dreißig Jahre sind verrauscht im Strome der Zeit, seit der letzte Anlieger fortgezogen, und doch sind die Gräber mit Blumen bepflanzt und wohl erhalten“.
Eine letzte Episode aus der Glashüttengeschichte von „Glücksthal“ ist erst vor wenigen Jahren zu Ende gegangen.
1992 kam Prof. Lechat aus Belgien (1927-2014, Lepraforschung) nach Neuhaus am Rennweg. Er ist ein Nachkomme der Greiners aus Glücksthal. Für die Unterstützung durch den Gastwirt vom Hotel „Oberland“, Herrn Thomas Schmidt, bei der Aufsuche von „Glücksthal“ schickte Prof. Lechat an Herrn Schmidt eine Farbfotografie eines Ölgemäldes, das bei ihm in Brüssel in der Wohnung hängt. Nach seinen Angaben wurde das Ölgemälde, das „Glücksthal“ in seiner Blüte darstellt, in der Familie immer weiter vererbt. Das Ölgemälde gelangte sicherlich im Jahre 1831 von „Glücksthal“ nach Belgien.
Zu dieser Zeit gingen im Gefolge des Prinzen Leopold von Sachsen-Coburg, der durch Heirat auf den belgischen Thron gelangte, einige Söhne und eine Tochter des letzten Glasmeisters von „Glücksthal“ mit nach Belgien. Sie hatten besondere Vertrauensstellungen am Hof. Nachkommen davon hatten später führende Stellungen in der belgischen Wirtschaft.
Das Ölbild von „Glücksthal“ nahmen die damaligen Auswanderer sicherlich als Andenken an ihre Heimat mit nach Belgien.
Durch den Besuch von Prof. Lechat kam eine Fotografie des Ölbildes nach Neuhaus am Rennweg zurück. Es zeigt die erste tatsächliche Darstellung der ehemaligen Glashüttensiedlung „Glücksthal“.
Herr Schmidt stellte es dem Heimatmuseum „Geißlerhaus“ zur Verfügung. Dafür vielen Dank.
„Glücksthal“ wird auch heute noch liebevoll gepflegt. Durch ABM- Kräfte wurde eine neue Schutzhütte, Sitzgruppen und die Friedhofsumzäunung neu gebaut. Der kleine Waldfriedhof liegt unter Fichten versteckt. Ein Gewölbekeller ist als Bodendenkmal in die Denkmalschutzliste des Kreises Sonneberg aufgenommen worden. Die Thüringerwald- Vereine Lauscha und Neuhaus am Rennweg fühlen sich seit ihrem Bestehen immer für die Pflege von „Glücksthal“ verantwortlich.
Auf einer Tafel mit geschichtlichen Daten ist auch ein Gemälde der Fotografie des Ölbildes zu sehen, das Prof. Lechat in seinem Besitz hat.
„Glücksthal“ ist heute ein beliebtes Ausflugsziel. Nach der Wende wird in „Glücksthal“ am Pfingstmontag wieder Waldgottesdienst abgehalten. Solche Waldgottesdienste gab es auch schon zu Anfang unseres Jahrhunderts (20.Jahrhundert, Beitrag entstand im Juni 1998) an gleicher Stelle.
„Glücksthal“ ist ein Kleinod, das nur 500 m entfernt vom Parkplatz in Bernhardsthal links der B 281 in Richtung Steinheid liegt. Eine Wanderung nach „Glücksthal“ ist zugleich eine Wanderung in die jüngere Geschichte unserer Region.
Bernhardsthal ist heute ein idyllisch gelegenes Waldbad nahe bei Neuhaus am Rennweg.
Anmerkungen:
- Die erste von der Mutterglashütte Lauscha/ 1597 gegründete Tochterglashütte war die spätere Glashüttensiedlung Schmalenbuche (1607), der eigentliche Ursprung des heutigen Neuhaus am Rennweg.
- Am 10. November 1736 erhielten nach mehrmaligen Antrag die Glasmeister und Glasmaler Nicol Greiner, Georg Heinrich Greiner und Hans Michael Heintze aus Schmalenbuche, wo seit 1607 von Lauscha aus eine Glashütte gegründet und betrieben wurde, von dem regierenden Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt, Friedrich Anton, die Genehmigung, im Scheiber Forst, unweit des Reifweges im sogenannten Habichtsbach, eine Glashütte anzulegen.
Diese Glashüttensiedlung existierte mit Unterbrechungen nur bis zum Jahre 1838. 1838 wurden die Gebäude abgetragen.
Glücksthal und Habichtsbach lagen nur ca. 1 km auseinander. Dazwischen verläuft der Rennsteig, der zugleich damals Landesgrenze zwischen dem Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt und dem Herzogtum Sachsen-Meiningen war.
Ab 1813 scheint die Glashütte Habichtsbach nicht mehr produziert zu haben.
Der Herrschaft in Rudolstadt war die Ansiedlung im versteckten Wald bald ein Dorn im Auge. Bis Anfang der 30 er Jahre dämmerte Habichtsbach so vor sich hin. 1831 begann die Regierung in Rudolstadt die verschiedenen Anteile an Habichtsbach aufzukaufen. Ziel war es, Habichtsbach zu schleifen. Der Schlupfwinkel für Holz- und Wilddiebe sollte ausgeräumt werden, wie es die damalige Obrigkeit formulierte. Man warf den zu dieser Zeit noch dort wohnenden Familien vor, ihren Grundbesitz durch eigenmächtiges Versetzen der Grenzsteine vergrößert zu haben.
- Die Glashütte Schmalenbuche produzierte an verschiedenen Standorten bis Ende der 20 er Jahre unseres Jahrhunderts (gemeint ist das 20. Jahrhundert).
Neuhaus, ab 1861/62 Neuhaus am Rennweg, war 1668-1673 durch den Bau eines Jagdhauses mit Nebengebäuden der damaligen Grafen von Schwarzburg-Rudolstadt entstanden. Igelshieb wurde 1732 erstmals erwähnt und gehörte zum Herzogtum Sachsen- Meiningen.
Der Rennsteig trennte als Landesgrenze die Ortschaften Schmaenbuche und Neuhaus (Schwarzburg-Rudolstadt) und Igelshieb (Sachsen-Meiningen) bis zum Jahre 1918.
Am 01. April 1923 schlossen sich die Ortschaften Schmalenbuche, Igelshieb am Rennsteig und Neuhaus am Rennweg zum Ort Neuhaus am Rennweg-Igelshieb zusammen. 1933 entstand die Stadt Neuhaus am Rennweg.

Glücksthal im frühen 19. Jh., Foto Repro archiv-rueger
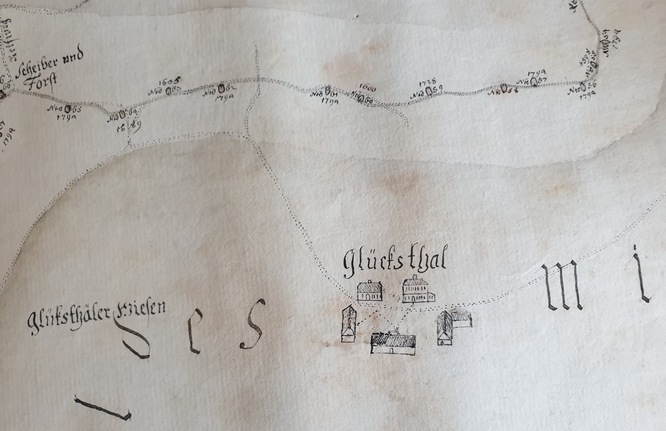
Glücksthal auf einem Rennsteigriss aus dem Jahre 1794, archiviert im Katasterbereich Saalfeld (repro archiv-rueger)
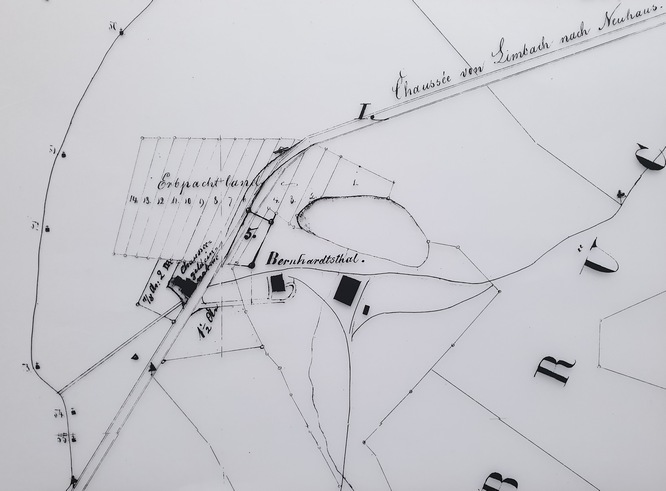
Bernhardsthal, Repro archiv-rueger (diese und folgende)
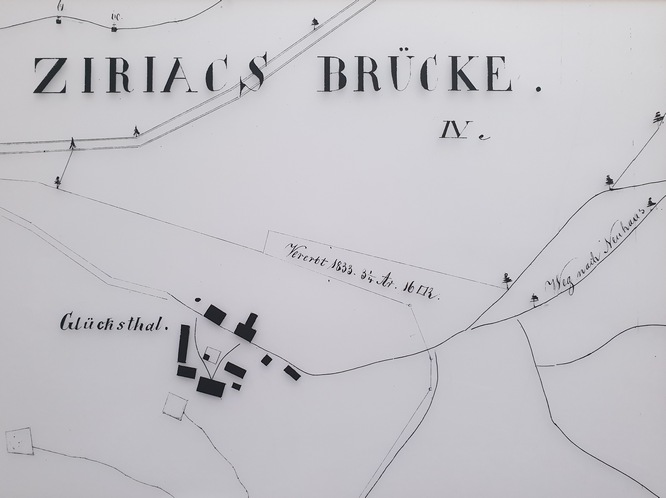
Darstellung auf einer fortgeschriebenen Meininger Forstkarte, erste Hälfte des 19. Jh, archiviert im Katasterbereich Saalfeld
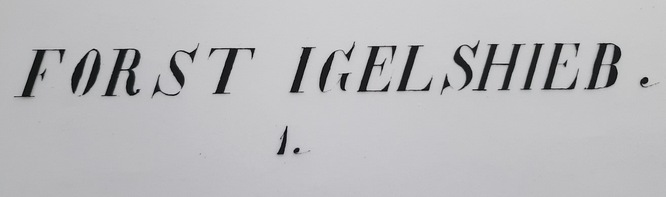
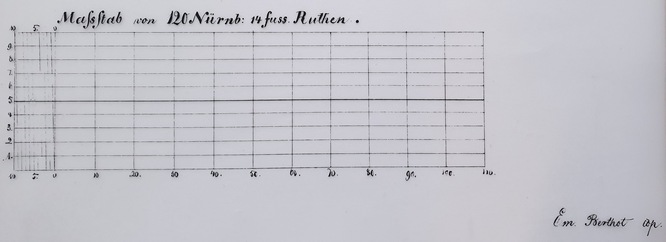

die erste Darstellung von Glücksthal, ein Ölgemälde, das sich im Besitz der Familie Lechat aus Belgien befindet
Waldgottesdienst zu Pfingsten 1997
Grenzadler
Im Verlauf des Rennsteiges auf dem Thüringer Wald finden wir insgesamt 3 solcher Grenzadler, die einst die Grenze zu den ehemalig preußischen Gebieten markierten. Eine direkte Grenzfunktion besaßen diese Steine nicht. Sie hatten mehr symbolischen Charakter. Die relativ wuchtigen Steine hatten eine bewegte Vergangenheit. Sie wurden umgefahren, wieder aufgestellt, mit zum Teil nicht zutreffenden Informationen versehen, der preußische Adler wurde gestohlen, sie wurden im Zuge von Baumaßnahmen umgesetzt.
Folgende 3 Grenzadler stehen im Verlauf des Rennsteiges (von Blankenstein nach Hörschel):
- Grenzadler bei Oberhof
- Grenzadler an der Neuen Ausspanne
- Grenzadler am Kleinen Inselsberg

Hartmut Burkhardt bei seiner Ansprache (Foto: Burkhardt)
Ansprache anlässlich der Wiederaufrichtung des Preußischen Grenzadlers an der Neuen Ausspanne Nesselberg, am 3. Oktober 2007 (von: Hartmut Burkhardt, Verein für Schmalkaldische Geschichte und Landeskunde, Schmalkalden)
Seit die Henneberger Grafen 1360 das Gebiet um Schmalkalden mit dem Amt Schmalkalden, der Cent Brotterode und der Vogtei Herrenbreitungen, das sie schon „Herrschaft Schmalkalden“ nannten, nur mit Hilfe des Landgrafen von Hessen aus der Pfandherrschaft lösen konnten und nun je zur Hälfte mit den Hessen verwalten mussten, spätestens seit dem Aussterben der Henneberger 1583 und dem Beginn der hessischen Alleinherrschaft, war das Schicksal der hessischen Exklave Schmalkalden untrennbar mit der geschichtlichen Entwicklung der Landgrafschaft Hessen verknüpft. 1619 erfolgte durch Zugewinn des kursächsischen AmtesHallenberg im Tausch gegen die im hessischen Besitz befindliche halbe Cent Benshausen (Permutationsvertrag vom 13.04.1619) noch eine Gebietserweiterung. In dieser Form überdauerte das hessische Herrschaftsgebiet weitere fast 250 Jahre – nur unterbrochen in napolionischer Zeit von 1807 bis 1813 durch Zugehörigkeit als Kantondes künstlichen Staatsgebildes „Königreich Westfalen“ unter Jerome, dem Bruder Napoleons. (Frieden von Tilsit7.7.1807. Bildung der Kantone Schmalkalden, Floh, Seligenthal, Brotterode, Herrenbreitungen, Steinbach). Und selbst nach der Annexion Kurhessens durch Preußen 1866 blieb die Herrschaft Schmalkalden als Teil der neu gebildeten preußischen Provinz Hessen-Nassau, Regierungsbezirk Cassel „hessisch“ orientiert, bis sie durch „Führererlaß“ vom 3. 7.1944 im Zuge einer „Zentralisierung der Verteidigungsstruktur“ derpreußischen Provinz Sachsen, Regierungsbezirk Erfurt zugeschlagen wurde. Damit endete die Bindung unseres Gebietes an Hessen nach fast 600 Jahren endgültig.
Wenn wir heute am 3. Oktober hier oben stehen, um den seit September 2004 „gesichtslosen“ gewordenen Preußischen Grenzadler an der Neuen Ausspanne wieder aufgestellt zu sehen, ist ein Blick in die mit ihm verbundene deutsche und Territorialgeschichte des 19. Jahrhunderts angebracht.
Nachdem sich die hessische Exklave Schmalkalden unter den hessischen Landgrafen mehr oder weniger beachtet fand- man denke nur an den aufwändigen Bau der Sommerresidenz Wilhelmsburgunter Landgraf Wilhelm IV – trat zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine deutliche Verschlechterung ein.Nach dem Ende der sog. Revolutionskriege mit Frankreich und dem Frieden von Luneville 1801 wurden linksrheinische deutsche Gebiete an Frankreich abgetreten und brachten auch territoriale Verluste für das hessische Landgrafenhaus. Der damalige LandgrafWilhelm IX. erhielt 1803 als „Ausgleich“ als Wilhelm I. die Kurfürstenwürde und wir Schmalkalder wurden „kurhessisch“, wie es noch heute an zahlreichen Grenzsteinen aus dieser Zeit am Rennsteigsichtbar ist.
Napoleon Bonapartes erwachte Expansionsgelüste – 1804 hatte er sich zum erblichen Konsul Frankreichs selbst erhoben – richteten sich nun auf Deutschland, seine Hegemonievorstellungen auf Europa. Nachdem die Habsburger schon gedemütigt waren, richtete sich jetzt der Stoß gegen die zweite Hauptmachtim Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, gegen Preußen, das 1806 bei Jena und Auerstedt vernichtend geschlagen wurde und im Frieden von Tilsit seine tiefste Erniedrigung erlebte. Das kleine Kurhessen fürchtete sich, zwischen die Fronten zu geraten. Kurfürst Wilhelm I. hatte deshalb 1806 mit Napoleon einen „Neutralitäts-Vertrag“ geschlossen, der aber nach dem Sieg über die Preußen von Napoleon gebrochen wurde mit der Begründung, der hessische Kurfürst hätte zum gleichen Zeitpunkt seine Armee auf 20.000 Mann verstärkt und offensichtlich nur auf einen anderen Ausgang des Krieges gegen Preußen spekuliert, um dann mit diesen gemeinsam gegen Napoleon Front zu machen.
Der Kurfürst wurde abgesetzt, das Kurfürstentum dem Staatsgebilde Königreich Westfalen eingegliedert, das hauptsächlich aus Kurhessen, preußischen und braunschweigischen Gebieten gebildet wurde. Die Herrschaft Schmalkalden hatte in dieser Zeit viele Truppendurchzüge zu erdulden. Die Notlage der Bevölkerung verstärkte sich. Obgleich 1807 eine neue Verfassung für das Königreich Westfalen mit fortschrittlichen Inhalten in Kraft trat, war dies wenig Ausgleich für die Lasten der napoleonischen Herrschaft. Mit dem Sieg der alliierten Heere in der Völkerschlacht bei Leipzig wurde Napoleons Niederlage besiegelt und damit auch das Ende des Königreichs Westfalen.
Im November 1813 konnte Kurfürst Wilhelm I. nach Cassel zurückkehren. Europa musste neu geordnet werden. Der habsburgische Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation Franz II. hatte – offensichtlich dieser Würde und Pflichten überdrüssig – schon 1804 den Titel eines neuen Kaiser-reiches Österreich-Ungarn angenommen und 1806 die seit 1438 in habsburgischen Händen liegende Krone des Hl. R. R. D. N. niedergelegt. (Seither befinden sich die Reichsinsignien in Wien – Ausnahme 1938 – 1945 in Nürnberg).
Beim Wiener Kongreß 1815, an dem alle europäischen Staaten teilnahmen, wurden unter dem habsburgischen Fürstkanzler Metternich eine neue europäische Staatenordnung und neue Grenzfestlegungen vereinbart. Deutschland wurde durch den Widerstand Österreichs der erhoffte Nationalstaat verweigert. Dagegen entstand ein loser Staatenbund – der Deutsche Bund - mit dem Kaisertum Österreich als Präsidialmacht, den Königreichen Preußen,Bayern, Sachsen, Hannover und Württemberg, dem Kurfürstentum Hessen – Kurfürst Wilhelm I. wurde die Königswürde verweigert, er behielt den jetzt völlig wertlosen Titel „Kurfürst“- ,sieben Großherzogtümern, zehn Herzogtümern, ein Flickenteppich von Mittel- und Kleinstaaten, ohnmächtig gegen die Deutschland umgebenden Zentralstaaten, Keim neuer Konflikte, nicht zuletzt durch den sich schon abzeichnenden Dualismus zwischen der Präsidialmacht Österreich und dem durch Gebietszuwachs wieder erstarkenden Preußen.
Die Herrschaftshäuser begannen im Gegensatz zu allen Volksbestrebungen eine restaurative, reaktionäre Politik, die ganz auf die Wiederherstellung der alten Ordnung und Machtverhältnisse gerichtet war. So hielt es auch der nach Cassel zurückgekehrte hessische Kurfürst Wilhelm I., der zunächst Reformen versprach, einen neuen Verfassungsentwurf vorlegte und wieder zurückzog. Auch die Wiederherstellung der Landstände wurde nicht eingehalten und meist per Verordnungen regiert. Als nach Wilhelm I. Tod sein Sohn als Wilhelm II. die Regierung übernahm, erregte nicht nur sein Verhältnis zur bürgerlichen Emilie Ortlepp, vom Kurfürsten zur Gräfin von Reichenbach und vom österreichischen Kaiser zur Fürstin von Hanau und Horowitz erhoben, allgemeinen Anstoß, sondern vielmehr auch seine allgemeine Herrschaftspolitik.Es kommt zu Unruhen in Kurhessen, so dass sich Kurfürst Wilhelm II. zur Verlegung seiner Residenz nach Hanau genötigt sah und seinen Sohn, Kurprinz Friedrich Wilhelm, zur Mitregentschaft einsetzte. Der verfügte den Zollanschluß Kurhessens an Preußen, lag aber im ständigen Streit mit den Verfassungsorganen Landtag und Ständeversammlung. Das änderte sich auch nicht nach dem Tod Wilhelm II. und der Alleinherrschaft Kurfürst Friedrich Wilhelm I., so dass die revolutionären Erhebungen von 1848 auch in Kurhessen wirkten.
Die Reichsverfassung von 1849 wurde angenommen und Grundrechte publiziert. Die Ständeversammlung setzte den Beitritt Kurhessens zur preußisch dominierten Deutschen Union (Am 26.05.1849 geschlossenes „Dreikönigsbündnis“ von Preußen, Hannover und Sachsen, das nach dem Scheitern des Verfassungswerkes der Frankfurter Nationalversammlung eine deutsche Bundesstaatsverfassung unter ausdrücklichem Ausschluß Österreichs, aber unter Leitung Preußens ausarbeiten sollte. Unter österreichischem und russischen Druck musste Preußen in der sogen. „Olmützer Punktation“ vom 29.11.1850 seine Pläne zurückziehen. U.a. akzeptierte Preußen hierin auch die sogen. Bundesexekution gegen Kurhessen) durch. Doch die Unionsverfassung erschwerte die Unterdrückung des andauernden Volkswiderstandes. Kurfürst Friedrich Wilhelms mächtigster „Handlanger“ war Minister Hassenpflug, der als „Hessenfluch“ konsequent gegen parlamentarische Rechte vorging und mit Hilfe von Österreich im deutschen Bundestag in Frankfurt am Main intrigierte. War die vom Volk beanstandete Ehe des Kurfürsten der erste Schritt zur Annäherung an Österreich, so folgte jetzt mit Hassenpflugs Politik ein zweiter Schritt. Wegen Haushaltsstreitigkeiten, Finanzen und Steuerverweigerung wurde vom hessischen Ministerium sogar der „Kriegszustand“ erklärt und Hassenpflug forderte im Frankfurter Bundestag das Eingreifen des Deutschen Bundes in die hessischen Angelegenheiten. Im November 1849 überschreitet deshalb ein österreichisch-bayrisches Armeekorps, die sogen. „Strafbayern“ die kurhessische Grenze.
Kurfürst Friedrich Wilhelm kehrt nach Cassel zurück und lässt hessische Beamte, Richter und Offiziere vor Gericht stellen. Die Verfassungsstreitigkeiten dauern an,Preußen und Österreich mischen sich ein, und erst nach Hassenpflugs Sturz wurden 1862 die fortschrittliche Verfassung von 1831, das Wahlgesetz und die Geschäftsordnung der Stände von 1848 wieder eingesetzt.
Inzwischen hatte die sogen. Schleswig-Holstein-Frage – die hier nicht weiter betrachtet werden kann – im Deutschen Bund zu neuen Spannungen geführt. Nach dem polnischen Aufstand gegen die Besatzungsmacht Russland hielt es Dänemark für günstig, seine Pläne hinsichtlich der Herzogtümer Schleswig und Holstein umzusetzen.
Dänemark beabsichtigte im Widerspruch zum sogen. Londoner Protokoll (08.05.1852 , Anerkennung von Prinz Christian von Schleswig -Holstein – Sonderburg – Glücksburg von allen Großmächten und Schweden) die Eingliederung Schleswigs in den dänischen Gesamtstaat. Bismarck, der in Preußen mit einer starken liberalen Oppositionzu kämpfen hatte, kam der aufbrechende Streit sehr zupass, zumal er die Annektierung Schleswig-Holsteins längst im Visier hatte. Es gelang ihm aber, durch das Pochen auf den Londoner Vertrag, Österreich noch einmal auf seine Seite zu ziehen. AlsDänemark auf die ultimative Aufforderung, die den Londoner Abmachungen zuwiderlaufende Gesamtstaatsverfassung zurückzuziehen, nicht reagierte, überschritten am 1. Februar 1864 preußische und österreichische Truppen die Grenze nach Dänemark. Die Kampfhandlungen endeten mit dem sogen. Wiener Frieden vom 30.10.1864, in dem man sich über eine gemeinsame Herrschaft über Schleswig und Holstein einigte. Doch die Streitigkeiten zwischen Preußen und Österreich brechen rasch wieder auf.
Der stockkonservative Bismarck überraschte alle liberalen und progressiven Kräfte, als er im April 1866 im Frankfurter Bundestag den Antrag einbringt, ein Nationalparlament zu berufen, das aus allgemeinen und direkten Wahlen hervorgehen und über eine Reform der Bundesverfassung beraten soll, ein Affront gegen das Kaisertum Österreich, die Präsidialmacht im Deutschen Bund! Fast gleichzeitig überträgt Österreich im Juni 1866 die Entscheidung in der Schleswig-Holstein-Frage dem Frankfurter Bundestag und sagt sich damit vom Gasteiner (14.08.1865, Vertrag zwischen Österreich und Preußen über die provisorische Verwaltung der Fürstentümer Schleswig und Holstein, am 20.08.1865 von Kaiser Franz Joseph und König Wilhelm unter-zeichnet. Die Verwaltung Holsteins mit überwiegend deutscher Bevölkerung geht an Österreich, die von Schleswig mit dänisch- deutscher Bevölkerung an Preußen. Lauenburg wurde gegen eine Entschädigungszahlung in Höhe von 2,5 Mio. Thaler von Österreich an Preußen abgetreten) und Londoner Vertrag los, ein Affront gegen Preußen! Sofort rücken als Antwort am 9. 6. 1866 preußische Truppen in Holstein ein. Außerdem unterbreitet Bismarck jetzt im Bundestag die Grundzüge einer neuen Bundesverfassung o h n e Österreich.
Daraufhin beschließt die mehrheitlich auf österreichischer Seite stehende Mehrheit am 14. 6. 1866 die Mobilmachung der Bundestruppen. Preußen erklärt als Antwort den „Bundesvertrag“ für gebrochen und erloschen. Der hessische Kurfürst Friedrich Wilhelm I. hatte sich entgegen aller mahnenden Einwände von Ministern, Offizieren, Ständen und trotz seiner engen verwandtschaftlichen Beziehungen zu Preußen (er war der Sohn von Auguste, Tochter des preuß. Königs Friedrich- Wilhelm II.) am 14. 6. 1866 für den Bundesbeschluß, und damit auf dieSeite Österreichs gestellt. Zudem wies er alle preußischen Vermittlungsversuche ab und befahl die sofortige Mobilmachung der hessischen Truppen.
Schon am 16. 6. 1866 rückten preußische Truppen in Kurhessen ein und besetzten die Residenzstadt Cassel. Der hessische Kurfürst Friedrich Wilhelm I. wurde gefangen genommen und in Gefangenschaft nach Stettin abgeführt, oder wie es hieß „vom preußischen König eingeladen, für die Dauer des Krieges seinen Wohnsitz nach Preußen zu verlegen“. In seiner Begleitung befand sich u.a. Hauptmann Friedrich Brack, der spätere Bürgermeister von Schmalkalden. Die hessischen Truppen hatten bis auf ein Gefecht nicht in die Kampfhandlungen eingegriffen.
Am 22. 6.1866 überschritt die preußische Hauptarmee die böhmische Grenze und besiegte am 3. 7. 1866 die Bundestruppen bei Königgrätz vernichtend. Während im Friedensschluss von Prag am 23.8.1866 der Territorialbestand von Österreich, Sachsen, sowie aller süddeutschen Staaten zugesichert wurde, annektierte Preußen das Königreich Hannover, das Fürstentum Nassau, die Stadt Frankfurt sowie K u r h e s s e n . Schon am 16.8.1866, also noch vor der Unterzeichnung des Friedensvertrages, gab König Wilhelm von Preußen in einer Botschaft an den Landtag bekannt, dass er zur Annexion dieser Staaten entschlossen sei.
Am 20. 9. 1866 wurde die „Vereinigung“ des ehemaligen Kurfürstentums Hessen mit dem preußischen Königreich per Gesetz bekanntgegeben:
…“Wir, Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen etc. etc. verordnen mit Zustimmung beider Häuser des Landtages was folgt:
§ 1.
Das Königreich Hannover, das Kurfürstenthum Hessen, das Herzogthum Nassau und die freie Stadt Frankfurt werden in Gemäßheit des Artikels 2 der Verfassungs-Urkunde für den preußischen Staat mit der preußischen Monarchie vereinigt…
Gegeben Berlin, den 20. September 1866 Wilhelm“ (Sammlung von Gesetzen für Kurhessen, Jahr 1866 – Nr. XIV – September)
Am 8.10.1866 verfügte König Wilhelm in einem Patent u.a.
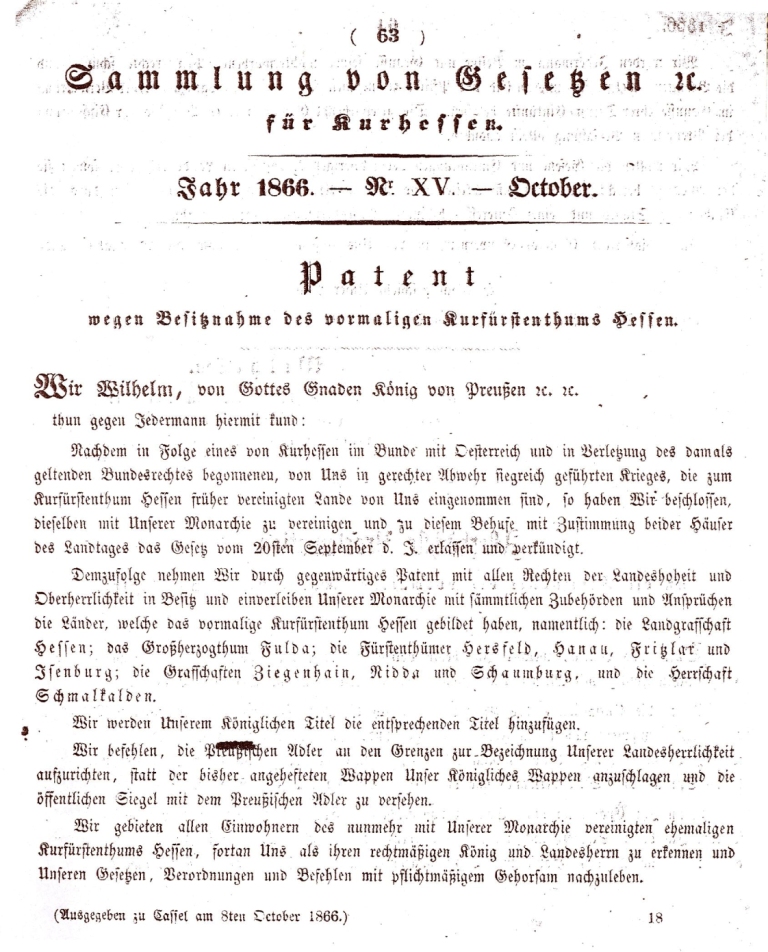
"Wir befehlen, die Preußischen Adler an den Grenzen zur Bezeichnung Unserer Landesherrlichkeit aufzurichten..."
Kurz vorher begrüßt und umarmt König Wilhelm in einer Allerhöchsten Proklamation vom 3. 10.1866 alle Kurhessen als seine neuen Landeskinder.
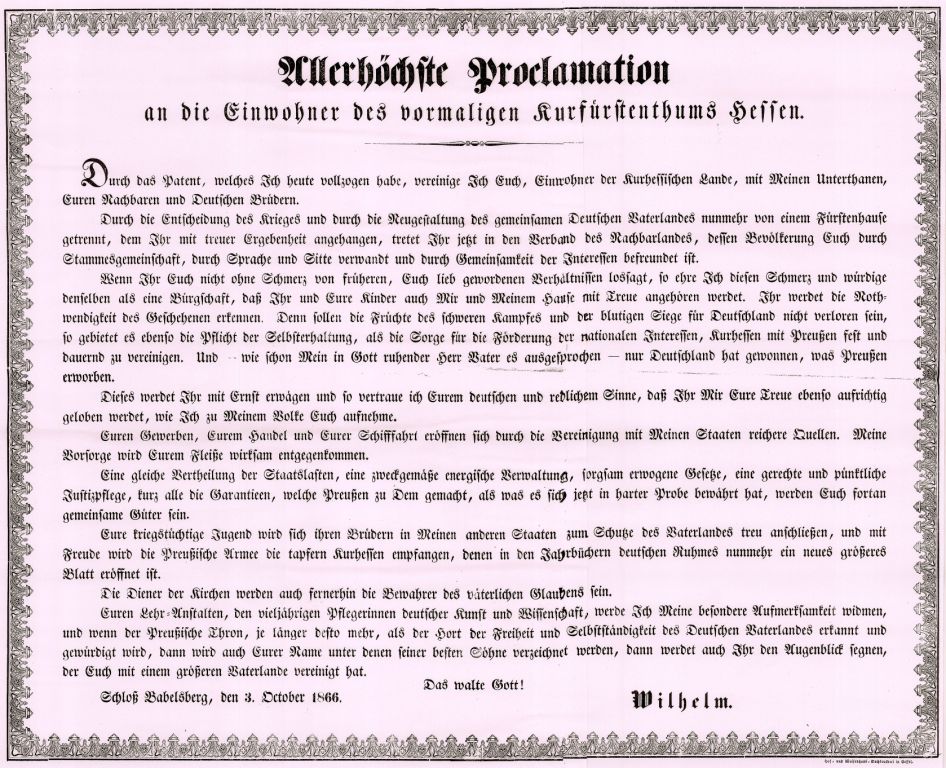
Aber schon am 14. September 1866, also deutlich vor den von König Wilhelm erstmals geäußerten Annexionsplänen, und vor der gesetzlichen Verkündung in seinem „Besitznahmepatent“ vom 3. 10. 1866 schenkte der preußische König die ihm zu dieser Zeit noch nicht gehörenden in der Herrschaft Schmalkalden gelegenen hessischen Staatsforsten mit 8665.0 ha an Herzog Ernst II. von Sachsen - Coburg und Gotha.
Bismarcks Angebot an Herzog Ernst II., die gesamte Herrschaft Schmalkalden dem gothaischen Staat einzugliedern, lehnte Ernst II. dankend ab, da das Zugewinngebiet zu arm und deshalb für ihn eine Belastung sei. Die Jagd wäre aber für ihn sicher von großem Interesse.
(Diese Schenkung wirkt über Revolution und Weltkrieg II mit seinen Folgen bis in unsere Tage).
Bemerkenswert an der Schenkung sind insbesondere zwei Fakten:
1. Die Dotation erfolgt am 14. 9. 1866 deutlich vor Verkündung der Annexion und stellt folglich die Weitergabe einer „Kriegsbeute“ dar.
2. Die Dotation erfolgte nicht an das Herzogtum Sachsen – Coburg – Gotha, sondern vielmehr als persönliches Eigentum im Sinne eines fideikommissarischen (Nach preußischem Recht ein Wertobjekt, meist Grundbesitz, das unveräußerlich und nur innerhalb von Familien nach Erbfolge ungeteilt an ein anderes Glied der Familie übergeht) Privateigentums an das Hzgl. Sachsen – Coburg und Gothaischen Haus.
Anlass für die großzügige Schenkung sollte nach König Wilhelm der Dank an Herzog Ernst II.
von S.C.G. für geleistete militärische Hilfe sein. Die gothaischen Truppen hatten im Krieg die taktische Aufgabe übernommen, den Zusammenschluss der feindlichen bayrischen und hannoveranischen Armeen zu verhindern. Sie hatten in den Gefechten bei Langensalza Tote und Verwundete zu beklagen, die Bevölkerung durch auferlegte Truppendurchzüge und Biwaklager Belastungen hinnehmen müssen.
In einer Vereinbarung des Bevollmächtigten S.M. des Königs von Preußen und S.H. dem Herzog von Sachsen – Coburg – Gotha heißt es:
… „S. M. d. König von Preußen, geleitet von dem Wunsche, S. H., dem Herzog von S.C.G. für die im Laufe der letzten kriegerischen Ereignisse gebrachten Opfer eine Entschädigung zu gewähren und zugleich ein Beweis des Anerkenntnisses der getreuen Bundesgenossenschaft G. H. vom ersten Anfang des Krieges bis zuletzt und der threuen und wirksamen Theilnahme des Herzoglichen Contingents an der kriegerischen Action, tritt die in der ehemaligen kurhessischen Herrschaft Schmalkalden gelegenen Staatsforsten mit allem Zubehör an Forsthäusern, Pirschhäusern, Feld- und Wiesengrundstücken, Teichen und Fischereien und allen Inventarien etc. an S. H. den Herzog von Coburg und Gotha ab….“
Wie reagierte nun die Bevölkerung der ehem. kurhessischen Gebiete, im speziellen die der Herrschaft Schmalkalden auf den Hoheitswechsel ? Es wurde schon gesagt, dass das Casseler Interesse an der hessischen Exklave Schmalkalden seit kurhessischen Zeiten, also seit Beginn des 19. Jh. spürbar nachgelassen hatte. Man sagte, dass missliebig gewordene Beamte nach hier versetzt wurden und sprach vom „Hessisch-Sibirien“. Die wirtschaftliche Situation der zahlreichen Handwerksbetriebe hatte sich zur gleichen Zeit ständig verschlechtert. Schon nach den negativen Folgen des Siebenjährigen Krieges, dem preußisch-französichen Krieg von 1806, den Lasten des Befreiungskrieges 1813, der beginnenden industriellen Fertigungsweise, dem bodenständigen Beharren auf der Produktionsweise der Väter einerseits und den wiederholt schlechten Ernten auf kargen Böden andererseits war die Situation der ca. 45.000 Einwohner der Herrschaft Schmalkalden schlecht. Es bestanden wenig Sympathien für das kurhessische Haus, wenn auch die Stadt beim Tod von Kurfürst Wilhelm II. 1847 ein vierwöchentliches Trauergeläute anordnete, bei dem die historische Große Oster sprang.
Um die Notlage zu lindern, organisierte der damalige Bürgermeister Utendörfer „Notarbeiten“, wie den Ausbau des in schlechtem Zustand befindlichen Forstweges ins Pfaffenbachtal bis zu den Landwehrgräben am Steinkopf auf Kosten der Stadt, an der bis zu 385 Arbeiter beschäftigt waren. Arbeitslose Bergarbeiter aus Herges-Vogtei bauten die Fortsetzung der Straße bis ins Trusetal.
Im August 1866 kamen 225 preußische Soldaten zur „Besitzergreifung“ nach Schmalkalden. Sie wurden von der Bevölkerung freundlich aufgenommen und rückten schon am 8. Oktober wieder ab.
Im sog. preußischen „Diktaturjahr“ (Von der preußischen Regierung für die Zeit vom 01.10.1866 bis 01.10.1867 in Vorsorge auf evtl. zu erwartende Widerstände in den Annexionsgebieten ausgerufen) ergoss sich auf die ehem. Kurhes-sichen Gebiete eine wahrhaft preußische Gesetzesflut, die „Wolken-bruchgesetzgebung“ (Zu den wichtigsten Gesetzen gehörte das über die Abschaffung der Zünfte vom 29.03.1867 sowie das über die Beschäftigung von Jugendlichen in der Industrie vom 22.09.1867) und einhergehend eine Verwaltungsreform. Die Herrschaft Schmalkalden kam zur neu gebildeten Provinz Hessen-Nassau und darin zum Regierungsbezirk Cassel. Die Regierungsbezirke wurden nach preußischem Muster in Landkreise unterteilt und die Herrschaft Schmalkalden somit zum Landkreis „Herrschaft Schmalkalden“.
Doch schon bald wurde gerade dieser Landkreis vom preußischen Oberpräsidenten von Witzleben in Frage gestellt. Er sollte nach seinen Plänen dem schon vorher preußischen Landkreis Schleusingen zugeschlagen werden. In einer ausführlichen Stellungnahme vom 23. 1. 1867 sprach sich der damalige Schleusinger Landrat Herold ausdrücklich gegen die Verschmelzung aus und führte topographische Gründe am Beispiel Brotterode / Kreisstadt Schleusingen, unterschiedliche kirchliche Zugehörigkeit, Unterschiede bei Handel und Industrie, bei Agrar- und Kommunalverhältnissen, aber auch charakterliche Unterschiede bei der Bevölkerung an. Obwohl beide hennebergisch-fränkisch, seien die Bewohner der Herrschaft Schmalkalden durch die jahrhundertelange hessische Prägung mit Schleusingern nicht recht kompatibel. Auch sollte man zwei arme Kreise nicht vereinen. Dagegen sollten die Schleusinger Orte Viernau und Christes, weil näher an Schmalkalden gelegen, dem Kreis Schmalkalden zuschlagen.
Allmählich besserten sich die wirtschaftlichen Verhältnisse unter preußischer Herrschaft. Teile des „Kurhessischen Hausschatzes“, die der ehem. Kurfürst nach einem „Auseinandersetzungs Vertrag“ mit Preußen nicht mit ins böhmische Exil nehmen konnte und den ehemalig kurhessichen „Staatsschatz“ verwandte Preußen auf Druck der Kommunalstände zum dringend nötigen Aufbau des Landes. Für die Herrschaft Schmalkalden brachten neue Verkehrsanbindungen, Entwicklung der Industrie, Ausbau des Schulwesens allmählichen Aufstieg, der in der Zeit nach der Reichsgründung gefestigt werden.

Grenzadler an der Neuen Ausspanne zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Am 3. Oktober 1866 war die kgl. preuß. Anordnung auf Errichtung preußischer Hoheitszeichen ergangen. Sie wurden an den Straßenüberhängen der Herrschaft zu den Territorien der sächsich-thür. Herzogtümer Sachsen – Coburg – Gotha und Sachsen – Meiningen errichtet. Mit dem Ende des 2. Weltkrieges und der von den alliierten Siegermächten befohlenen Auflösung des Staates/Landes Preußen als „Hort immer-währenden Militarismus’“ endete auch für die Herrschaft Schmalkalden die „Preußenzeit“. Die SMAD ( Sowjetische Militäradministration Deutschland, höchstes Verwaltungsorgan der sowjetischen Besatzungsmacht. SMATh., Sowjetische Militäradministration in Thüringen) verfügte die Beseitigung der Preußenadler. Sie wurden aus den Sandsteinsäulen herausgebrochen und vernichtet (?).
Der Wirt des Gasthauses „Kleiner Inselsberg“ zeigte Zivilcourage und bewahrte den am Standort Grenzwiese abgenommenen Grenzadler auf und brachte ihn aus Sicherheitsgründen über die inzwischen entstandene innerdeutsche Grenze. Nach der politischen Wende 1989 gelangte der Adler in den Besitz der Wirtstochter, Frau Christa Malsch, und die Kunde, dass einer der Grenzadler noch unversehrt erhalten sei. Verdienstvolle Heimatfreunde um Jochen Heusing aus Schmalkalden, Helmut Köllner, Gerhard Ringer aus Kleinschmalkalden und Dr. Stötzer aus Tambach-Dietharz konnten sich sofort eine Wiederanbringung an den Originalstandorten vorstellen. Sie organisierten die notwendigen finanziellen Mittel bei der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Schmalkalden und ließen in Zella-Mehlis Neuabgüsse herstellen, die dann wiederum am 3. Oktober 1992 an den Standorten Waldschenke bei Kleinschmalkalden, an der Grenzwiese bei Brotterode, an der Neuen Ausspanne am Nesselberg und an der Schützenwiese bei Oberhof feierlich angebracht wurden. 1993 folgten die Aufstellung in Herrenbreitungen und eine Wiederanbringung in Bairoda, 2006 eine Wiederaufstellung am Ortsausgang Mittelschmalkalden (mit Hilfe der Freunde der Todenwarth.
Am 3./4. September 2004 stahlen gewissenlose Souvenirjäger oder kriminelle Metalldiebe den Grenzadler an der Neuen Ausspanne mit brachialer Gewalt. Polizeiliche und staatsanwaltliche Nachforschungen ergaben keinen Hinweis. Wieder stand der Grenzadler „gesichtslos“.
Bild: Ulrich Rüger, der gesichtslose Grenzadler an der Neuen Ausspanne

Bild: Ulrich Rüger, kurz vor dem Diebstahl entstand dieses Foto
Auf Initiative des Vereins für Schmalkaldische Geschichte und Landeskunde e.V. wurde der gesamte Stein in diesem Jahr mit finanzieller Hilfe der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Schmalkalden-Meiningen und der Gemeinde Floh-Seligenthal, für die wir hier herzlich danken, vom Natursteinbetrieb Köpler in bewährter Weise restauriert, wieder mit seinem Preußenadler versehen aufgestellt und soll heute, genau 141 Jahre nach der von Preußen befohlenen Aufstellung, wieder der Öffentlichkeit übergeben werden.
Inzwischen wissen wir – und können es auch wieder sagen – dass Preußen viel mehr war als Militarismus: Disziplin und Ordnung, wissenschaftlich-technischer Fortschritt, vor allem aber auch Toleranz. So erinnert uns der wieder aufgestellte Adler an fast 80 Jahre Preußenzeit für die Herrschaft Schmalkalden, aber auch an die Überwindung der Kleinstaaterei. Wir sind nun „Hessen“ im Freistaat Thüringen in der Bundesrepublik Deutschland und endlich auch in einem vereinten fast grenzenlosen Europa.
So übergeben wir den Stein der Öffentlichkeit mit der Bitte um Schutz und Bewahrung.
Schmalkalden im September 2007
Hartmut Burkhardt
Mein Dank gilt den Jagdhornbläsern aus Floh-Seligenthal, die unsere kleine Feierstunde würdig umrahmten, dem Diabaswerk Nesselgrund, das uns ganz unbürokratisch und schnell eine LKW-Ladung Schotter zur Verfügung stellte und meinen Freunden des Geschichtsvereins und mir ermöglichte, die Umgebung des Grenzadlers in einen „begehbaren“ Zustand zu versetzen.
Literatur
Engelberg, Bismarck Akademieverlag Berlin 1986
Bismarck, Dokumente seines Lebens Reclam 1986
Lemberg, Wolff, Das nördliche Hessen, Zeugnisse seiner Geschichte, Heft 5 Kurhessen wird preußisch 1995
Lehnert, Die Kriegsereignisse des Jahres 1866 im Hzgt. Gotha z.Zt. des Treffens von Langensalza, 1899 Repro: Rockstroh
Hoffmeister, Wahl, Die Wettiner in Thüringen Rhino-Verlag Arnstadt und Weimar 1999
Chronik von Schmalkalden, Heft 2 u. 3 Stadt- und Kreisarchiv Schmal-kalden 2007
Zeitschrift für Hennebergische Geschichte und Landeskunde zu Schmalkalden, Heft XI
Pistor, Stadt und Herrschaft Schmalkalden im Kriege 1866, Heimatkalender 1916
Akten der hzgl. Sachsen-Gotha und Coburgischen Hauptverwaltung, Forst-abteilung Reinhardsbrunn
Unterlagen des Stadt- und Kreisarchivs Schmalkalden.
Köllner, Dokumentation zur Wiederanbringung der ehem. Preußischen Grenzadler 2005
Brockhaus Konversationslexikon 1898
Akten des Stadt- und Kreisarchivs Schmalkalden
Weitere Bilder:

historisches Foto vom Grenzadler bei Oberhof zu Beginn des 20. Jh. (Bild: archiv-rüger)

der Oberhofer Grenzadler, aufgenommen zur Pfingstrunst 1940 (archiv-rüger)

Foto des Grenzadlers bei Oberhof aus dem Jahre 2008
neueres Foto vom Oberhofer Grenzadler von Manfred Kastner (vergl. dazu auch Rennsteigchronik 2014)
Bauarbeiten am Grenzadler bei Oberhof (November 2014)

Grenzadler am Kleinen Inselsberg, Grenzwiese aufgenommen zur Rennsteigneuvermessung
im Jahre 2003, mit Aufschrift auf dem Obelisk, die jeglichen
denkmalschutzrechtlichen Regeln widerspricht
Habichtsbach
Im damaligen Herrschaftsbereich des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt, wurde oberhalb des heutigen Stausees bei Scheibe-Alsbach eine Glashütte angelegt.

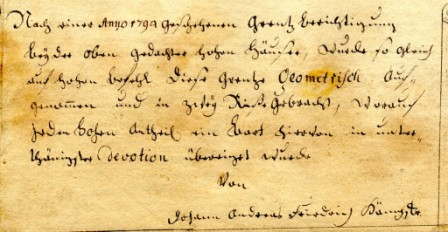

Habichtsbach um 1850
Allgemein
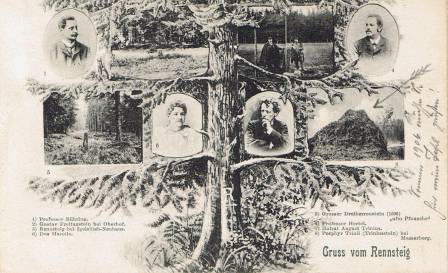
1906
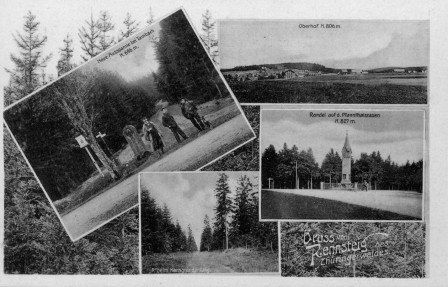
1906

1906
Alsbach
In Alsbach, oben auf dem Rennsteig, befand sich eine Ausspanne der Herzoglich Sachsen-Meiningen Fürstl. Thurn und Taxis'schen Post. Hier wurden unter anderem auch Belege für gewisse Transportleisungen ausgegeben. Da man sich hier auf sehr unwegsamen Gelände fortbewegte, war eine besondere Pflege und Wartung von Ross und Kutsche erforderlich. Diese Leistungen wurden dem jeweiligen Auftraggeber der Beförderungsleistung anteilig in Rechnung gestellt. Hierzu gehörte auch das sogenannte "Schmiergeld" (Wagenschmiere für die beweglichen Metallteile an den Kutschen). Wahrscheinlich ist so auch der Begriff "Schmiergeld" für Leistungen, wenn es halt einmal schneller gehen sollte und es dabei am Willen der beauftragten Person mangelte, entstanden.
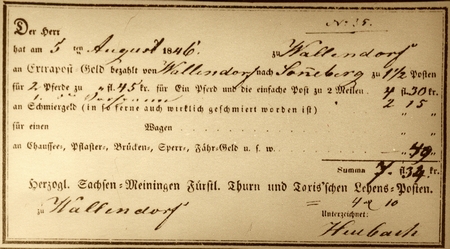
ein Postbeleg der Ausspanne Alsbach über die Zahlung von Schmiergeld vom 05. August 1846
Alte Landesgrenze
Es gibt insgesamt noch 2 solcher Wegesteine am Rennsteig. Ein Stein befindet sich direkt an der Straße Neustadt am Rennsteig/ Großer Dreiherrenstein, dort wo der Rennsteig die Straße kreuzt. Der 2. Stein steht gegenüber vom Großen Dreiherrenstein.

1968 entstand dieses Foto (erstgenannter Stein oben) bei meiner Runst auf dem Rennsteig
Ascherbrück
Bühringsblick, Bühringshütte


Heuberghaus
Hörschel


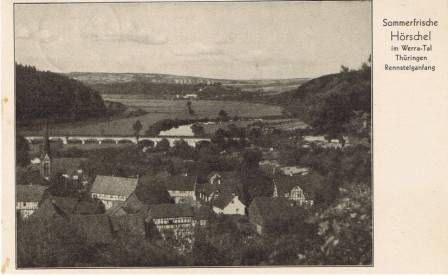
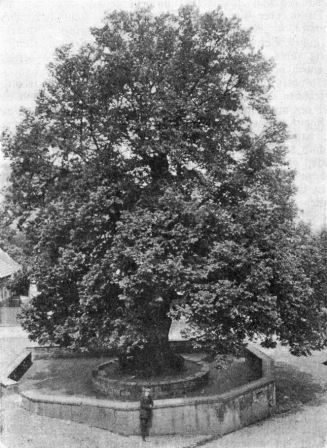







Neuhäuser Marktrecht
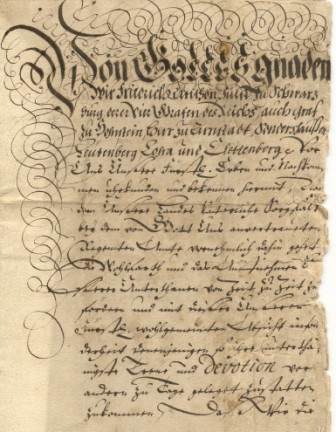
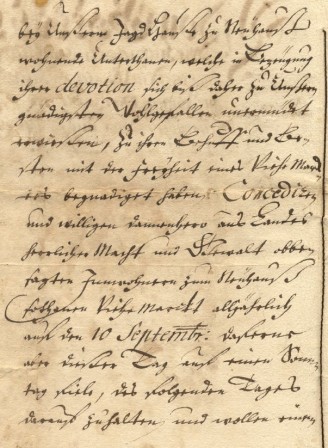
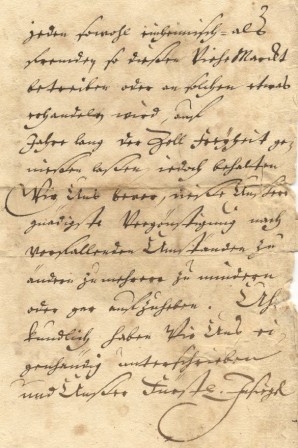
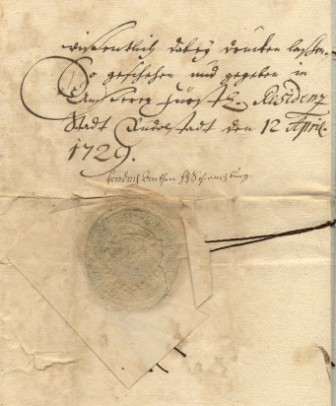
museum Neuhaus am Rennweg
Oberhof
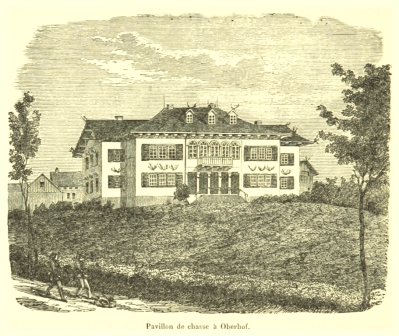





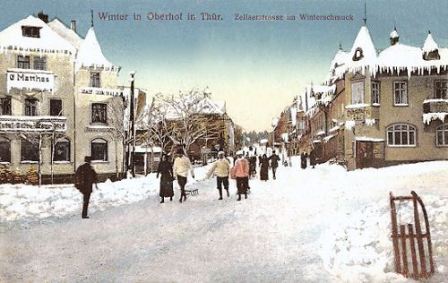








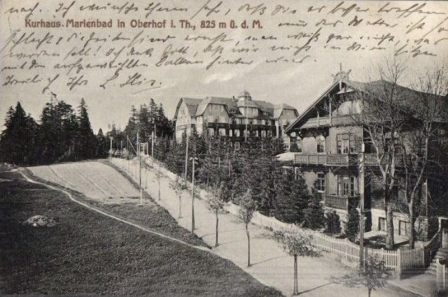




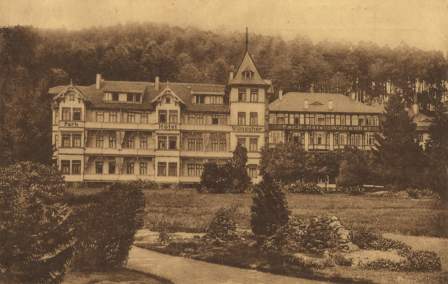











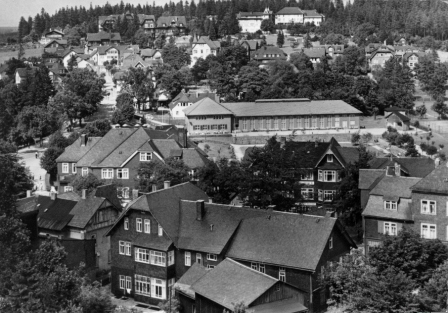




Plänckners Aussicht
Rennsteigkarte von Clemens Major
Rondell






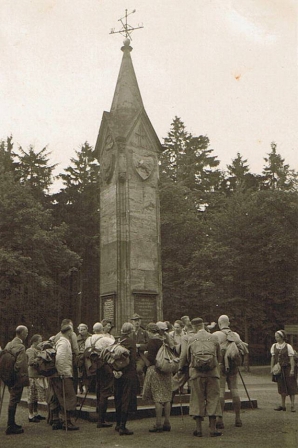

















Wachsenrasen
Die massiv errichtete Hütte wurde mit Porphyrsteinen gemauert. Die Hütte besteht aus einem überdachten Vorbau und einem Aufenthaltsraum der durch einen offenen Zugang über den Vorbau zu erreichen ist.
Zur Einweihungsfeier am 20.Juni 1909 waren aus der Umgebung zahlreiche Renner angereist. Die Festrede hielten Herr Weidinger aus Schmalkalden und Herr Landgerichtsrat Lincke, der Vorsitzende des Thüringerwald Vereins aus Eisenach. Von herzoglicher Seite (Grundeigentümer) war der Hofkammerpräsident von Bassewitz anwesend.


Wartburg
Kümpel, Constantin (1856 - 1942) -
Der Erbauer des Dreistromsteines

Am 11. Dezember 1856 wurde Constantin Kümpel in Steinach geboren. Sein Vater, Emil Kümpel (1813-1894), war zu diesem Zeitpunkt Oberförster in Steinach.
Einen Großteil seiner Kindheit verbrachte Constantin im nahe gelegenen Steinheid. Der Vater, sein großes Vorbild, nahm den Jungen oft mit in sein Revier. So lernte Kümpel die Natur kennen, beschäftigte sich mit der regionalen Geschichte und lauschte aufmerksam den Alten, wenn sie die alten Sagen und Märchen ihrer Steinheider Heimat erzählten.
Constantin Kümpel interessierte sich lebhaft für die Geschichte des Goldbergbaues in der Umgebung von Steinheid. Aus diesem Interesse heraus entstand auch 1927 sein historischer Roman „Bei den Goldsuchern“, ein Roman, der sich oftmals auf tatsächliche Begebenheiten des Goldbergbaues rund um Steinheid bezog.
Nach seinem Studium übte Kümpel den Beruf eines Lehrers aus. Von 1879 bis 1889 unterrichtete er an der Lauschaer Schule Mathematik. Danach war er bis 1910 Lehrer am Technikum in Hildburghausen.
Am 18. Februar 1879 heiratete Constantin Kümpel Ottilie Eichhorn. Aus dieser Ehe stammen 3 Söhne und 3 Töchter.
Zwei große Schicksalsschläge prägten in dieser Zeit sein weiteres Leben. Zunächst verlor er kurz hintereinander seine Töchter Else und Helene, die beide im Jahre 1906 an einer Lungeninfektion starben. Seine Frau konnte den Tod der beiden Töchter nie richtig verwinden. Sie starb am 05. Dezember 1909.
Daraufhin verließ Kümpel Hildburghausen. Er heiratete ein knappes Jahr nach dem Tod seiner Frau in Leipzig - Paunsdorf Frau Helene Kern - Grützner.
In Leipzig arbeitete Kümpel auch bis zu seiner Pensionierung als Lehrer.
Interessant für sein Wirken in der Steinheider Region sind die Jahre vor seinem Umzug nach Leipzig, also etwa von 1900 bis 1910.
In dieser Zeit befasste er sich neben seinen pädagogischen Aufgaben intensiv mit der lokalen Geschichte, der Geographie und der Geologie.
Besonderes Augenmerk richtete Kümpel auf das Siedlungsgebiet der Kelten auf den Gleichbergen und auf das Gebiet des damaligen Schießplatzes, auch als Saarzipfel bekannt.
Er griff den Gedanken des bekannten Alpenforschers Adolph Schaubach auf und regte den Bau eines Dreistromsteines an, dessen 100-jähriges Jubiläum wir heute feiern.
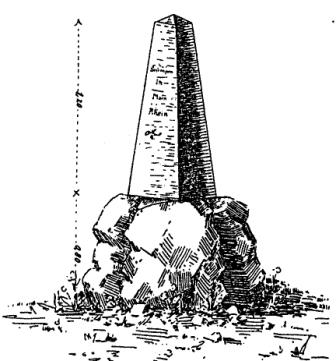

Der Plan von Kümpel (oben) und die Erinnerungstafel am Dreistromstein (unten)
Der konsequenten Verfolgung seines Zieles verdanken wir, dass seit dem Jahre 1906 auf jenem geschichtsträchtigen Platz am Saarzipfel, in unmittelbarer Nähe des legendären Dreiherrensteines ein Monument steht, das einmalig in Deutschland ist, der Dreistromstein.


Bild der Eröffnungsfeier im Jahre 1906 (oben), ein aktuelles Bild vom Dreistromstein am Rennsteig (unten)
Constantin Kümpel starb im Alter von 86 Jahren am 04. März 1942 in seiner neuen Leipziger Heimat.
Wie Ludwig Hertel, der damalige Fürsteher des Rennsteigvereins, war auch Constantin Kümpel, ebenfalls Mitglied in diesem Verein, Verfechter der Fehrenbacher Werraquelltheorie, was beiden die Missgunst der Siegmundsburger Bürger einbrachte. Vielleicht auch ein Grund, weswegen die Siegmundsburger nicht so zahlreich zur Steinweihe erschienen sind, als das die Presse darzustellen versuchte.
Trotzdem bringen derartige Dispute auf wissenschaftlicher Basis die Geschichtsforschung weiter. Indem man sich kritisch mit verschiedenen Auffassungen auseinander setzt, kommt man der Realität näher, erhält fundierte Erkenntnisse und sicherlich auch in absehbarer Zeit ein definitives Ergebnis.
Wenn wir kritisch forschen, handeln wir sicher im Sinne eines Mannes wie Constantin Kümpel, dem Erbauer des Dreistromsteines.
Major, Clemens
Clemens Major wurde am 31. Dezember 1847 in Annaberg geboren. Nach dem Tod seines Vaters verbrachte er seine Jugend seit 1852 bei seiner Mutter Caroline Wilhelmine in Lichtenstein, Am Tuchermarkt 3. Clemens wurde durch die kunstfertige Krippenschnitzerei seines Onkels Karl Major stark beeinflusst. So war es kein Wunder, dass er frühzeitig begann, kleine Figuren aus Lindenholz zu schnitzen.
Kartenbilder aus einem Atlas regten den 14-Jährigen an, ohne fremde Hilfe Wandkarten von Palästina zu zeichnen.
Diese künstlerische Neigung hatte für ihn entscheidende Bedeutung für sein weiteres Leben. Er wurde dem Gerichtsamtmann Hecker in Lichtenstein und dem Stadtrichter Werner in Callnberg vorgestellt. Letzerer war so begeistert von den kartographischen kartographischen Talenten des jungen Major, dass er die Wandkarte und einen aus Lindenholz geschnitzten Knaben mit einer entsprechenden Empfehlung an das Sächsische Kultusministerium nach Dresden schickte.
Major erhielt daraufhin unentgeltlich die Möglichkeit, die Realschule 1. Ordnung in Chemnitz zu besuchen. Aufgrund seiner außerordentlichen Begabung konnte er danach ein kostenloses Studium an der Akademie für bildende Künste in Dresden beim berühmten Bildhauer Prof. Ernst Hänel aufnehmen.
Ab 1872 arbeitete er 45 Jahre als Lehrer für Zeichnen und Modellieren an der Gewerbeschule in Sonneberg. Hier begann er für den Geographieunterricht Modelle zu gestalten. Als hervorragender Fachgeograph veröffentlichte er 1875 die "Deutschen Blätter für den erziehenden Unterricht".
Er hatte eine große Anzahl von Landkarten, die besonders das mitteldeutsche Gebiet darstellten, entworfen. Die Detailtreue und Genauigkeit machten sie zu Meisterwerken der Kartographie.
1913 wurde die 5-teilige Rennsteigkarte fertig, die im Auftrag des Rennsteigvereins 1896 e.V.seit 1910 entstand. Ihr folgte das ebenfalls 5-teilige Rennsteigprofil. Major wurde 1912 außerordentliches Mitglied des Rennsteigvereins, 1914 dann wurde er Ehrenmitglied.
Am 28. April 1930 starb Clemens Major in Sonneberg.
Nach ihm ist ein Gebietswanderweg rund um das Sonneberger Land benannt.
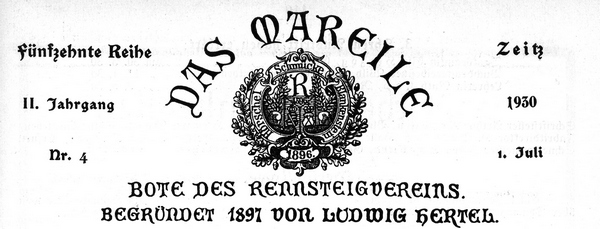
Nachruf auf Clemens Major im Mareile, dem Boten des Rennsteigvereins
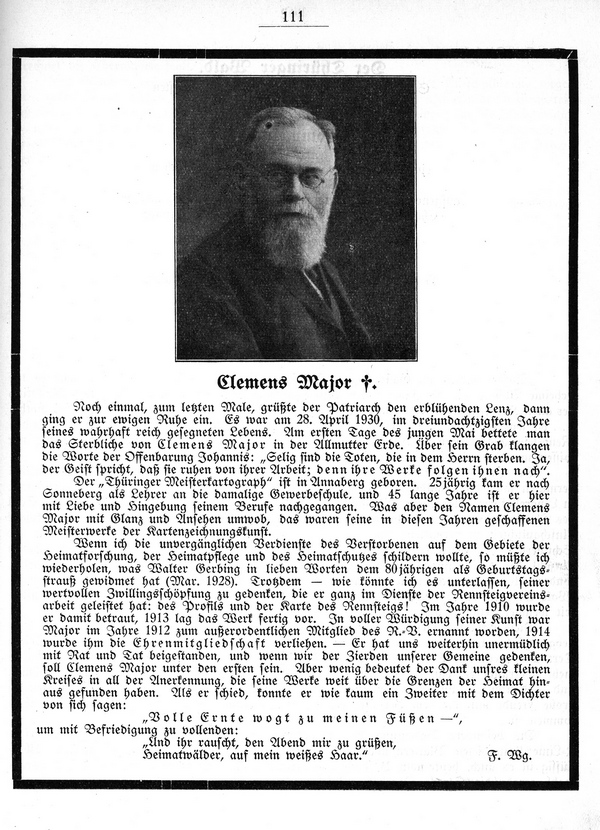
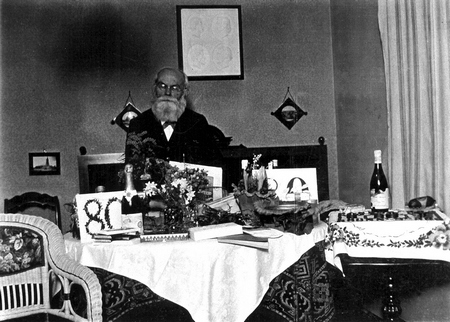
Clemens Major im Jahre 1927 zu seinem 80. Geburtstag
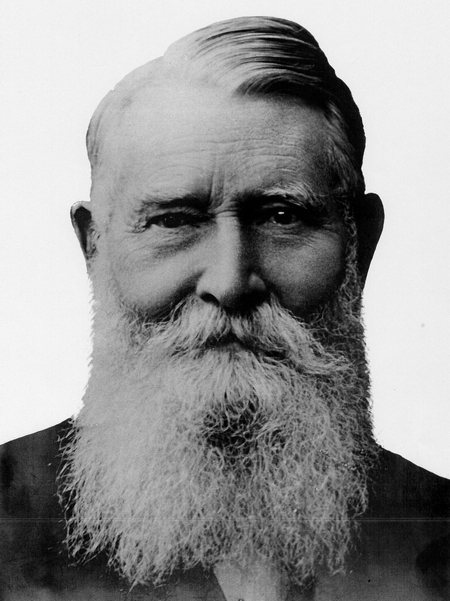
Clemens Major 1917
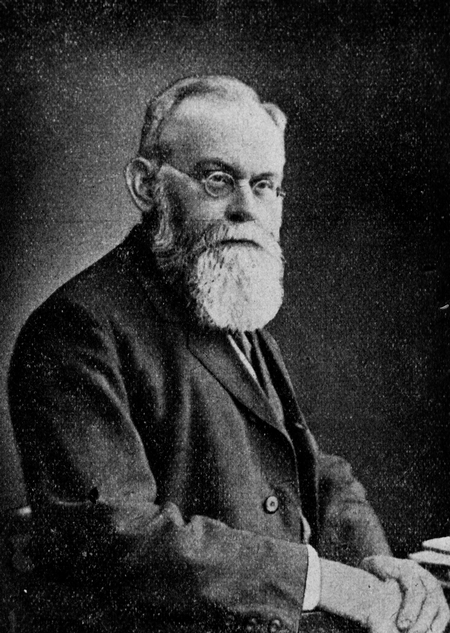
Clemens Major 1925
Korrekturhinweise von Clemens Major zu seiner 5-teiligen Rennsteigkarte, ein Brief an den Lithographen vom 14. Juli 1913
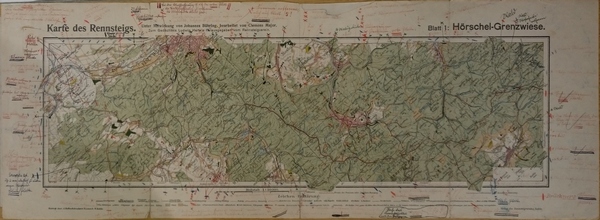
Monatsnamen, historisch
Da im deutschsprachigen Raum der aus dem Römischen Reich stammende Julianisch-Gregorianische Kalender übernommen wurde, sind auch die heute gebräuchlichen Monatsnamen lateinischen Ursprungs, und die meisten davon lassen sich auf den altrömischen Kalender zurückführen.
Verschiedentlich gab es Versuche, eigene Monatsbezeichnungen einzuführen, im deutschen Sprachraum beispielsweise durch Karl den Großen im 8. Jahrhundert, und noch einmal durch den Deutschen Sprachverein in den 1920er Jahren. Diese Bezeichnungen konnten sich aber nicht halten und spiegeln sich heute nur noch in der Poesie wieder (Wonnemonat Mai, der Lenz ist da usw.). Auch die Monatsnamen des französischen Revolutionskalenders, die wie die deutschen Monatsnamen auf Naturphänomenen und Jahreszeiten basierten, konnten sich nicht durchsetzen.
- Januar: (Hartung, Eismond, österreichisch wird dieser Monat ausschließlich Jänner genannt, im süddeutschen Sprachraum seltener)
Benannt nach Janus, dem Beschützer der Stadttore, Gott des Aus- und Einganges, im übertragenen Sinne des Anfangs und des Endes, dargestellt mit zwei Gesichtern, blickt nach zwei Seiten, nämlich vorwärts und rückwärts. lateinisch ianua „Schwelle“ (zum neuen Jahr).
- Februar: (Hornung, Schmelzmond, Taumond, Narrenmond, Rebmond, Hintester, österreichisch auch Feber, schweizerisch auch Horner)
Der Reinigungs- bzw. Sühnemonat, weil am Jahresende das Fest Februa zur Reinigung der Lebenden und die Sühnung der Verstorbenen vorgenommen wurde (lat. februare „reinigen“).
- März: (Lenzing, Lenzmond)Benannt nach Mars, dem Gott des Krieges und der Vegetation. Im altrömischen Kalender begann das Jahr mit dem März, daraus ergibt sich die Verschiebung der numerischen Monate September bis Dezember und dem Februar als Jahresende. Seit 153 v. Chr. traten in Rom die für ein Jahr gewählten Konsuln ihr Amt jeweils am 1. Januar an, der sich bald als Jahresbeginn einbürgerte.
- April: (Launing, Ostermond)
Wird abgeleitet von lat. aperire „öffnen“, der Monat der Öffnung bzw. des Aufblühens.
- Mai: (Winnemond (Weidemonat: heute zu Wonnemonat umgedeutet, auch Wonnemond), Blumenmond) Nach der römischen Göttin Maia benannt.
- Juni: (Brachet, Brachmond) Benannt nach Juno, einer römischen Gottheit, der die meisten Eigenschaften der griechischen Götterkönigin Hera übertragen wurden.
- Juli: (Heuet, Heuert, Heumond) Ursprünglich Quintilis, der „fünfte Monat“. Geburtsmonat Caesars (Gaius Julius Caesar). Nach ihm wurde dieser Monat seit 44 v. Chr. Julius genannt.
- August: (Ernting, Erntemond, Bisemond)
Dies war ursprünglich der sechste Monat, dementsprechend Sextilis genannt, des alten römischen Kalenders. Er wurde zu Ehren des ersten römischen Kaisers Augustus im Jahre 8 v. Chr. in Augustus umbenannt. 21 Jahre später, 14 n. Chr., wurde der August der Sterbemonat seines Namenspatrons. (Die Reihenfolge der Ereignisse scheint sonderbar, aber zumindest die letzte Jahreszahl darf als sicher gelten.)
- September: (Scheiding, Herbstmond) Der siebente Monat (lateinisch septem = „sieben“) im römischen Kalender. An diesem und den folgenden Monatsnamen kann man erkennen, dass man mit der Zählung ursprünglich im Monat März begann. Er sollte nach dem Kaiser Tiberius benannt werden.
- Oktober: (Gilbhart, Gilbhard, Weinmond) Der achte Monat (lat. octo = „acht“) nach dem römischen Kalender. Auch hier konnte sich die Bezeichnung Domitianus nicht durchsetzen.
- November: (Nebelung, Nebelmond, Windmond, Wintermond) Der neunte Monat (lat. novem = „neun“) nach dem römischen Kalender.
- Dezember: (Julmond, Heilmond, Christmond, Dustermond) Der zehnte Monat (lat. decem = „zehn“) nach dem römischen Kalender.
Notgeld
(wird laufend ergänzt)
Lehesten: November 1920, Juni 1921
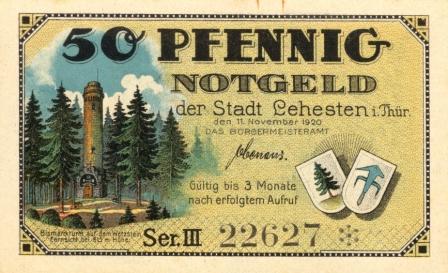
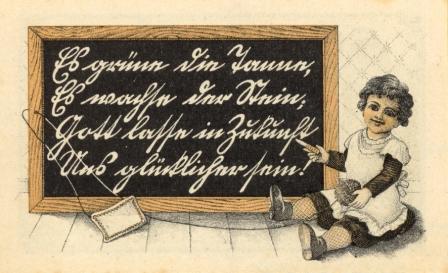
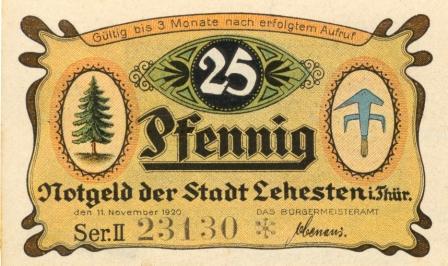

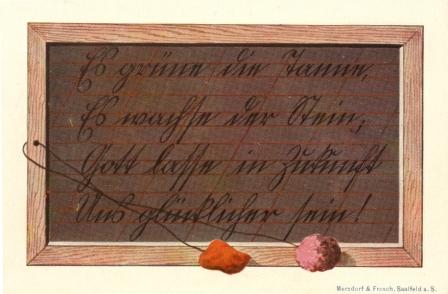
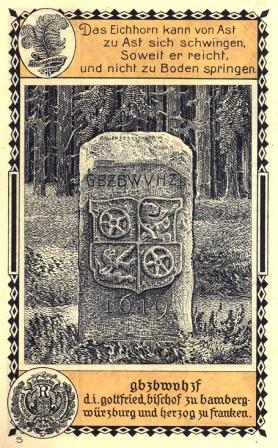
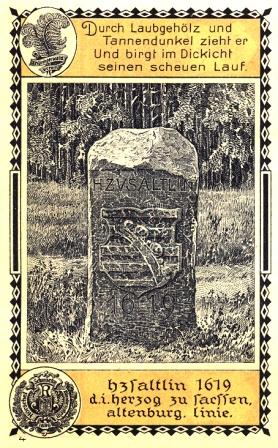
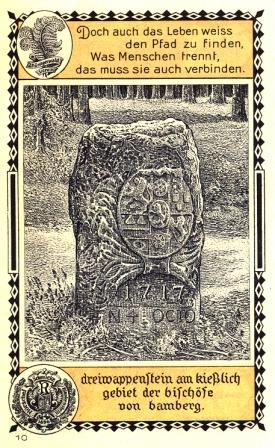
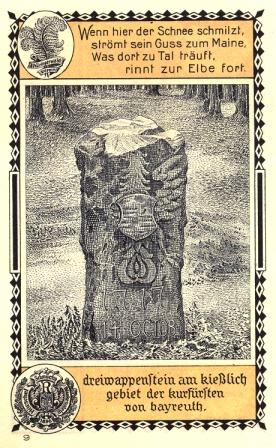
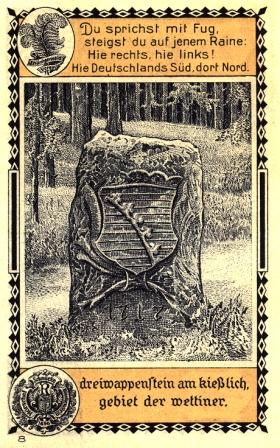
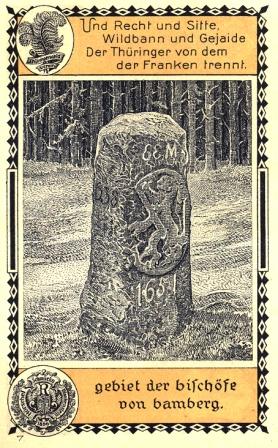
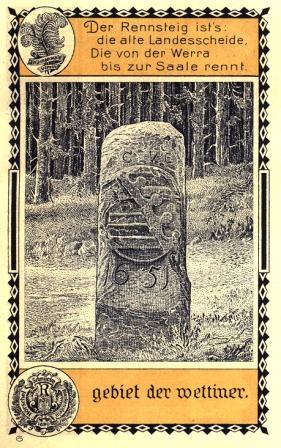
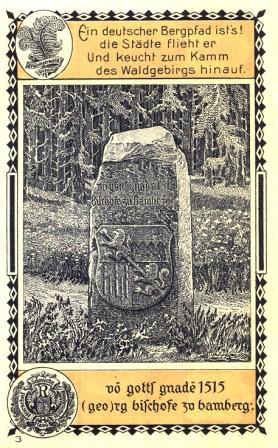

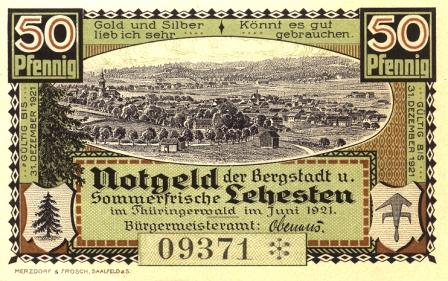
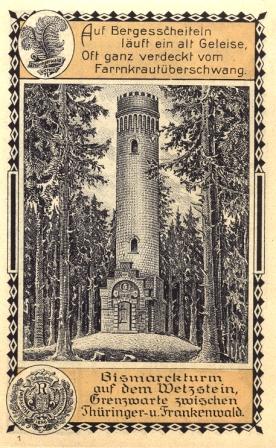
Besatzungsgeld (Alliierte Militärbehörde) 1944
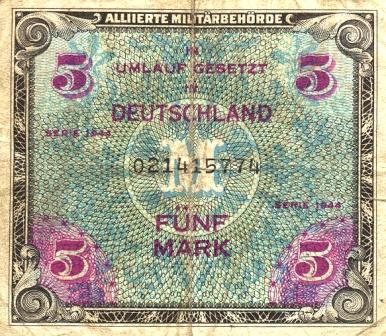

Oberhof: Dezember 1919, Oktober 1921
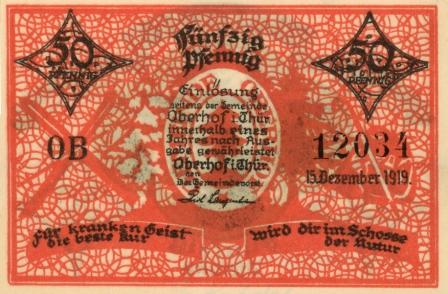
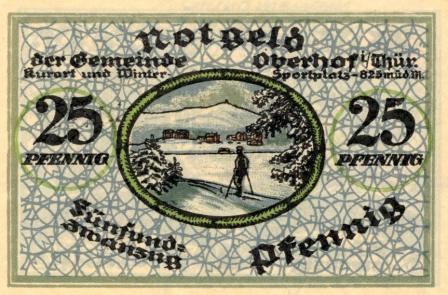
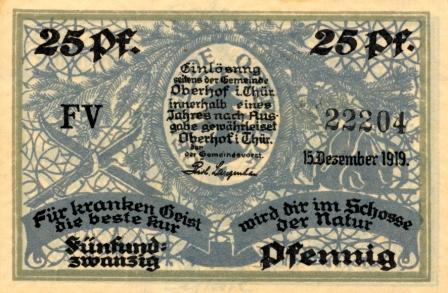


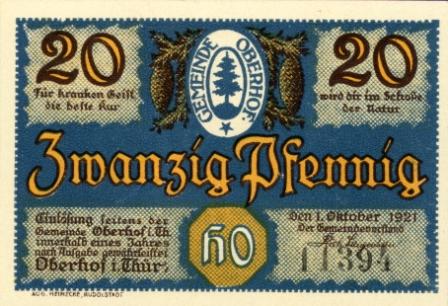



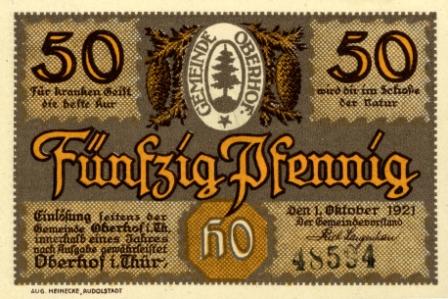
Neuhaus am Rennweg: Gutscheine, Notgeld 1921
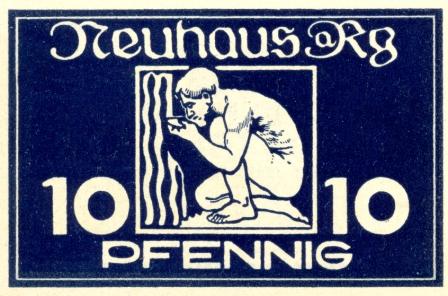

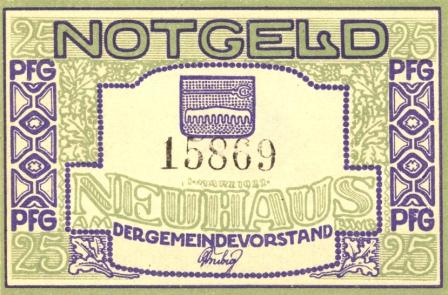
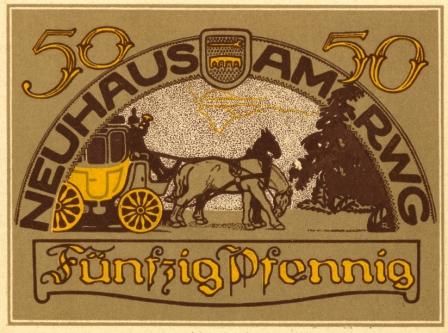
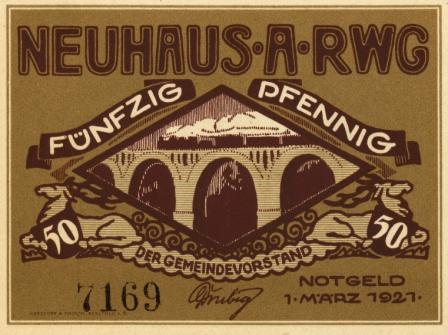
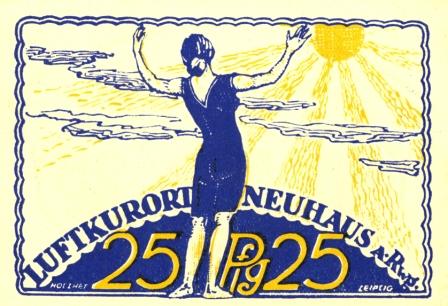

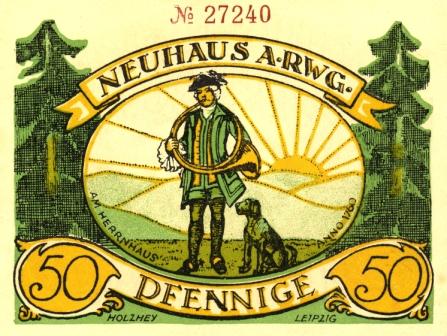
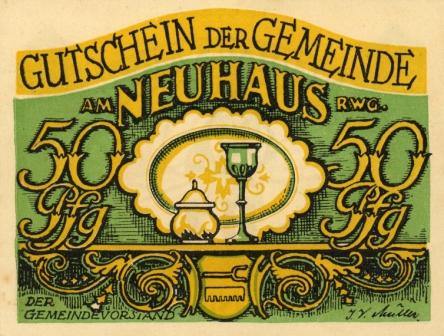

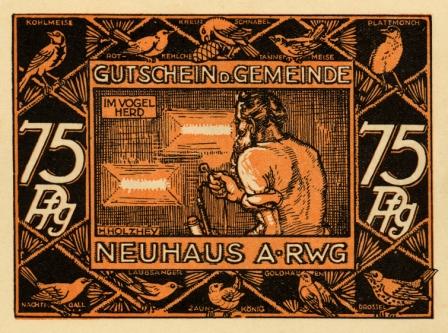
Gemeinde Blankenstein: August 1921
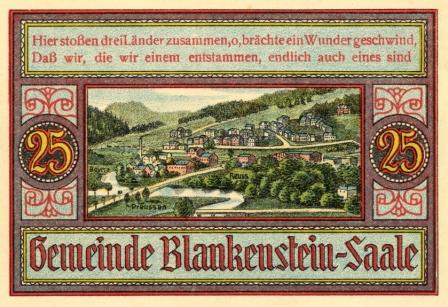



Gemeinde Steinheid: Notgeld 1920




Stadt Ruhla: Notgeld 01.04.1921
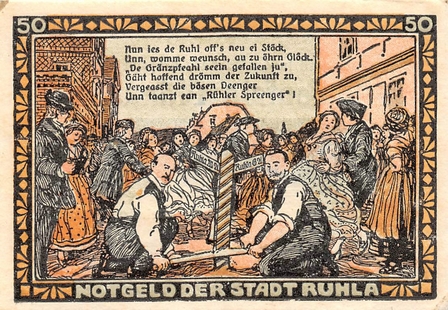

einheitliche Rücksteite für alle Scheine
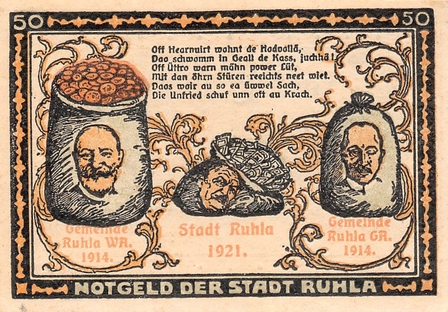
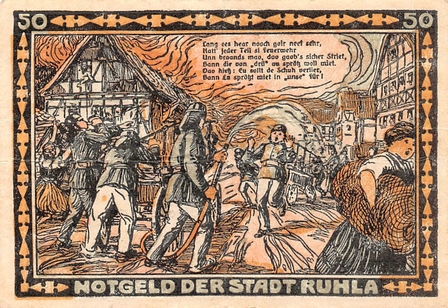
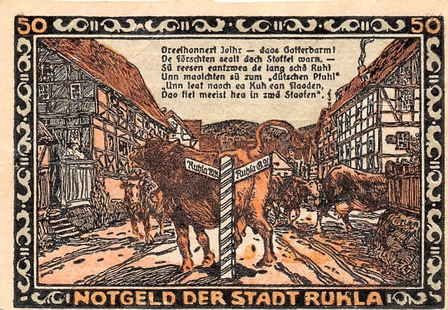
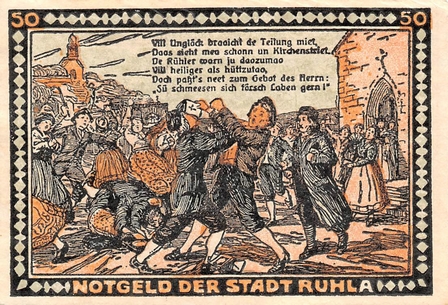
Stadt Ruhla: Kriegsnotgeld (01.02.1919)

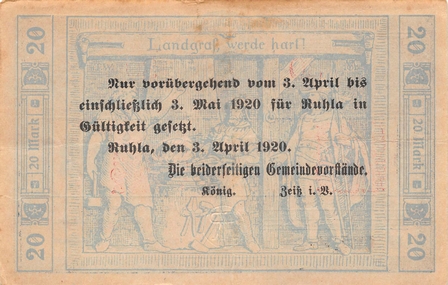
Gemeinde Stützerbach:
Gutscheine (preußischer Anteil) 1921

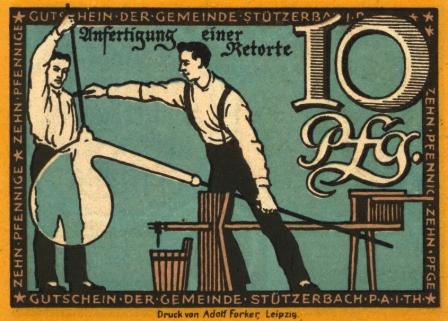
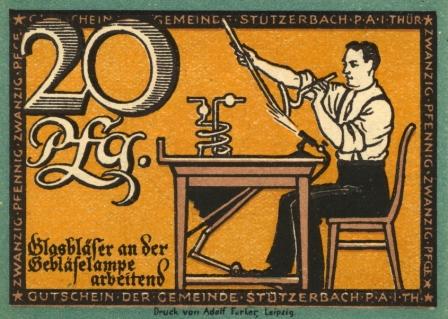
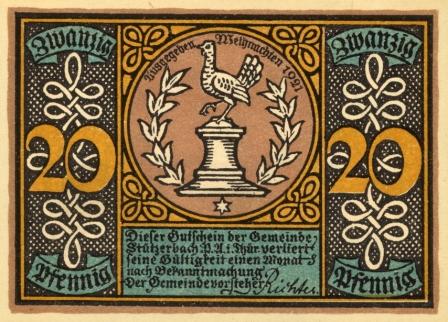



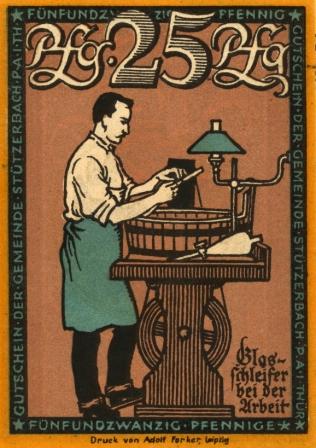

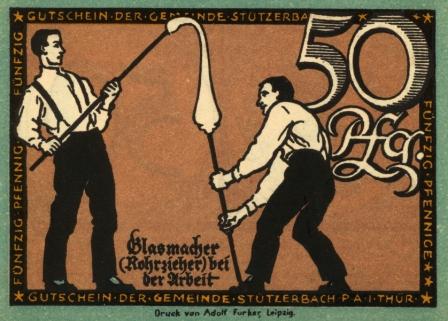

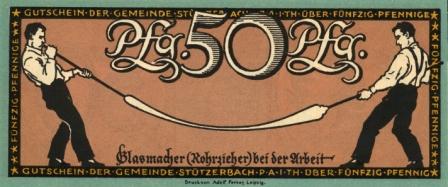
Gemeinde Stützerbach:
Notgeld (ehemals Sachsen Weimar) 1921

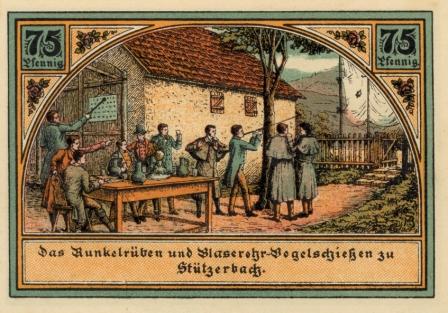
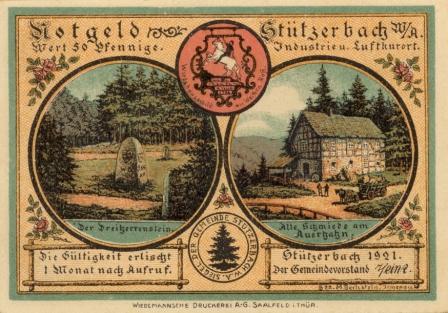
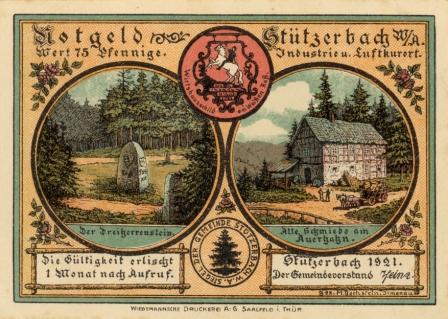
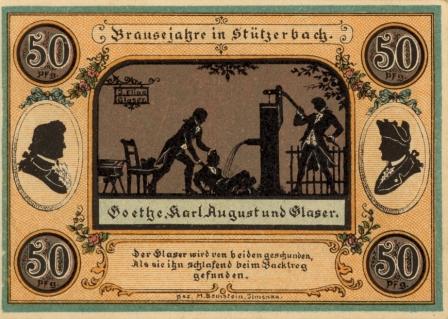
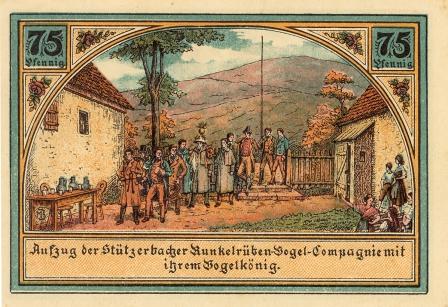
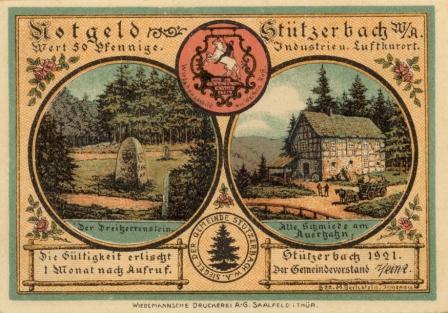
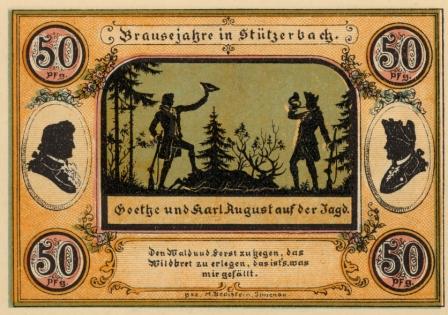
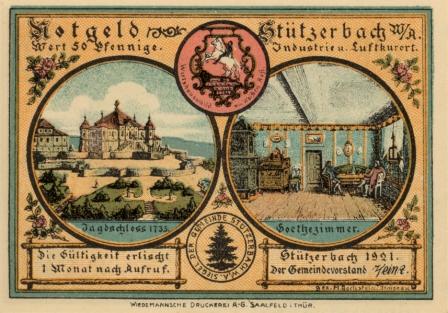
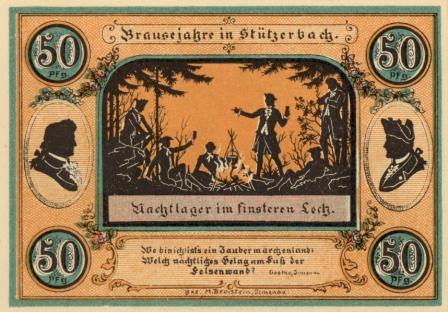
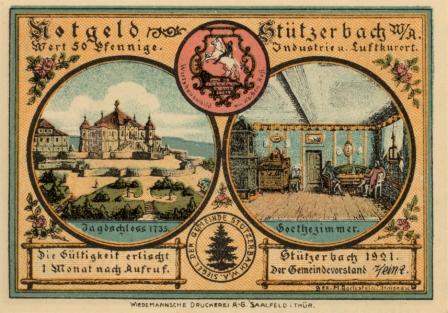


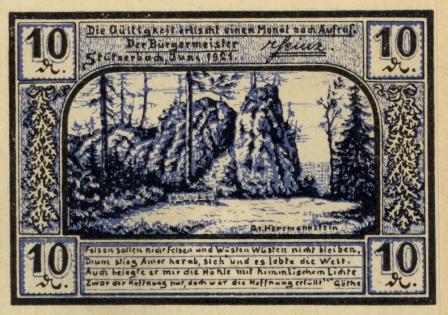

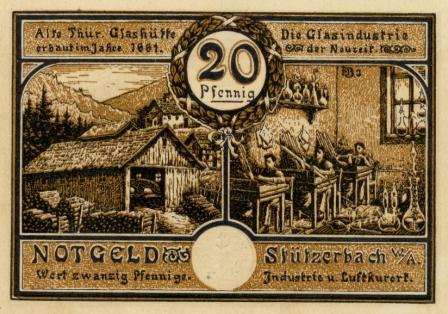
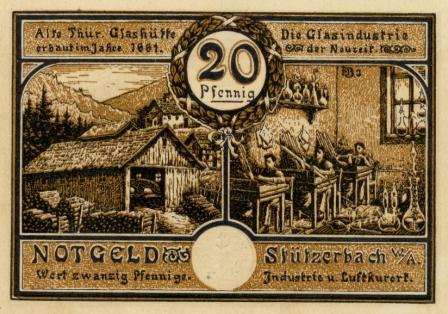
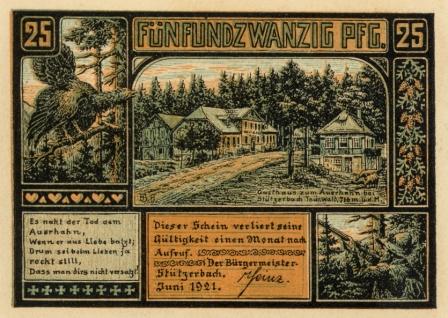


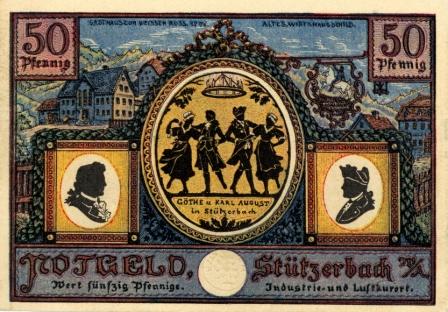
Gemeinde Igelshieb: Notgeld 1921
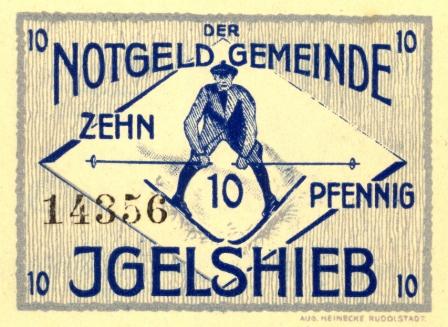
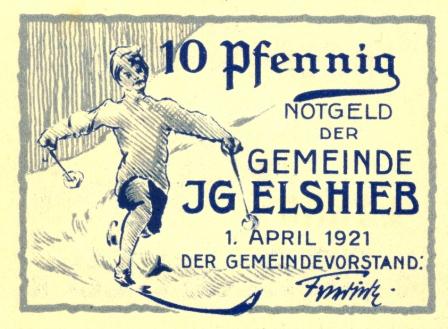


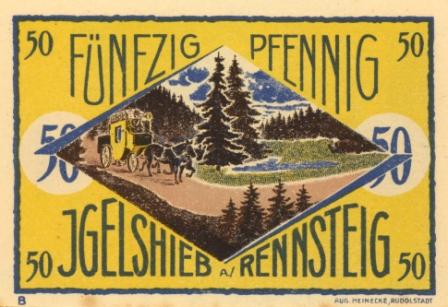
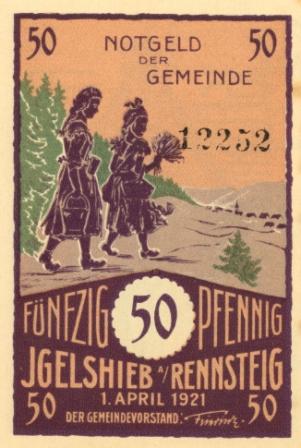

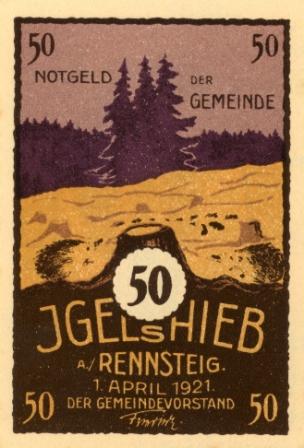
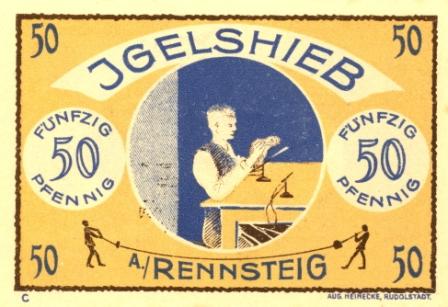

Schmiedefeld am Rennsteig: Notgeld 1921
In der Stückelung 1x 10 Pfg., 1x 20 Pfg., 1x 25 Pfg., 2x 50 Pfg.. Die Vorderseite zeigt jeweils ein Wappen der Gemeinde, mit Elementen der für den Ort typischen Industrie. Die Rückseite der Notgeldscheine ist unterschiedlich gestaltet und gibt einen Einblick in Handwerk und Gewerbe der Gemeinde. Interessant für den Rennsteig ist die Abbildung der Rennsteigbahn auf den 20 und 25 Pfg. Scheinen.
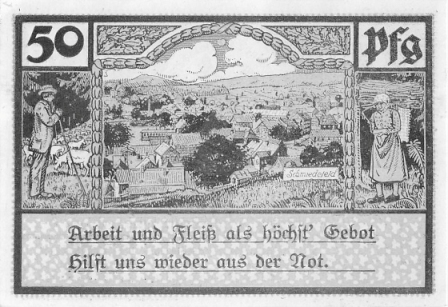
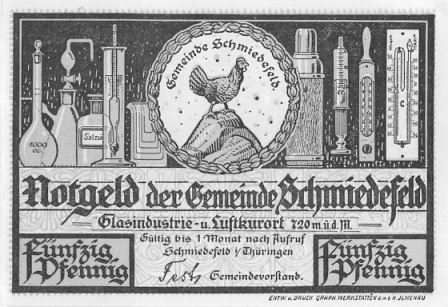

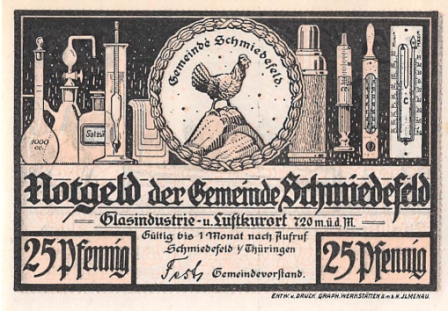
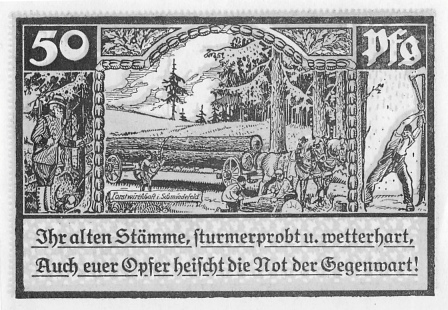

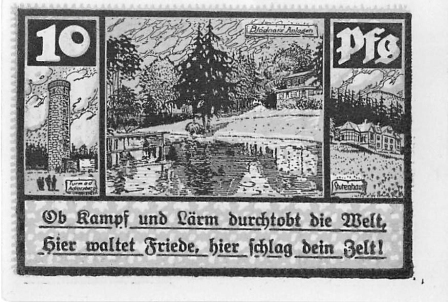

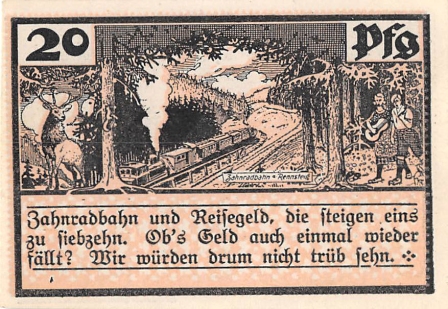

Rennsteigleiter
(Stand: August 2013)
Im Zuge des "Ganzjahreskonzept-Rennsteig" des Regionalverbundes sind derzeit 44 sogenannte Rennsteigleitern vorgesehen beziehungsweise bereits eingerichtet. Damit wird bezweckt, dass Ortschaften links und rechts in den Tallagen besser an den Höhenweg angebunden werden. Die Leitern erhalten ein einheitliches Logo, ein gelbes R auf weißem Spiegel und besonders gestaltete Wegweiser und Infotafeln.

Die besondere Hervorhebung von Zugangswegen zu einem Hauptwanderweg, ist keine thüringer Erfindung. Sie wird bereits erfolgreich beim Rothaarsteig genutzt, um die umliegenden Ortschaften mit ihren Sehenswürdigkeiten in das Erlebnis Fernwandern am Rothaarsteig mit einzubeziehen. Ähnlich wie beim Rennsteig wird hier auch eine gelbe Markierung verwendet, allerdings mit einem liegenden schwarzen R.
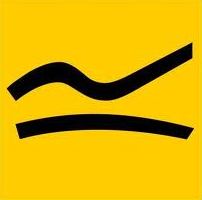
Auffällig ist, dass sowohl im äußersten westlichen und östlichen Rennsteigbereich keine Rennsteig-Leitern vorgesehen sind. Auch der bayerische Rennsteiganteil wurde nicht bedacht. Hier würden sich die Orte Tettau, Kleintettau und Ludwigsstadt, Lauenstein anbieten.
Folgende Rennsteigleitern laden ein, die nähere Umgebung des Höhenweges zu erkunden (in der Reihenfolge von Hörschel nach Blankenstein):
(1) Rennsteig-Leiter Eisenach
- Start: Eisenach, Marienthal
- Ziel: Rennsteig, Hohe Sonne
- Höhenlage: 254 - 426 m
- Länge: 3,6 km
- Dauer: 1 Stunde bis 2 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Begehbarkeit: ganzjährig, auf Wintersperre der Drachenschlucht achten
- Schwierigkeitsgrad: schwer
- Parken: Großparkplatz Phantasie oder Sophienau, Ortsausgang Mariental Hohe Sonne an der B19 oder Hohe Sonne
(2) Rennsteig-Leiter Wilhelmsthal
- Start: Wilhelmsthal B19
- Ziel: Rennsteig
- Höhenlage: 327 - 453 m
- Länge: 1,6 km
- Dauer: 0,5 -1 Stunde
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Parken: bei B19 Ortsausgang Wilhelmsthal, Jägerhof oder am Schloß Wilhelmsthal
(3) Rennsteig-Leiter Ruhla
- Start: Ruhla, Mini-a-thür
- Ziel: Rennsteig, Am Jubelhain
- Höhenlage: 435 - 560 m
- Länge: 2,3 km
- Dauer: 0,4 - 1 Stunde
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Parken: Parkplatz am Mini-a-thür in Ruhla
(4) Rennsteig-Leiter Bad Liebenstein-Schweina-Steinbach
- Start: Bad Liebenstein, Ortsteil Schweina
- Ziel: Rennsteig, Schillerbuche
- Höhenlage: 342 - 642 m
- Länge: 7,1 km
- Dauer: 2 - 3 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: leicht
- Parken: Parkplatz Altensteiner Höhle, Parkplatz Schillerbuche-Glasbach
(5) Rennsteig-Leiter Trusetal
- Start: Trusetal, Wasserfall
- Ziel: Rennsteig, Dreiherrenstein Am Großen Weißenberg
- Höhenlage: 506 - 740 m
- Länge: 9,1 km
- Dauer: 2,5 -3 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Parken: Wasserfall Trusetal, Dorfplatz Laudenbach, Hohe Klinge, begrenzt an der Waldbaude beim Dreiherrenstein (begrenzt, auf Wintersperre achten)
(6) Rennsteig-Leiter Brotterode
- Start: Brotterode, Bad-Vilbeler-Platz
- Ziel: Rennsteig, Brotteröder Hütte
- Höhenlage: 580 - 720 m
- Länge: 3,2 km
- Dauer: 1,5 - 2 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Parken: Parkplatz Breite Wiese, Ratsstrasse und Parkplätze am Ortseingang Brotterode, Axdorf

(7) Rennsteig-Leiter Tabarz
- Start: Wandertreff Tabarz
- Ziel: Grenzwiese, Rennsteig
- Höhenlage: 400 - 727 m
- Länge: 5,2 km
- Dauer: 1,5 - 2 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Parken: Theodor-Neubauer-Park, Lauchagrundstrasse, Grenzwiese (Kleiner Inselsberg)
(8) Rennsteig-Leiter Floh-Seligenthal-Schmalkalden
- Start: Schmalkalden, Technisches Museum Neue Hütte
- Ziel: Rennsteig, Ebertswiese
- Höhenlage: 370 - 780 m
- Länge: 11,2 km
- Dauer: 4 - 5 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Technisches Museum Neue Hütte, Parkplatz Radausspanne, Festplatz Seligenthal, Parkplatz Ebertswiese
(9) Rennsteig-Leiter Friedrichroda
- Start: Friedrichroda, Wandertreff
- Ziel: Rennsteig, Prinz-Andreas-Eck
- Höhenlage: 456 - 729 m
- Länge: 4,9 km
- Dauer: 1 - 2 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- im Tal Herzogsweg, Innenstadt Friedrichroda, Sportbad Friedrichroda, Heuberghaus
(10) Rennsteig-Leiter Tambach-Dietharz-Georgenthal
- Start: Georgenthal, Schlossplatz
- Ziel: Rennsteig, Alte Ausspanne
- Höhenlage: 380 - 742 m
- Länge: 11,2 km
- Dauer: 2,5 - 3 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Georgenthal: Am Kurpark (Schlaufweg), Tambacher Strasse, Haus des Gastes, Bahnhofstrasse, Rodebachmühle; Tambach-Dietharz: Tammichgrund, Festplatz Burgstallstrasse, Neue Ausspanne (z.Z. Bauarbeiten)
(11) Rennsteig-Leiter Rotterode
- Start: Rotteröder Höhe
- Ziel: Rennsteig, Neuhöfer Wiesen
- Höhenlage: 594 - 844 m
- Länge: 5,2 km
- Dauer: 1,5 - 2,5 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Rotteroder Höhe
(12) Rennsteig-Leiter Steinbach-Hallenberg
- Start: Steinbach-Hallenberg, Festplatz
- Ziel: Rennsteig, Grenzadler
- Höhenlage: 450 - 900 m
- Länge: 13,6 km
- Dauer: 3,5 - 4,5 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Festplatz Steinbach-Hallenberg, Grenzadler
(13) Rennsteig-Leiter Oberschönau
- Start: Oberschönau
- Ziel: Rennsteig, Gustav-Freytag-Stein
- Höhenlage: 600 - 887 m
- Länge: 6 km
- Dauer: 2 - 2,5 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Parkplatz vor der Gemeinde, Hauptstrasse
(14) Rennsteig-Leiter Luisenthal
- Start: Luisenthal, Wanderparkplatz
- Ziel: Rennsteig, Oberhof
- Höhenlage: 480 - 720 m
- Länge: 9,5 km
- Dauer: 2,5 - 3 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: komplett
- Kinderwagen geeignet: komplett
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Wanderparkplatz Ohratalsperre Luisenthal
(15) Rennsteig-Leiter Zella-Mehlis
- Start: Zella.Mehlis, Wanderparkplatz Lubenbach
- Ziel: Rennsteig, Rondell
- Höhenlage: 590 - 825 m ü.NN
- Länge: 6,8 km
- Dauer: 2,5 - 3 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Wanderparkplatz Lubenbachtal, Rondell
(16) Rennsteig-Leiter Gehlberg
- Start: Gehlberg, Parkplatz Museum
- Ziel: Rennsteig, Schmücke
- Höhenlage: 700 - 920 m
- Länge: 3,5 km
- Dauer: 1 - 1,5 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Gehlberg Museum, Am Ritter, Güldene Brücke, Schmücke
(17) Rennsteig-Leiter Suhl-Goldlauter-Heidersbach
- Start: Suhl-Goldlauter-Heidersbach
- Ziel: Rennsteig, Sommerbachskopf
- Höhenlage: 600 - 925 m ü.NN
- Länge: 3,7 km
- Dauer: 1 - 1,5 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Am Stockmarplatz, Suhl-Goldlauter-Heidersbach
(18) Rennsteig-Leiter Schmiedefeld am Rennsteig
- Start: Schmiedefeld am Rennsteig, Touristinformation
- Ziel: Rennsteig, Bahnhof Rennsteig
- Höhenlage: 640 - 770 m
- Länge: 2,4 km
- Dauer: 1 - 1,5 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Rennsteig Parkplatz, Bahnhof Rennsteig, Tourist Information Schmiedefeld a.R.

Rennsteigleiter Schmiedefeld, Bild: Manfred Kastner
Bahnhof Rennsteig, Bild: Ulrich Rüger
(19) Rennsteigleiter Ilmenau
- Start: Ilmenau
- Ziel: Rennsteig, Schmücke
- Höhenlage: 525 - 911 m
- Länge: 13,8 km
- Dauer: 3,5 - 4,5 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: leicht
- Erfurter Strasse, Lärcheneck, Schöffenhaus, Mönchhof, Schmücke
(20) Rennsteig-Leiter Manebach
- Start: Manebach
- Ziel: Rennsteig, Schmücke
- Höhenlage: 520 - 754 m
- Länge: 10 km
- Dauer: 2,5 - 3 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Bahnhof Manebach, Bahnhofstrasse, Mönchhof, Schmücke
(21) Rennsteig-Leiter Stützerbach
- Start: Stützerbach, Haus des Gastes
- Ziel: Rennsteig, Bahnhof Rennsteig
- Höhenlage: 590 - 747 m
- Länge: 3,6 km
- Dauer: 1,5 - 2 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: leicht
- Hüttenplatz, Glaswerk, Massenmühle
(22) Rennsteig-Leiter Frauenwald
- Start: Frauenwald, Monument
- Ziel: Allzunah, Alter Bahnhof
- Höhenlage: 761 - 765 m
- Länge: 1,4 km
- Dauer: 0,5 - 1,5 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: leicht
- Frauenwald, Allzunah
(23) Rennsteig-Leiter Langewiesen
- Start: Langewiesen, Heinse-Haus
- Ziel: Rennsteig, Großer Dreiherrenstein
- Höhenlage: 443 - 811 m
- Länge: 11 km
- Dauer: 3 - 4 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Langewiesen Rathaus, Großer Dreiherrenstein
(24) Rennsteig-Leiter Schönbrunn
- Start: Schönbrunn
- Ziel: Rennsteig, Großer Dreiherrenstein
- Höhenlage: 450 - 822 m
- Länge: 13,5 km
- Dauer: 3,5 - 4,5 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: teilweise
- Kinderwagen geeignet: teilweise
- Schwierigkeitsgrad: leicht
- Schönbrunn Parkplatz Schnetter Strasse, Großer Dreiherrenstein
(25) Rennsteig-Leiter Oehrenstock
- Start: Oehrenstock, Sportplatz
- Ziel: Rennsteig, Großer Dreiherrenstein
- Höhenlage: 443 - 811 m
- Länge: 8 km
- Dauer: 2 - 3 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Oehrenstock Sportplatz, Großer Dreiherrenstein
(26) Rennsteig-Leiter Großbreitenbach
- Start: Großbreitenbach
- Ziel: Rennsteig, Neustadt am Rennsteig
- Höhenlage: 650 - 797 m
- Länge: 5,5 km
- Dauer: 1,5 - 2 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: leicht
- Parkplatz Ortseingang aus Richtung Ilmenau
(27) Rennsteig-Leiter Altenfeld
- Start: Altenfeld am Bürgerhaus
- Ziel: Rennsteig, Hoher Stock
- Höhenlage: 600 - 761 m
- Länge: 2,6 km
- Dauer: 1 Stunde
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Bürgerhaus, Haus des Gastes, Hoher Stock
(28) Rennsteig-Leiter Gießübel
- Start: Gießübel
- Ziel: Rennsteig, Hoher Stock
- Höhenlage: 588 - 759 m
- Länge: 3,3 km
- Dauer: 1 - 1,5 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Gießübel am Vereinshaus, Rennsteig am Hohen Stock
(29) Rennsteig-Leiter Heubach
- Start: Heubach
- Ziel: Bergstation am Ersteberg (Skihang)
- Höhenlage: 718 - 830 m
- Länge: 2,7 km
- Dauer: 1 - 2 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: leicht
- Sportplatz Heubach, Lindner Hotel, Masserberg
(30) Rennsteig-Leiter Schnett
- Start: Schnett
- Ziel: Bergstation Ersteberg (Skihang)
- Höhenlage: 718 - 830 m
- Länge: 5,4 km
- Dauer: 2 - 3 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: leicht
- Schnett, Masserberg
(31) Rennsteig-Leiter Fehrenbach
- Start: Fehrenbach
- Ziel: Rennsteig, Heidehütte, Dreiherrenstein Hohe Heide
- Höhenlage: 588 - 818 m
- Länge: 4,4 km
- Dauer: 1,5 -2,5 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Fehrenbach, Ortslage, Hinweise beachten



Rennsteigleiter Fehrenbach: endet am Rennsteig bei der Hohen Heide, Bilder: Portal Hohe Heide
(32) Rennsteig-Leiter Waffenrod
- Start: Waffenrod, Freizeitpark
- Ziel: Rennsteig, Eisfelder Ausspanne
- Höhenlage: 700 - 800 m
- Länge: 10,1 km
- Dauer: 2,5 - 3,5 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Freizeitpark Waffenrod


(33) Rennsteig-Leiter Sachsenbrunn
- Start: Sachsenbrunn, Sophienau
- Ziel: Rennsteig, Eisfelder Ausspanne
- Höhenlage: 509 - 748 m
- Länge: 6,4 km
- Dauer: 3 - 4 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Sophienau, Nähe Sportplatz
- Bildnachweis, wie Leiter 32
(34) Rennsteig-Leiter Katzhütte-Goldisthal-Scheibe-Alsbach
- Start: Katzhütte, Herrenhaus
- Ziel: Rennsteig, Limbach
- Höhenlage: 435 - 825 m
- Länge: 16,9 km
- Dauer: 5 - 6 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Katzhütte Marktplatz oder Eisenwerkstraße, Limbach (kostenpflichtig)
(35) Rennsteig-Leiter Effelder-Rauenstein
- Start: Rauenstein
- Ziel: Rennsteig, Limbach
- Höhenlage: 575 - 751 m
- Länge: 11,6 km
- Dauer: 4 -5 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Rauenstein: Am Bahnhof, Schaumberger Platz, Am Wasserbassin; Limbach (kostenpflichtig)
(36) Rennsteig-Leiter Steinach
- Start: Steinach, Marktplatz
- Ziel: Rennsteig, Limbach
- Höhenlage: 492 - 860 m
- Länge: 14,1 km
- Dauer: 3,5 - 4,5 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Steinach Marktplatz, Mittelstation Skiarena Silbersattel, Limbach (kostenpflichtig)
(37) Rennsteig-Leiter Mengersgereuth-Hämmern
- Start: Mengersgereuth-Hämmern, Augustenthal
- Ziel: Rennsteig, Limbach
- Höhenlage: 545 - 837 m
- Länge: 15 km
- Dauer: 4 - 5 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: schwer
- Augustenthal, Limbach (kostenpflichtig)
(38) Rennsteig-Leiter Oberweißbach
- Start: Oberweißbach, Turmweg
- Ziel: Rennsteig, Neuhaus am Rennweg
- Höhenlage: 650 - 825 m
- Länge: 11,6 km
- Dauer: 3 - 4 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: leicht
- Oberweißbach Parkplatz Markt, Parkplatz Schule, Fröbelstrasse, Parkplatz Fröbelturm; Neuhaus am Rennweg in der Ortslage (teilweise kostenpflichtig)
(39) Rennsteig-Leiter Lauscha
- Start: Lauscha
- Ziel: Rennsteig, Ernstthal
- Höhenlage: 625 - 777 m
- Länge: 2,5 km
- Dauer: 1 - 1,5 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Lauscha Hüttenplatz, Henriettenthal; Ernstthal Ortslage oder Wintersprtehrenmal

(40) Rennsteig-Leiter Lichte-Piesau-Schmiedefeld
- Start: Schmiedefeld, Lichte
- Ziel: Triniusblick, Nähe Brand
- Höhenlage: 631 - 820 m
- Länge: 8,5 km
- Dauer: 3 - 4 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: leicht
- Tourismusbüro Lichtetal am Rennsteig, Gasthof am Brand

(41) Rennsteig-Leiter Gräfenthal
- Start: Gräfenthal, Markt
- Ziel: Rennsteig, Kalte Küche
- Höhenlage: 400 - 725 m
- Länge: 5,4 km
- Dauer: 1,5 - 2 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Grund
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Innenstadt Gräfenthal, Kalte Küche
(42) Rennsteig-Leiter Lehesten
- Start: Lehesten
- Ziel: Rennsteig, Kreuzung Schönwappenweg
- Höhenlage: 630 - 720 m
- Länge: 5,2 km
- Dauer: 1,5 - 2,5 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Stadtgebiet, Schieferpark, Ziegelhütte


(43) Rennsteig-Leiter Wurzbach
- Start: Wurzbach, Marktplatz
- Ziel: Rennsteig, Grumbach
- Höhenlage: 530 - 698 m
- Länge: 6,8 km
- Dauer: 2 - 3 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Marktplatz, Parkplatz gegenüber Friedhof, Grumbach Friedhof, Silo
(44) Rennsteig-Leiter Bad Lobenstein
- Start: Bad Lobenstein, Ardesia-Therme
- Ziel: Rennsteig, Am Kulmberg
- Höhenlage: 490 - 677 m
- Länge: 5,9 km
- Dauer: 1,5 -2,5 Stunden
- Markierung: gelbes R auf weißem Spiegel
- Barrierefrei: nein
- Kinderwagen geeignet: nein
- Schwierigkeitsgrad: mittel
- Ardesia-Therme, Parkflächen am Lemnitzbach, vor ehemaligem Steinbruch (außer Betrieb)

(Angaben ohne Gewähr)
Rennsteigstein
Im Grunde genommen ist die Wortwahl Rennsteigstein nicht korrekt, weil dieser Begriff alle am Rennsteig vorkommenden Steine, insbesondere auch die so
genannten Markierungssteine mit dem berühmten weißen R einschließt, obwohl im eigentlichen Sinne aber die Grenzsteine gemeint sind.
Wenn wir die Grenzsteine korrekt bezeichnen wollen, müssen wir von Rennsteiggrenzsteinen oder Länder- und Ämtergrenzsteinen sprechen.
Arbeitsschritte der Erfassung und Sanierung Am Beginn einer sinnvollen Erfassung und Inventarisierung des Denkmales Rennsteig stehen zunächst organisatorische Aufgaben. Um gesicherte Ergebnisse zu erhalten, muss ich über folgende Punkte Klarheit verschaffen:
- Was und in welchem Umfang will ich erfassen
- In welchen Zeiträumen und welchen Intervallen soll die Erfassung stattfinden
- Welcher Personenkreis ist für eine optimale Arbeit erforderlich
- Welche technischen Vorraussetzungen benötige ich
- Welche öffentliche Einrichtungen müssen informiert oder beteiligt werden
- Welche rechtlichen Grundlagen sind zu beachten
- Wie soll die Auswertung erfolgen
- Wer ist an den Auswerteergebnissen interessiert
- Grenzsteine bilden den Hauptanteil des erfassungswürdigen Inventars



Was wir vorgefunden haben: Beispiele beschädigter Grenzsteine im Neuhäuser Raum
Der nächste Arbeitsschritt bestand in der Schaffung geeigneter Festpunkte im Landeskoordinatensystem, mit deren Hilfe anschließend das Rennsteiginventar mit einer entsprechenden Genauigkeit eingemessen wurde. In diesem Fall nutzten wir traditionelle Methoden wie Polygonierung oder polare Aufnahme, aber auch moderne GPS - Messmethoden kamen zum Einsatz. Beide Möglichkeiten wurden im Rahmen der Lehrausbildung eingesetzt, was bei den Auszubildenden auch großes Interesse weckte. Natürlich wurden auch bereits früher entstandene Katasterfestpunkte mit verwendet. Bei den Arbeiten zeigte sich, dass in unübersichtlichen Waldgebieten eine gute Sicherung der Punkte, sowie die Beachtung der jahreszeitlich bedingten Vegetationsunterschiede wichtig ist. Beachtet werden musste auch eine mögliche Verwendung der neu geschaffenen Punkte für eventuelle Folgemessungen.
Nachdem alle Festpunkte kontrolliert worden sind, konnte mit der eigentlichen Vermessung der historischen Grenzsteine begonnen werden. Durch diese Hauptvermessung aller örtlich sichtbaren Steine wurden exakte Koordinatenwerte bestimmt. Bei der anschließenden Auswertung der Katasternachweise wurden die vorher ermittelten Koordinaten zur Bestimmung der Lage der noch fehlenden Steine benötigt. Je nachdem, wie „genau“ die Katasternachweise vorlagen, fielen auch die Suchergebnisse aus. Hier lag die „Trefferquote“ bei ca. 10 %, wobei sich dieser Wert sowohl auf das Auffinden von kompletten Steinen, als auch nur auf Sockelreste bezog.
Weitere Hinweise auf den Verbleib der Steine waren durch Studium der zugänglichen Literatur und Archivunterlagen (Gemeinden, Forstämter, Kirchen, Vereine, Museen) zu erhalten. Oft konnten auch Anwohner wertvolle Hinweise geben. Über die wichtigsten Phasen dieser Arbeiten wurden Bilddokumente gefertigt und Abmarkungsprotokolle erstellt.
Zum Abschluss erfolgte die fotografische Aufnahme des Inventars als komplettes Bilddokument. Die Auswertungsergebnisse wurden als Katalog zusammengefasst.
Nachfolgend sind im Turnus von zwei Jahren Inventuren durchzuführen. Dabei ist auf Zustand und Vollständigkeit zu kontrollieren und zu protokollieren. Die Auswerteprotokolle sind den Denkmalschutzbehörden und den Katasterämtern zur Verfügung zu stellen.
Nun mag der Eine oder Andere fragen, warum dieser Aufwand und welchen Nutzen hat er, bei all den vielen anderen täglichen Problemen, welche weit wichtiger erscheinen. Ein wichtigstes Gegenargument ist der gesetzlich geregelte Schutz des kulturellen Erbes. Mindestens genau so wichtig ist aber auch der ökonomische Aspekt des Tourismus. Gerade die Rennsteigregion lebt vom Fremdenverkehr und der damit verbundenen Wanderbewegung. Der Allgemeinzustand sowie sämtliche Bestandteile dieser Gesamtheit bilden den Rahmen für eine dringend notwendige - und funktionierende - Infrastruktur. Nicht ohne Grund sind die zahlreich vorhandenen Rennsteiggrenzsteine als Sinnbild auf vielen Darstellungen in Verbindung mit diesem Höhenweg anzutreffen. Eine fehlende Würdigung der Steine wäre äußerst fatal für den Bestand. Schnell wären sie dem Verlust durch Denkmalschänder oder rücksichtsloser ökonomischer Interessen preisgegeben. Dadurch leidet automatisch die Infrastruktur - und das soll verhindert werden.
Sanierungsarbeiten und technische Lösungen bei der Sanierung von Grenzsteinen
Ausgehend von vorher beschriebenen Arbeitsschritten, war es erforderlich, bestimmte Grenzsteine zu sanieren. Je nach dem Grad der Beschädigung richtete
sich auch der Umfang der Sanierungsmaßnahmen. Im einfachsten Fall werden die Steine am Originalstandort gerichtet. Das sind häufig Arbeiten, welche nach vorheriger Absprache mit den Katasterämtern und der Denkmalbehörde von interessierten Bürgern oder Vereinen ausgeführt werden können.
Wenn ein vorhandener Stein zwar gerade steht, aber aus irgendeinen Grund vom Originalstandort versetzt wurde, wurde versucht nach Möglichkeit den Stein wieder am Originalstandort aufzustellen. War das aber aufgrund von zwischenzeitlichen Bebauungen nicht mehr möglich, erhielt der Stein einen sicheren Ausweichstandort.
Liegende Steine wurden wieder aufgerichtet, nachdem der Standort geprüft wurde. Fehlende Steine wurden ausnahmsweise nur an exponierten Stellen ersetzt, um die Sicherheit über den Verlauf des Wanderweges „Rennsteig“ zu gewährleisten. Ersetzt wurde auch nur dann, wenn ein Stein zur Verfügung stand und dieser zweifelsfrei anhand historischer Aufzeichnungen rekonstruiert werden konnte.
Abgebrochene Steine und in mehrere Teile zerbrochene Steine erforderten besondere Sorgfalt bei der beabsichtigten Sanierung. Folgende Technologie hatte sich dabei bewährt: Zunächst wurden die noch vorhandenen Teile des Steines sorgfältig gesäubert und vorerst trocken zusammengebaut. Dabei wurden die zusammengehörigen Bruchflächen mit gleicher Symbolik gekennzeichnet, um beim späteren Zusammenbau übersichtlicher arbeiten zu können. Der Sockel wurde am vorausberechneten oder bekannten Standort gerade und fest eingebaut, dazu wurden sogenannte „Lagersteine“ zum Verkeilen verwendet. Eine alte Steinsetzerweisheit besagt scherzend:
Wenn du einen Stein setzt, muss die Erde im Steinlager so verdichtet werden, dass
hinterher welche fehlt, dann sitzt der Stein wirklich fest.
Bei der anschließenden Dübelung des Steines musste sehr sauber und korrekt gearbeitet werden. Beim Zusammensetzen der einzelnen Steinteile müssen diese genau zusammenpassen, nicht verrutschen oder verkanten. Es wurden ein bis zwei Stahldübel mit ca. 10 bis 15 cm Länge und einem Durchmesser von 12 mm verwendet (Bewehrungsstahl, geriffelt). Auch nach dem Einbringen der Bohrlöcher wurde mit den lose eingeführten Dübeln eine Passprobe durchgeführt. Geringfügige Verdrehungen konnten so noch durch eventuell größere Bohrlöcher ausgeglichen werden. Zur Befestigung der Dübel wurden Zweikomponentenepoxitharzkleber oder sogenannter Schnellreparaturzement verwendet.
Die Dübelung erfolgte zuerst am Kopfteil des Steines. Nach der Aushärtung der Dübelmasse wurde die Mörtelfuge auf die gut gereinigte Bruchstelle des Sockelstückes aufgetragen (ca. 3 bis 5 mm stark). Das Bohrloch wurde zu 2 Drittel seiner Tiefe mit Dübelmasse gefüllt. Anschließend wurden beide Steinteile zusammengesetzt. Durch das hohe Eigengewicht der Steinteile war ein zusätzlicher Druck nicht erforderlich. Die Fugen wurden danach sauber verstrichen. Nach dem Aushärten erfolgte noch ein abschließendes Verschleifen der Bruchstellen und Überstände.
Dabei sollte auf jedem Fall auf die vorhandene Steinstruktur Rücksicht genommen werden, damit das natürliche Aussehen erhalten bleibt. Tief sitzende Bruchstellen wurden unter der Erdoberfläche belassen. Bei Steinen mit besonderem Denkmalwert (Wappensteine) wurde auch das Umfeld des Steines gestaltet. Von einer Konservierung der Steine wird in diesem Zusammenhang abgeraten, da Langzeitversuche in Bezug auf das Gesamtalter der Steine nicht vorliegen und somit der Beweis einer positiven Wirkung der Konservierung nicht erbracht ist.
Laborversuche können nicht den Schutzeffekt bringen, welchen sich der Sandstein im Laufe der Jahrhunderte auf natürliche Weise selbst aufgebaut hat. Der Beweis ist in der Örtlichkeit sichtbar. Sogar einige der ältesten Steine haben bis auf einige mechanische Beschädigungen noch ein sehr gutes Aussehen.
Auch das Setzen von Steinattrappen an Stelle der Originalsteine wird abgelehnt.
Historische Grenzsteine sind Zeitzeugen, die eine bestimmte Standortbindung haben und durch Steinsatzprotokolle einen gewissen gesetzlichen Schutz genießen. Durch die Einlagerung in Museen verliert der Standort des Steines an Bedeutung und wird automatisch vernachlässigt.
Das Setzen eines Ersatzes kann darüber nicht hinwegtäuschen und würdigt den Katasternachweis nicht mit dem nötigen Respekt.
Grenzsteininventuren
Steininventuren gibt es, seitdem Grenzsteine gesetzt werden. Die Formen dieser Inventuren waren und sind sehr vielschichtig. Regelmäßig nach dem Steinsatz wurden Grenzbesichtigungen durchgeführt, die von einer gemeinsamen Kommission der betroffenen Nachbarstaaten beaufsichtigt wurden. Dabei wurde der Zustand der Grenze beschrieben, schadhafte Steine erneuert und bei Bedarf an unübersichtlichen Stellen neue Steine gesetzt.
Die älteste zugängliche Untersuchung dieser Art stammt aus dem Jahre 1453. Im Zuge einer Grenzuntersuchung im Jahre 1548 wurde wahrscheinlich auch der Dreiherrenstein Hoher Lach in Igelshieb gesetzt. Die bis dahin als Grenzmarkierung dienende Buche (Schnebelichte Buche), kam in die Jahre und war offenbar als Grenz- oder Lachbaum nicht mehr dienlich. Der Dreiherrenstein trat an ihre Stelle.
Wahrscheinlich haben auch beide Grenzzeichen einige Zeit nebeneinander bestanden, bevor der Baum der Witterung zum Opfer fiel. Die entsprechenden Nachweise sind in einem Amtsbuch des Rudolstädter Archives, welches im Jahre 1545 angelegt wurde zu finden. Eine Coburger Urkunde aus dem Jahre 1534 belegt, dass bereits 1530 an der gleichen Stelle ein Dreiherrenstein stand. Die beigelegte Zeichnung zeigt deutlich einen Grenzstein mit den gekreuzten sächsischen Kurschwertern.
Quelle: Thüringisches Staatsarchiv Rudolstadt, Staatsarchiv Coburg
In der Folgezeit wurden diese Grenzuntersuchungen relativ regelmäßig durchgeführt. Die entsprechenden Protokolle befinden sich meistens in den zuständigen Thüringer Staatsarchiven oder in kleineren Regionalarchiven. Im Rahmen von sogenannten Flurbegehungen oder Flurumritten wurden bestehende Grenzzeichen markiert und besichtigt. Diese Zeremonien nahmen zum Teil den Charakter von Volksfesten an und werden in ländlichen Gegenden zuweilen heute noch durchgeführt. Am 02.10.1999 fand anlässlich des Abschlusses der Sanierungsarbeiten im Bereich Hoher Lach (Neuhaus am Rennweg) bis Saarzipfel (Siegmundsburg) eine solche Grenzbegehung statt.
Unter dem Aspekt einer Inventur können auch die literarischen Erwähnungen der Grenzsteine gesehen werden, wie sie zum Beispiel Alexander Ziegler oder August Trinius in ihren Rennsteigabhandlungen beschreiben. Die Erwähnung der Grenzsteine in ihren Werken lässt den Schluss zu, dass die Steine zum damaligen Zeitpunkt vorhanden waren. Diese Tatsache ist besonders bei heute fehlenden Steinen interessant, lässt sich doch durch diese Vergleichsmöglichkeit der Zeitpunkt des Steinverlustes eingrenzen bzw. präzisieren.
Neueren Datums sind die Erwähnungen der Rennsteiggrenzsteine in der Wanderliteratur des Rennsteigvereines bei Bühring und Hertel. Beide waren maßgeblich am Fortschritt der Rennsteigbewegung und damit auch der Grenzsteinforschung beteiligt.
Aufbauend auf die Aussagen von Bühring und Hertel wurden die Folgeinventuren von Elisabeth Streller (1926/1933), Werner Messing (1964/ 69/74/79) und Günther Weiss (1966/67/72/73/76/77/84/85/88) bei den Arbeiten mit einbezogen. Leider wurde bei all diesen Inventuren der o.g. Katasternachweis außer Acht gelassen, so dass es zwangsläufig auch zu bestimmten Fehlinterpretationen kam. Trotzdem gelten diese drei Rennsteigfreunde als die aktivsten bei der Durchführung von Grenzsteininventuren. Die Unterlagen dieser Inventuren wurden durch Frau Hanna Weiss und Herrn Helmut Köllner zusammengestellt und zur Auswertung übergeben.


Grenzsteininventur im Grenzabschnitt 8 (links), Grenzbegang im Abschnitt 2 (rechts)
Inventuren müssen natürlich regelmäßig im Abstand von zwei Jahren weitergeführt werden, um rechtzeitig auf Missstände reagieren zu können. Ein erster Schritt hierzu ist getan. Der Grenzstein wurde auf vielen Werbeschriften für die Region symbolisch als Stein in Verbindung mit dem Buchstaben R dargestellt. Diese Darstellung verpflichtet auch die Verantwortlichen etwas für den Erhalt zu tun!
Wie bereits vorher erwähnt, erfordern sinnvolle Inventuren überschaubare Abschnitte. Für die Gesamtstrecke des Pläncknerschen Rennsteiges wurden die Strecken mit ehemaliger Landesgrenzfunktion in Abschnitte eingeteilt, die in diesem Zusammenhang erklärt werden sollen:
1. Abschnitt
Hohe Tanne bis Schildwiese (nicht durchgängig)
Grenzsteine Nr. 166, 166.1, 47 bis 39, 656 bis 632.1, 198, 197, 196, 134, 133, 122,
121
2. Abschnitt
Dreiherrenstein Hoher Lach bis Dreiherrenstein Am Saarzipfel
Grenzsteine Nr. 1 bis 182
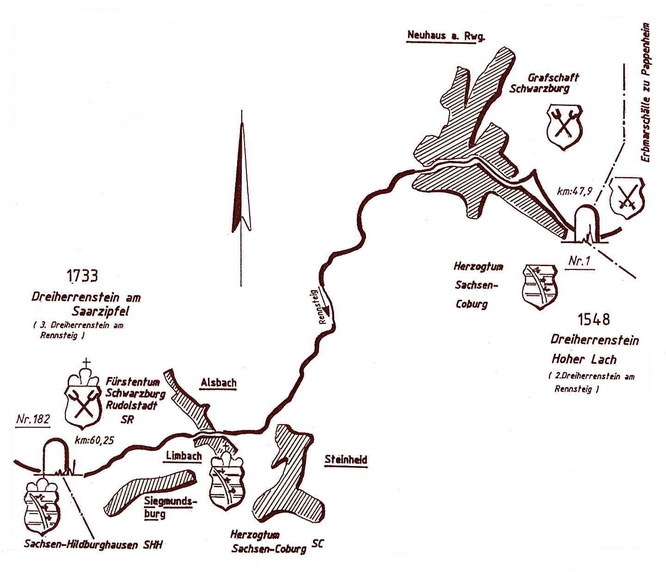
3. Abschnitt
Dreiherrenstein Am Saarzipfel bis Dreiherrenstein Hohe Heide
Grenzsteine Nr. 1 bis 103

4. Abschnitt
Dreiherrenstein Hohe Heide bis Forstort Marienhäuschen
Grenzsteine Nr. 206 bis 1; 4 bis 6
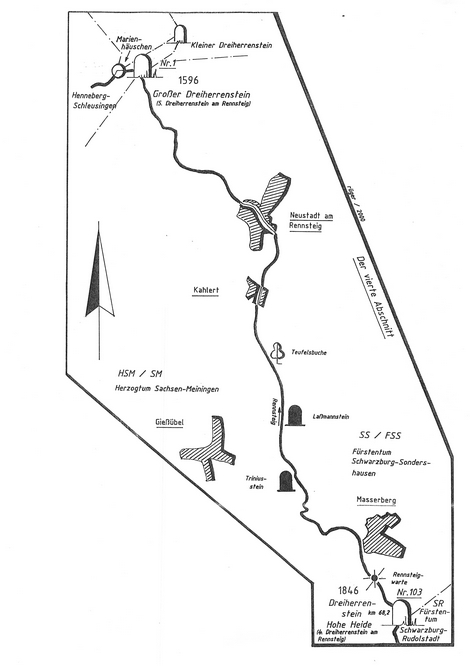
5. Abschnitt
Mordfleck bis Suhler Ausspanne
Grenzsteine Nr. 53 bis 85 (86)
6. Abschnitt
Zeller Läube (Dietzel – Geba - Stein) bis Kerngrundanfang (Gustav – Freytag - Stein)
Grenzstein Nr. 16 bis 1; 50 bis 1
7. Abschnitt
Kerngrundanfang (Gustav - Freytag-Stein) bis Dreiherrenstein Am Hangweg
Grenzstein Nr. 170 bis 1
8. Abschnitt
Dreiherrenstein Am Hangweg bis Heuberghaus
Grenzstein Nr. 1 bis 52
9. Abschnitt
Großer Jagdberg bis grenzende Am Kleinen Weißenberg, Einzelstücke bei
Clausberg
Grenzstein Nr. 97 bis 1; 35 bis 24; Einzelsteine bei Clausberg (Zugang Förthaer
Stein - Clausberg, hinter Clausberg - Stedtfeld, Flur 8, Flur 12)
Die Gesamtlänge der Rennsteigabschnitte mit ehemaliger Grenzfunktion beträgt ca. 77,2 km (Rechenwert: 77 km, 206 m, 20 cm). Die Angaben wurden bei der Neuvermessung des Rennsteiges in den Jahren 2002 – 2003 ermittelt, Grenzsteinreihen, die den Rennsteig nur kreuzen, wurden nicht mit berücksichtigt.
In der Zeit von 1513 bis 1976 wurden lt. Katasternachweis insgesamt 1007 Grenzsteine gesetzt, von denen heute noch 800 Steine (variabel) vorhanden sind.
Die neun Dreiherrensteine des Rennsteiges
Im Verlauf des Pläncknerschen Rennsteiges gibt es neun Grenzpunkte die mit Dreiherrensteinen bestückt waren oder sind. Dreiherrensteine wurden in der Vergangenheit überall dort gesetzt, wo einstmals 3 Herrschaftsbereiche an einem Punkt zusammen trafen. In der Literatur ab den 20-er Jahren des 20. Jahrhunderts sprach man immer von 13 solcher Dreiherrensteine am Rennsteig. Diese Zahl ist nicht korrekt, da Grenzsteine hinzu gezählt wurden, die mit dem Rennsteiggrenzverlauf nichts zu tun hatten. Die größte Entfernung betrug dabei über 10 km. Sogar ein gewöhnlicher Grenzstein aus einer Grenzsteinreihe wurde mit einbezogen, später aber wieder berichtigt.
- Deiwappenstein am Kießlich

Bamberger Seite


- 024.747,77 m/+2,50 m von Blankenstein, 144.546,00 m/-2,50 m von Hörschel
- 728 m ü.NN
- Grenzabschnitt 1 (1.2)
- Ry 458.951,75/ Hx 589.883,23 System PD 83, transformiert aus den Werten der gemeinsamen Grenzvermessung DDR/BRD von 1976
- der Grenzstein ist stark beschädigt, wurde aber im Rahmen einer gemeinsamen Aktion zwischen den zuständigen Behörden der damaligen DDR und der BRD im Jahre 1986 saniert, wobei die bestehenden Abplatzungen und Fehlstücke nicht ergänzt worden sind.
- als einzige Seite ist die sächsische Seite noch relativ gut erhalten
- auf dem Grenzstein im Sockelansatz befindet sich das komplette Steinsatzdatum auf allen 3 Hoheitsseiten: 1717, darunter DEN 4. OCTOBER
- Auf der Bayreuther Seite befindet sich der Brandenburger Adler, als Wappen der Markgrafschaft Bayreuth
- die östliche Seite trägt den sächsischen Rautenkranz
- auf der Bamberger Seite befindet sich das Amtswappen des Bischofs Franz Graf von Schönborn (1693-1729) von Bamberg
- 1513 erstmals gesetzt (im Zusammenhang mit den Kurfürstensteinen)
- 1599 dargestellt im Geometrischen Riss des Amtes Teuschnitz (Staatsarchiv Bamberg: A 240 Nr. T 1786)

- 1619 neu gesetzt
- 1717 jetziger Grenzstein wird gesetzt
- 1976 Neuvermessung der Grenze durch DDR und BRD
- 1986 Sanierung des Grenzsteines in einer gemeinsamen Aktion zwischen der damaligen DDR und der BRD
- ab 1999 regelmäßig kontrolliert bei jährlich durchgeführten Grenzsteininventuren
2. Dreiherrenstein Hoher Lach
Der erste Grenzstein im Grenzabschnitt 2 des Plänckner'schen Rennsteiges. Er trägt die Nummer 1.
- Lage auf dem Rennsteig: km 048.306,71/+2,00/rechts von Blankenstein
- Gemeinde Neuhaus am Rennweg, Gemarkung Igelshieb
- Flurbezeichnung aktuell Hoher Lach
- Flurbezeichnung historisch Schäbelte Puch (1548), Schnebelich Buch (1605), Schnebelicht Buchen (1621), Schnebelichte Buche (1621), Lauschenberg (1621), Dreiherrenstein bei der Lauschaquelle (1621).
- Koordinaten (PD 83 System): Ry: 440.531,870, Hx: 595.660,840
- Geländehöhe: 785m
- Abmessung über Erdreich: 0,85m hoch, 0,40m breit, 0,40m tief.
- Sandstein
- Saniert 1999, gerichtet 1999, steht sicher und fest
- schlichter Stein
Solider, aber sehr wenig gezeichneter Grenzstein, stark ausgewittert. Auf der Schwarzburger Seite ist nur noch die Bezeichnung Nr 1 erkennbar, auf der Pappenheimer Seite befindet sich nur noch die 1, auf der Coburger Seite besitzt der Grenzstein keine Zeichnung mehr.
Am 23.07.1999 wurde der Grenzstein an seinem vorausberechneten Standort neu gesetzt. Das machte sich erforderlich, da zu Beginn der 90 er Jahre des 20. Jahrhunderts der Grenzstein unsachgemäß versetzt wurde. Die Neusetzung erfolgte aufgrund des Steingewichtes maschinell.
Eine Hinweistafel beim Stein erklärt den Zweck des Steinsatzes im Untersuchungsgebiet. Der Standort wurde attraktiv gestaltet, u.a wurde eine neue Buche symbolisch für die ehemalige schnebelichte Buche gepflanzt.
Südwestlich vom Grenzstein verläuft die stark befahrene Sonneberger Straße des Ortsteiles Igelshieb. eiterhin befindet sich dort die Einfahrt zu einem Einkaufsmarkt.

Sächsische (Coburger) Seite

Schwarzburger Seite

Pappenheimer Seite

Blick in Richtung Igelshieb, Rastplatz Hoher Lach

Stein mit Hinweistafel und neu gepflanzter Buche
- 048.306,71 m/+2,00 m von Blankenstein, 120.987,06 m/ -2,50 m von Hörschel
- 785 m ü.NN
- Grenzabschnitt
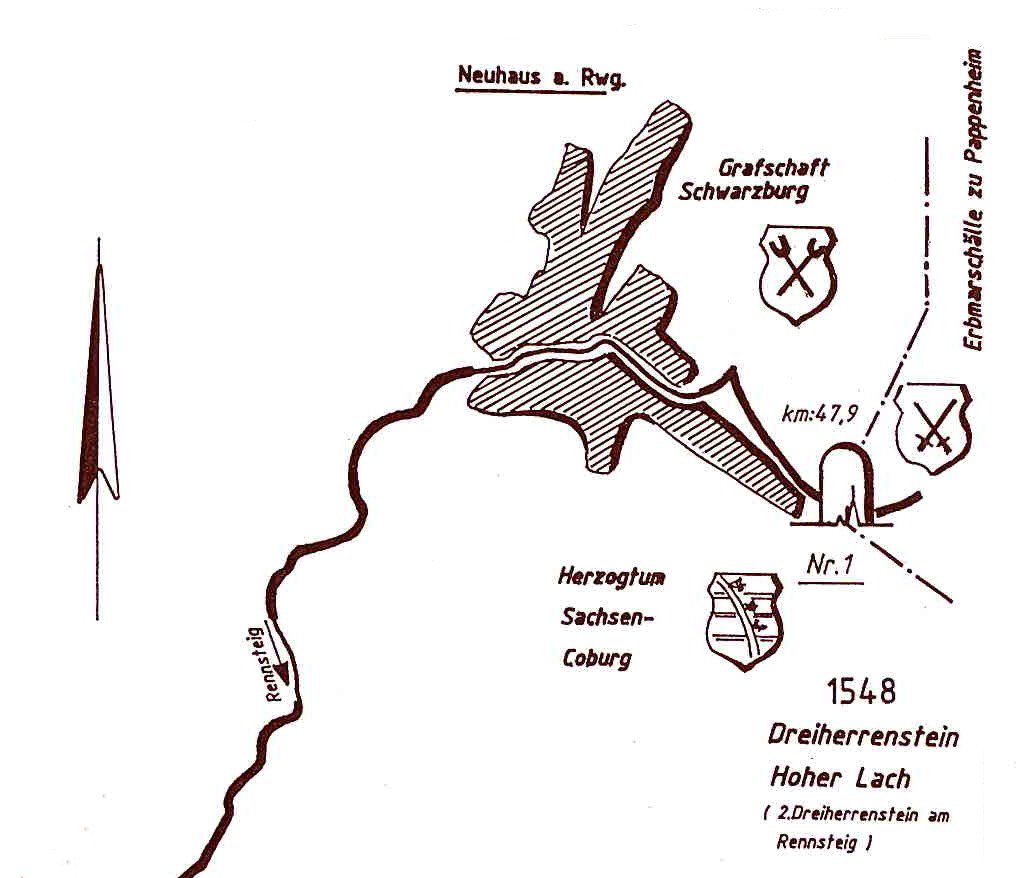
- 18.Februar bis 10. Juni 1453
Markscheidung der Hohen Wälder zwischen den Herzögen von Sachsen und der Schwarzburger Herrschaft. Die Markscheidung beginnt bei der Schnebelichten Buche (Paul Jovius: Chronicon Schwartzburgicum bei Schöttgen, Christian und Kreysig, Georg. Diplomata et Scriptores historiae Germanicae medii aevi. Altenburg 1753. Band 1. Seite 530.).
- 1530 (1534)
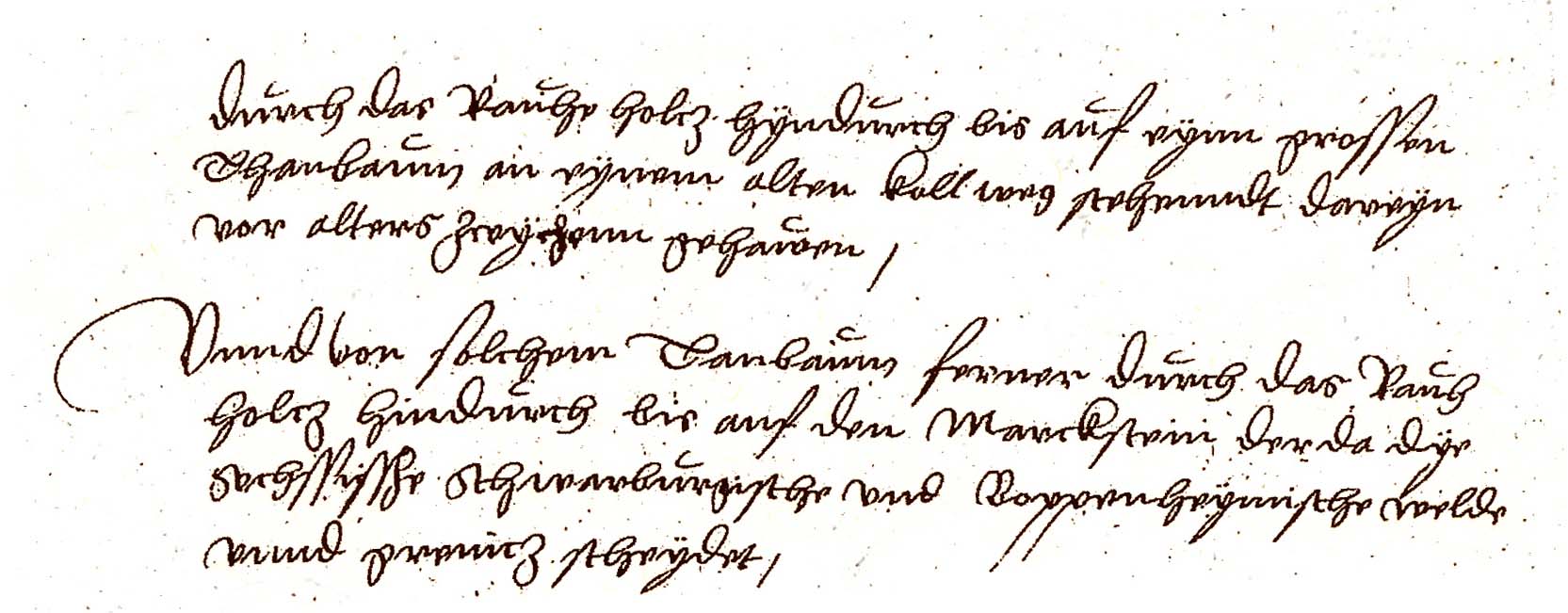
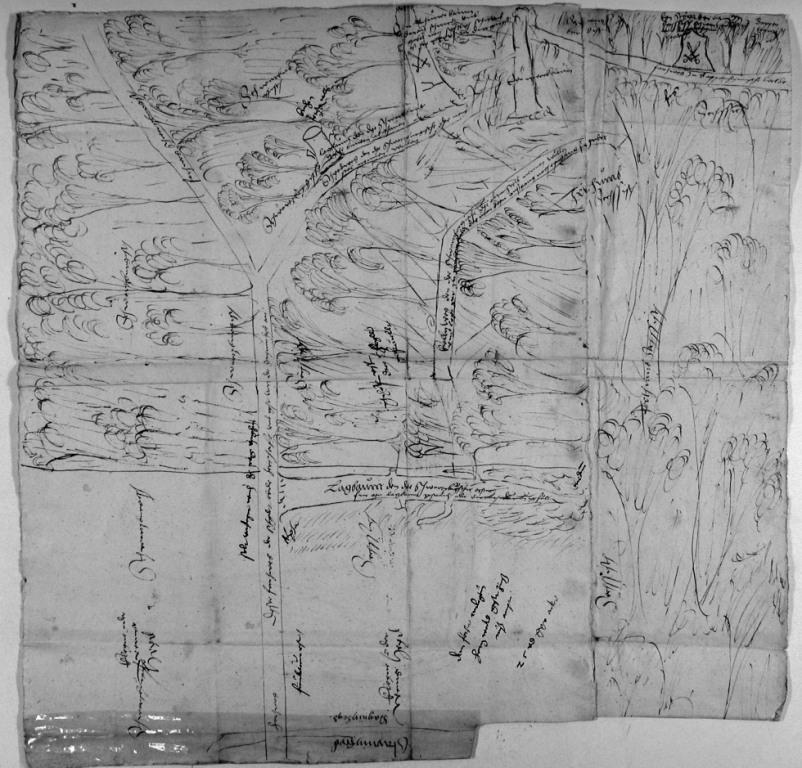

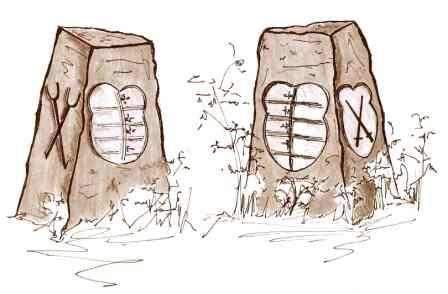
- 1535
Im Jahre 1535 findet im Bereich der "Kleinen Heide" eine Grenzuntersuchung statt. Dabei wird ein Dreiherrenstein erwähnt....bys hynnab zum Marcksteyn, der zwischen Sachssen, Schwarzburg unnd Bappenheym scheydet... (Staatsarchiv Coburg: LA D 741. Blatt 1 Vorderseite)
- 1540
In einem Verzeichniß der Grentz mitt den anstoßenden Gehöltzen in das Ampt Sonneberg heißt es: ...vff die Zilliasbrucken zu stehet ein lochbaum in einem alten wegk, hernach gehet vnd margkt hinvier vff die schnebelte puche. Do hebt sich ann die grentzmit den v. papenheim. Von der schnebelten Puchen vff der entsprungk der lauschnitz. (Staatsarchiv Coburg: F.VI. 6d 10 No.14. - hist. Quelle)
- 1548, 18. Juni
Pappenheimisch- Schwarzburgische Grenzbereitung, Freitag nach Vitus. Begonnen wurde die Grenzbereitung (der Lachbaum Schnebelichte Buche fehlt hier)...beim Stein, wo vordem die schäbelichte Buche gestanden war und wo die herzogliche, Schwartzburgische und pappenheimische Markung zusammenstoßen. (ThStA Rudolstadt: Hessesche Collectaneen. Sig. AVIII 2c Nr. 29. Blatt 121-124.)
- 1548, 03. September
Grenzbereitung zwischen der Grafschaft Schwarzburg und Sachsen Coburg nach Egidi:...Hauptstein, do etwann die schnebelich Buch gestanden, welche Sachsenn, Schwartzburgk uund Pappenheim scheidt. (ThStA Rudolstadt: Hessesche Collectaneen. Sig. AVIII 2c Nr. 29. Blatt 133-141.)
- 1548, 10. Oktober
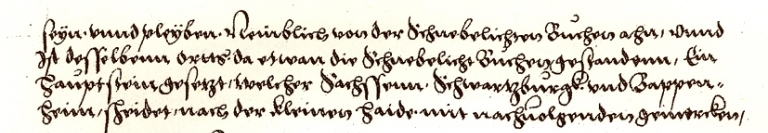
- 1569
Forstbereitung, darin heißt es: ...Schnebelichte Buche, der enden ein hoher Sandstein daran das fürstl. Sechsische, auch der grafen von Schwarzburg und Bappenheimischen wappen stehet. (z.Z. kein Quellennachweis)
- 21. und 22. Juni 1596
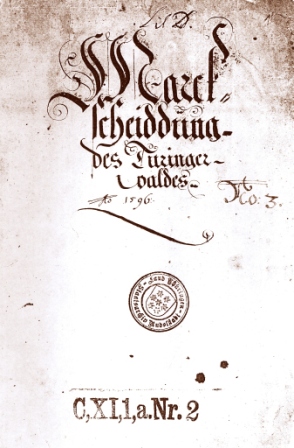
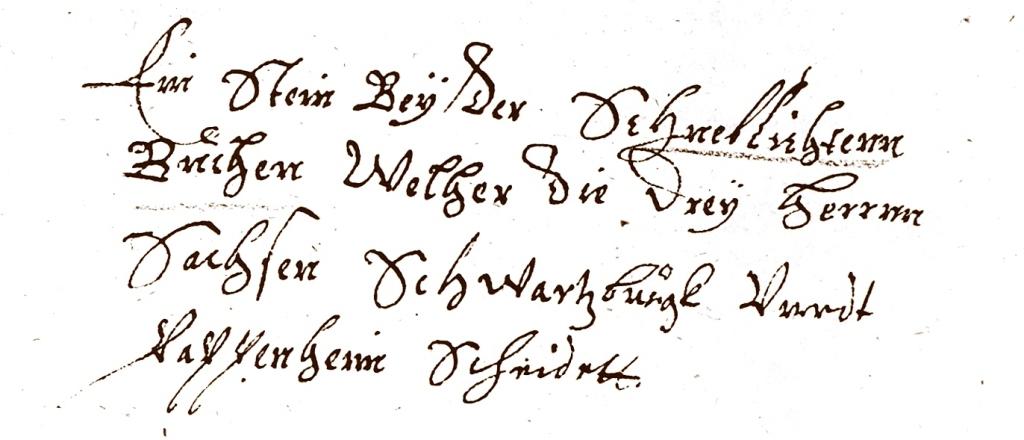
- 05. und 06. Juni 1605
Der Dreiherrenstein Hoher Lach wird unter der laufenden Nummer 215 in einer Beschreibung der Grentz-Marckung uf den Hohenwälden des Ambtt Eisfeldtts und Sonnenbergks zwischen dem Großen Dreiherrenstein und dem Dreiherrenstein Hoher Lach genannt:
Der hohe Marck Stein am Scheidtwege auf der Sächsischen Seiten stehet, do vor alters die schnebelicht Buchen gestanden, scheidet Sachsen, Schwartzburgk und Pappenheimb. (ThStA Rudolstadt: Amt Gehren. Sig.132.)
- 27. Juni 1621
Grenzbesichtigung der nördlichen Grenze des Coburgischen Amtes Neustadt-Sonneberg auf Veranlassung von Herzog Johann Casimir von Coburg. Der Dreiherrenstein wird dabei kontrolliert und als Abschlussstein auf dem Lauschenberg genannt. Im Vorspann zur Grenzbeschreibung bezeichnet man den Grenzstein auch als: Dreiherrenstein bei der Lauschaquelle.
Der Große hohe Stein, auf Sächsischer Seite am Scheideweg, wo vor alters die Schnäbelichte Buche gestanden war. Er scheidet drey Grentzmarkung, nämlich Sachsen- Coburg, Schwartzburg und Gräfenthal. (Erbzinsbuch des Sachsen-Coburg-Altenburgischen Amtes Neustadt Sonneberg. Fertiggestellt 1659. Seite 66-83.)
- 1670
Erwähnung in einer Grenzbeschreibung der Grenze zwischen Sattelpass und Hoher Lach: Grentzen zwischen dem Gräfenthälischen und dem Ambte Neustad an der Heyde
...weiter hinauf an den großen Marckstein, welcher drey Herrschaften voneinander scheidet, als das Hauß Sachßen, Schwarzburg und Pappenh.... (ThStA Meiningen: Kreis Saalfeld. Nr. 3213.)
- 14. September 1728
Grenzrevision zwischen dem Coburgischen Amt Neustadt und dem Schwarzburg-Rudolstädtischen Amt Königsee am 14. und 15. September 1728, protokolliert zu Steinheid am 16. September 1728. Die Grenzrevision begann am Dreiherrenstein: No.1. Der sogenannte Lange Marck- oder Drey Herrn Stein welcher Coburg, Saalfeld und Schwartzburg Rudolstadt scheidet, noch in guten Stande, jedoch etwas abgeschlagen geweßen und ohne Wappen und Jahrzahl gefunden worden. (ThStA Rudolstadt: Bestand Regierung Rudolstadt. Nr. 150)
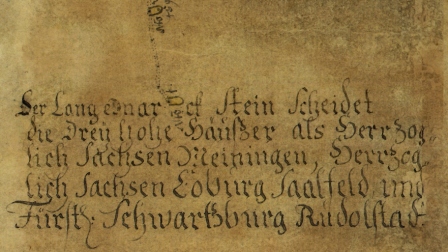
Darstellung des Dreiherrensteines in der Karte von 1794 (Quelle: Archiv des ehemaligen Katasteramtes Neuhaus am Rennweg, jetzt dem Katasterbereich Saalfeld zugeordnet) die als Grundlage für den Grenzriss von Carl P. Heyn von 1806 benutzt wurde
- 1806
Grenzriss zwischen Hoher Lach und Dreiherrenstein bei Siegmundsburg, gezeichnet von Carl Philipp Heyn: Der lange Mark Stein scheidet die drey hohe Häußer als Herzoglich S. Meiningen, Herzoglich S. Coburg Saalfeld und Fürstl. Schwarzburg Rudolstadt. (Quelle: Katasteramt Neuhaus am Rennweg, jetzt: Katasterbereich Saalfeld)
- 1810
Darstellung auf einer Karte (von Becker) zwischen Sachsen Saalfeld und Sachsen Meiningen (Grenze zwischen Hoher Lach und Sattelpass)
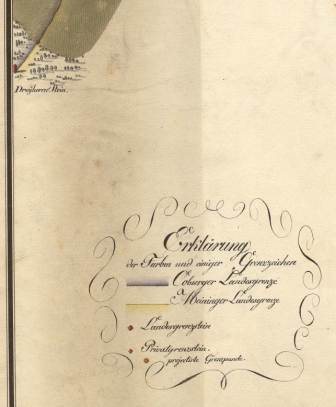
- 1826
Nach dem Tode von Herzog Friedrich IV. von Sachsen-Gotha und Altenburg im Jahre 1825, kommt es 1826 zum Erbvergleich, infolge dessen die Gothaer Hauptlinie in den ernestinischen Ländern neu gegliedert wurde. Der am Dreiherrenstein angrenzende nordöstliche Bereich des ehemaligen Herzogtums Sachsen-Saalfeld fällt an Sachsen-Meiningen. Damit verliert der Dreiherrenstein Hoher Lach seine Bedeutung als Dreiherrenstein. Bis 1918 werden durch diese Grenze nur noch das nördlich liegende Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt vom südlich liegenden Herzogtum Sachsen-Meiningen getrennt.
- 1830
Vermessung der ehemaligen Landesgrenze vom Dreiherrenstein in Richtung Ascherbach bis Geiersthal/ Lichte. Der dazugehörige Riss wird am 20. April 1831 vom Fürstl. Schwarzburg-Rudolstädtischen Landrevisor Johann Adolph Obstfelder attestiert. Der Grenzstein wird darin als Dreyherrenstein bezeichnet (s. auch 1831)
- 1831
Darstellung auf der Landesgrenzkarte als Dreyherren-Stein bis zum Lichtebach (Quelle: Archiv Katasterbereich Saalfeld)
- 1852
Darstellung auf der Landesgrenzkarte (Special-Karte) zwischen Sachsen-Meiningen und Schwarzburg Rudolstadt (Quelle: Archiv Katasterbereich Saalfeld)

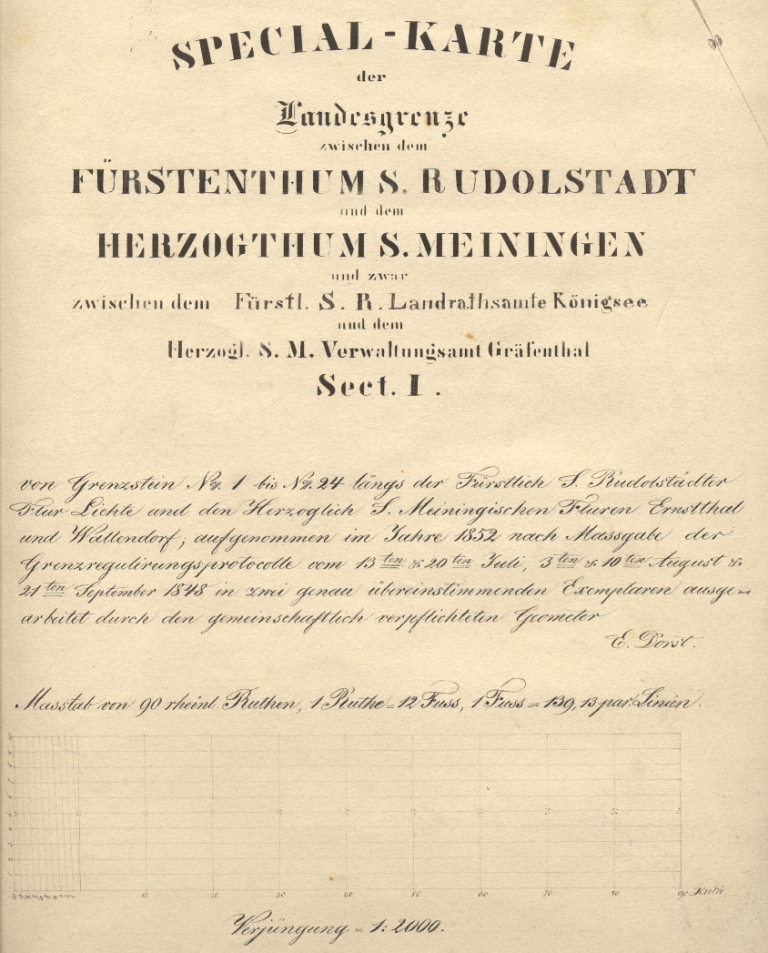
Legende zur o.g. Karte
- 1862
Alexander Ziegler schreibt zum Dreiherrenstein: ...zu dem sogenannten Dreiherrenstein ab, der früher Sachsen-Coburg, Meiningen und Schwarzburg-Rudolstadt schied,jetzt aber, da Saalfeld seit dem Jahre 1826 meiningisch ist, nur zwei Herrschaften, Meiningen und Schwarzburg-Rudolstadt, scheidet. Dieser sogenannte Dreiherrenstein (Nr.1) steht an der Wiese, wo die Grenzsteine aufhören und wo der Rennsteig, eine östliche Richtung annehmend, nach der Labeshütte, unweit Ernstthal geht...( Alexander Ziegler: Der Rennsteig des Thüringerwaldes. Verlag Carl Höckner. Dresden 1862. Seite 200.)
- 23. Februar 1884
Vermessungen am Grenzstein Nr.1. (Rissarchiv des ehemaligen Katasteramtes Neuhaus am Rennweg, jetzt Saalfeld, Fortführungsriss Nr. 212. Gemarkung Igelshieb.)
- 1899
August Trinius schreibt: ... zum Dreiherrenstein (Nr.1) am Hohen Laach unweit der Lauschaquellesenkt. Dieser Grenzwächter trennte seit 1572 Koburg, Meiningen und Rudolstadt, seit 1826 aber, wo Saalfeld an Meiningen kam, scheidet er nur noch Meiningen und Schwarzburg-Rudolstadt. Am Dreiherrenstein hören vorläufig die Grenzsteine auf...(August Trinius: Der Rennstieg. J.C.C. Bruns' Verlsg. Minden i.W. 1899. Seite 224-225.)
- 22. Januar 1901
Vermessung des Rennsteiges als Landesgrenze beginnen hier.( Rissarchiv des ehemaligen Katasteramtes Neuhaus am Rennweg, jetzt Saalfeld, Feldhandriss Nr. 66.)
- ca. 1933
Elisabeth Streller vom Rennsteigverein 1896 e.V. erfasst den Dreiherrenstein Hoher Lach
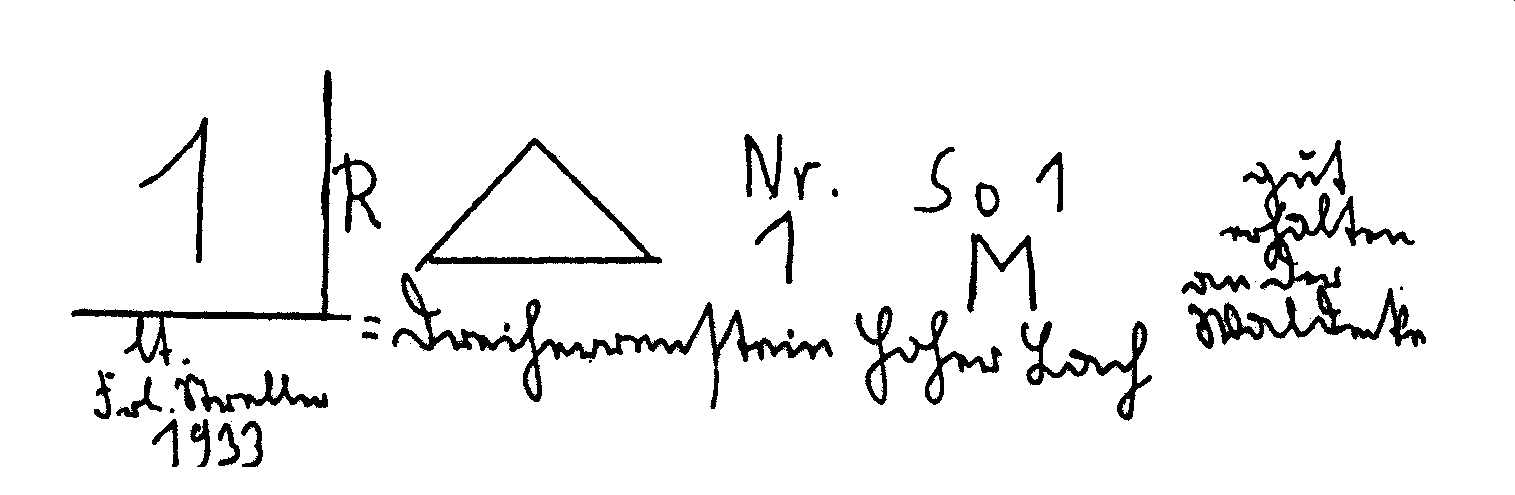
- 05. Juli 1964
Werner Messing kontrolliert den Dreiherrenstein: Die Dreiherrensteinswiese ist durch Bauarbeiten zum größten Teil (westlichen) umgewühlt. Dicht am Rand eines fast 2m hohen Erdhaufens steht aber noch der Dreiherrenstein. Am Stein ist nur noch die Zahl 1 zu erkennen. (Werner Messing: Felderfassung der historischen Grenzsteine des Rennsteiges. Zusammengestellt von Helmut Köllner, Kleinschmalkalden)
- 02. Oktober 1969
Nach Werner Messing war der Grenzstein vorhanden: Nordseite SOI, Südseite 1. (Quelle wie vor)
- 1970, ohne Datum

- 1999, 23. Juli

- 01. Oktober 1999
- 06. Juli 2001
Die Testphase zur geplanten Neuvermessung des Rennsteiges beginnt bei Grenzstein Nr. 1.
- 25. Oktober 2002
Die Neuvermessung des Rennsteiges erreicht den Grenzstein Nr.1 aus Richtung Blankenstein bei km 048.306,71. Beteiligt waren:
- Manfred Kastner, Thüringer Rennsteigverein e.V. Neustadt am Rennsteig
- Frank Beutekamp, Goldisthal, Messgehilfe Katasteramt Neuhaus am Rennweg
- Lisa Hähnlein, Gebersdorf, Auszubildende im Katasteramt Neuhaus am Rennweg
- Ulrich Rüger, Neuhaus-Schierschnitz, Amtsleiter im Katasteramt Neuhaus am Rennweg





1906 anlässlich der Einweihung des Dreistromsteines fotografiert, Stein rechts neben dem Dreistromstein
Die Geschichte des Dreiherrensteines „Am Saarzipfel“
Die eigentliche Geschichte des Dreiherrensteines beginnt lange vor seiner Setzung.
Ein Ereignis im Jahre 1675 war der eigentliche Auslöser, dem wir den Steinsatz zu verdanken haben.
Was war damals geschehen?
Als im Jahre 1675 Ernst der Fromme, Herzog zu Sachsen- Gotha und Altenburg verstarb, hinterließ er ein riesiges Erbe. Er bestimmte, dass seine sieben Söhne das Erbe antreten sollten. Das sah wie folgt aus:
Hauptlinie:
Friedrich, Herzog von Sachsen-Gotha, 1646-1691
Nebenlinien:
Albrecht, Herzog con Sachsen-Coburg, 1648-1699
Bernhard von Sachsen-Meiningen, 1649-1706
Heinrich, Herzog von Sachsen-Römhild, 1650-1710, ohne Nachkommen
Christian, Herzog con Sachsen-Eisenberg, 1653-1707, ohne Nachkommen
Ernst, Herzog von Hildburghausen, 1655-1715
Johann, Herzog von Sachsen-Saalfeld, 1658-1729
Das Erbe sollte nach dem Willen des verstorbenen Herzogs gemeinsam verwaltet werden. Doch bereits fünf Jahre nach dem Tode von Ernst, teilten seine Söhne das Land neu auf.
Durch den Tod aller erbberechtigten Söhne von Ernst, im Zeitraum von 1691 bis 1729, kam es unter den Nachfolgern auch im Bereich Sachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg und Sachsen-Saalfeld zu heftigen Erbauseinandersetzungen.
Alleine Herzog Bernhard von Sachsen-Meiningen hinterließ nach seinem Tode im Jahre 1706 12 Kinder aus zwei Ehen.
Da es zu keiner Einigung kam, übernahmen im Jahre 1734 kaiserliche Beauftragte die Aufteilung des Landes. Das Ergebnis war ein Reichshofrat- Konklusum im Jahre 1735. Der eigentliche Verlierer jener kaiserlichen Entscheidung aus dem Jahre 1735 war Sachsen- Coburg. Große Teile seines Besitzes am Rennsteig fielen an Sachsen-Meiningen und Sachsen-Saalfeld.
Die durch die Entscheidungen des Reichshofrat-Konklusums von 1735 im Jahre 1733 eingravierte Bezeichnung „SC“ für Sachsen-Coburg verliert dadurch ihre Daseinsberechtigung, da es das Herzogtum in dieser Form am Standort des Grenzsteines nicht mehr gibt.
Die relative Rechtsunsicherheit auf dem Sächsischen Territorium war auch der Anlass, dass die auf dem Grenzstein eingravierte Jahreszahl 1733 nachweislich nicht mit dem tatsächlichen Steinsatzjahr identisch ist.
Einer Urkunde aus dem Stadtarchiv Schalkau von 1733[1] entnehmen wir, dass der Grenzstein zwar an den Standort gebracht wurde, aber noch nicht gesetzt war.
- 7. am Schießplatz wieder ein Dreyherrenstein, bey welchen sich das S. Hild-burghäusische endet und die Gränze zwischen S. Meiningen und dem Fürstenthum Schwarzburg Rudolstadt fortläuft...den dreyer Herrn Stein aber vorräthig lieget, um solchen bedürfenden falls benutzen zu können....
Die Urkunde verweist weiterhin auf einen Grenzstein mit dem Wappen der Schwarzburger und der Ernestiner der noch am Ende dieser Grenzlinie steht.
In einer Coburger Urkunde[2] wird der Grenzstein als :
...der Einundzwantzigster Stein der an dem Schießplatze steht, mit dem Sächsischen und Schwartzburgischen Wappen, dann mit der Jahreszahl 1595 signiert ist...
bezeichnet. Also stand zu diesem Zeitpunkt, obwohl bekannt war, dass hier 3 Herrschaftsbereiche zusammen trafen, ein normaler Läuferstein, der lediglich Schwarzburg von Sachsen trennte.
Die Bedeutung allerdings, dass der Dreiherrenstein gesetzt werden muss, wurde im Protokoll der Meininger Seite[3] zum Ausdruck gebracht:
...dass obiger Stein ausgerissen und dass statt ein dreyeckigter mit erforderlichen Wappen und der Jahreszahl 11733 gesetzt werden sollte.
Nach Ansicht der protokollierenden Beamten sollte vorerst ein Pfahl die Stelle markieren, wo später der Dreiherrenstein stehen sollte.
Aus dem Jahre 1751 liegt noch ein Protokoll vor[4], das im Stadtarchiv Schalkau archiviert ist. Darin wird die Grenze zwischen dem Märterlein und dem Saarzipfel, dort wieder als „Schießplatz“ bezeichnet, untersucht.
Darin heißt es:
- 7. am Schießplatz wieder ein dreyherrenstein, bey welchem sich das S.Hildburghäusische endet und die Gränze zwischen S.Meiningen und dem Fürstenthum Schwarzburg Rudolstadt fortläuft...den dreyer Herren Stein aber dergleichen Stein vorräthig lieget, um solchen bedürfenden falls brauchen zu können...
Das bedeutet also, der Dreiherrenstein lag im Jahre 1751 noch an der gleichen Stelle lag wie 1733.
Die erste Urkunde, die den Standort eindeutig bestätigt, stammt aus dem Jahre 1794[5]. In der Begleitkarte zur Urkunde steht geschrieben:
Nr.148 nach Messung 18. Ruthen und 6. Schuh ( vom Stein 147, dem heutigen Stein 180 von 1617 entfernt) .dem Wappen und Drey Herren Stein, welcher gegen Mittag S.Hildburghausen, und gegen Abend und Mitternacht Schwarzburg Rudolstadt scheidet, das dreyfache Wappen und die Jahrzahl 1733. trägt auch auf der Sachsen Meiningischen Seite mit den Buchstaben S.C. bezeichnet... (Quelle/ Verwahrort: Karten- und Rissarchiv Katasterbereich Saalfeld)
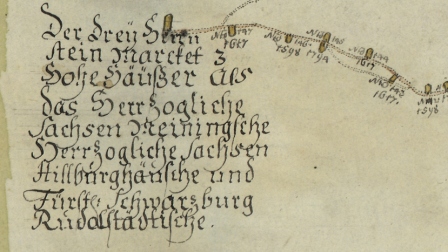
Beschreibung des Dreiherrensteines i der Karte von 1794
Also, wurde der Dreiherrenstein erst in den Jahren zwischen 1751 und 1794 gesetzt, in einer Zeit, in welcher die Gravur auf dem Grenzstein in Bezug auf Sachsen-Coburg (S C) längst überholt war.
Im Jahre 1826 verliert der Dreiherrenstein „Am Saarzipfel“ genau wie sein östlicher Gegenpol, der Dreiherrenstein „Hoher Lach“ seine Bedeutung als Dreiherrenstein komplett. Am 11. Februar 1825 stirbt Friedrich IV. Herzog von Sachsen-Gotha und Altenburg. Damit erlöscht die Gothaer Hauptlinie.
Um weitere Erbstreitigkeiten zu vermeiden, bemühte sich König Friedrich August von Sachsen um Vermittlung. Am 12. November 1826 wurde ein Erbvertrag geschlossen. Die Linien des Hauses wurden wie folgt gebildet:
Sachsen-Coburg und Gotha
Sachsen-Meiningen
Sachsen-Altenburg
Der ehemalige Dreiherrenstein diente somit nur noch als Trennlinie zweier Herrschaften:
Sachsen-Meiningen im Süden
Schwarzburg-Rudolstadt im Norden
Diese beiden Linien bestanden bis zur Auflösung der Kleinstaaten nach der Novemberrevolution 1918 fort.
Der Meininger Herzog Bernhard III, legte am 10. November 1918 seine Ämter nieder.
Bleibt noch eine kurze Erklärung zu nördlichen Nachbar, dem Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt:
Das Haus Schwarzburg-Rudolstadt entstand aus der Teilung von 1599 zunächst als Grafschaft. Zwischen 1697 und 1710 erfolgte die Erhebung in den Reichsfürstenstand. Ein Zeichen dieser fürstlichen Würde finden wir in Form der Fürstenkronen auf dem Wappen der Schwarzburg-Rudolstädter Seite des Dreiherrensteines wieder. Bi allen Grenzsteinen, die vor 1697 gesetzt wurden, fehlt diese Krone, da man keine Berechtigung zum Führen derselben hatte.
Fürst Günther Victor dankte als letzter der Thüringer Fürsten am 23.November 1918 ab.
Am Dreiherrenstein endet (oder beginnt) ein weiterer interessanter Grenzzug mit über 100 Grenzsteinen, die zum Teil mit sehr aufwändigen Wappendarstellungen versehen sind. Es ist der Grenzzug zwischen dem Amt Eisfeld und dem Gericht Rauenstein, auch als „Alter Grenzweg“, mit seinem Anfangs- oder Endpunkt auf dem Gipfel des Bleßberges, landläufig bekannt.
Die beim Dreiherrenstein noch heute sichtbaren Steinreste konnten nach eigenen Recherchen nicht dem Steinsockel des Dreiherrensteines selbst zugeordnet werden. Die Bruchstelle an der Unterseite des Steinkopfes passt nicht auf die am Standort befindlichen Steinreste und Sockelstücke.
Vielmehr dürfte es sich dabei um Reste des Grenzsteines der als der einundzwantzigster Stein aus dem Jahre 1595 in der Grenzbeschreibung von 1733 bezeichnet wird.
Der Grenzstein selbst hat die typische dreieckige Form, wobei die Hoheitsseiten, zwar etwas leicht verdreht aber auf das entsprechende Territorium gerichtet sind. Der Standort wurde offenbar seit dem Steinsatz in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts mindestens einmal verändert, da jegliche Zeugen fehlen. Die Gravur der Jahreszahl befindet ich auf allen 3 Hoheitsseiten unterhalb des Erdreiches.
Die Steingravur weist typisch barocke Züge auf.
[1] Stadtarchiv Schalkau: Landes Fluhr Jagd und Zehnd Gränze mit den Aemtern Sonneberg, Schalkau und Rauenstein. Grenzbeziehung mit dem Amt Sonneberg vom 10. August 1733. Bestand: St 46.
[2] Staatsarchiv Coburg: Grenze zwischen Schaumburg, Coburg und Rudolstadt. StACo, Lreg. 1735
[3] Thüringisches Staatsarchiv Meiningen: Steinsetzung auf der Sächsisch- Schaumburgischen Grenze 1733. Kreis Sonneberg. Nr. 99.
[4] Stadtarchiv Schalkau: Grenzbeziehung auf dem Hohen Wald zwischen dem Märterlein und dem Saarzipfel vom 30. August 1751. Bestand St 46.
[5] Thüringisches Staatsarchiv Meiningen: Grenzrevision vom 21. bis 24. Juli 1794 zwischen Hoher Lach und Dreiherrenstein am Schießplatz. Bestand Kreis Sonneberg, Nr. 98.
4. Dreiherrenstein Hohe Heide

Schwarzburg-Rudolstädter Seite mit Gabel und Nr. 103

Schwarzburg-Sondershäuser Seite mit Nr. 153

Sachsen-Meininger Seite mit der Jahreszahl 1846

Steinsanierung, nach Beschädigung durch Vandalen am Himmelfahrtstag
5. Großer Dreiherrenstein

Henneberger Seite

Sächsische Seite

Schwarzburg-Sondershäuser Seite

Der Große Dreiherrenstein, 1935 anlässlich einer Runst fotografiert
6. Dietzel-Geba-Stein

Sachsen-Gothaer Seite

Hessische Seite

Sächsische Seite
7. Gustav-Freytag-Stein

der neue Stein, Hessische Seite

neuer Stein, Sächsische Seite

neuer Stein, Sachsen-Coburg-Gothaer Seite

am ehemaligen Standort wird am 11.06.2006 der Sockel frei gelegt

Zeugen, Ziegelstücken

Zeugen, Holzkohlereste

eines der wenigen bekannten Bilder vom Dreiherrenstein aus den 30-er Jahren des 20.Jh.
8. Dreiherrenstein am Hangweg

Hessische Seite

Gothaer, Tenneberger Seite

Alle Steine am Hangwegstandort
9. Dreiherrenstein am Großen Weißenberg

Hessische Seite

Sachsen-Gothaer Seite

Sachsen-Meininger Seite

historisches Foto um 1906

Bild um 1936

ca. 1963
Die abseits vom Rennsteig stehenden Dreiherrensteine
1. Dreiherrenstein Hohe Tanne
02.bis 04. Oktober 1513
Angefangen am alten Reichenbacher Steige nach Oßla neben dem Schlage bei des Abts Holz, daselbst den ersten Lachstein (Kurfürstenstein) gesetzt...
...und forter von diesen zwei Steinen steht der letzte bei der Hohen Tann, der scheidet sächsisch, Bambergisch und Gerisch Grentz. Bayerisches Staatsarchiv Bamberg: Vertrag und Protokoll über die Grenzvermarkung zwischen dem Kurfürstentum Sachsen und dem Bistum Bamberg. A 86, Lade 352, Nr. 148. Handschrift
Zwischen dem heutigen Kurfürstenstein und der Hohen Tanne wurden insgesamt 20 Grenzsteine gesetzt, die wahrscheinlich alle das Aussehen der heute noch vorhandenen Kurfürstensteine hatten. Der Dreiherrenstein Hohe Tanne dagegen trug neben dem Bambergischen und dem Sächsischen Wappen noch das der Herrschaft von Reuß- Gera.
Mit der Aussage des o.g. Protokolls steht fest, dass der erste Dreiherrenstein an der Hohen Tanne im Jahre 1513 gesetzt wurde.
1599
Geometrischer Abries des Ambts Teuschnitz/ mit allen Zugehörigen und inliegenden Dörfern/Walden...Bayerisches Staatsarchiv Bamberg. A 240, Tafel 1786. Karte
Der geometrische Riss von Peter Zweidler zeigt alle 20, im Jahr 1513 gesetzten Grenzsteine einschließlich des Dreiherrensteines Hohe Tanne. Zusätzlich werden bei den beiden Dreiherrensteinen, Am Kießlich und Hohe Tanne auch die Wappen der Anliegerherrschaften dargestellt. Der Name "Rennsteig" wird nicht genannt

1757
Nach der Urkunde von 1513 wurde die Stelle, an welcher der heute noch vorhandene Dreiherrenstein von 1845 steht, bereits mit einem sogenannten "Kurfürstenstein" vermarkt.
Aus dem Jahre 1757 zeigt eine Karte ...derer Hochgraefl. Reussischen Herrschaften Lobenstein und Ebersdorf und der Pflege Hirschberg... an der Stelle des Dreiherrensteines 3 Grenzsteine, ohne dass der Rennsteig benannt wird:
- Saalfeldische Grenzstein
- Bambergische Grenzstein
- Reußische Grenzstein
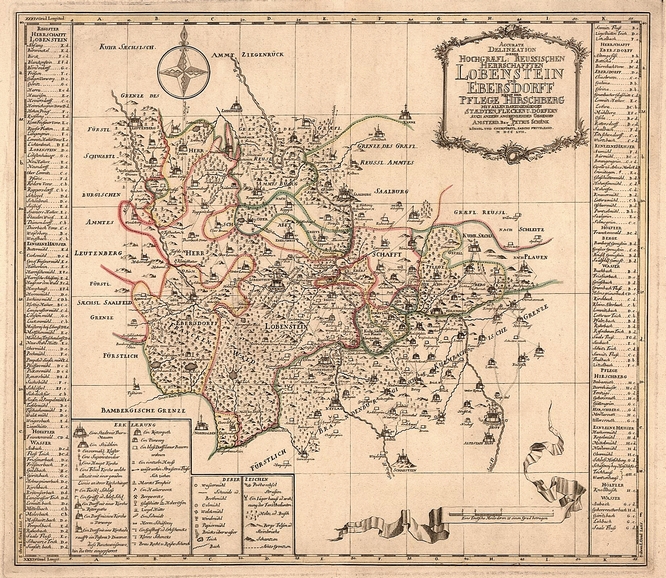

Karten: Repro archiv-rueger-2019
Um 1840 bis 1850
Alle Anliegerherrschaften erlassen Verordnungen und Instruktionen zur Vermessung und Abmarkung ihrer Landes-grenzen im Zuge des Aufbaues einer Katasterverwaltung. In diesem Zusammenhang dürfte auch der noch heute vorhandene Dreiherrenstein Hohe Tanne gesetzt worden sein.

Seite Herzogtum Sachsen Meiningen HSM

Weisung auf dem Steinkopf

Seite Königreich Bayern KB

Seite Fürstentum Reuss FR
Mai 1926
Im Rahmen einer Grenzsteininventur wird der Dreiherrenstein Hohe Tanne durch die Mitglieder Des Rennsteig-vereins 1896 e.V. Bühring, Meyer, Knoblauch, Rudolf und Oehlschlägel aufgenommen.
26. 02.1976
Die gemeinsame Grenzkommission der DDR und der BRD erwähnen den Grenzstein in ihrer Grenzkarte 74, 75, Grenzabschnitt 54, Grenzzug e, Blatt 1.
1999/2000
Grenzsteininventur durch Manfred Kastner vom Thüringer Rennsteigverein e.V. Neustadt am Rennsteig. Es entsteht die bisher umfangreichste Grenzsteindoku-mentation in der Geschichte der Rennsteiggrenzsteine. Ein Exemplar befindet sich im Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege Erfurt, ein zweites Exemplar im Rennsteig- Museum Neustadt am Rennsteig.
Geschichtliche Entwicklung auf Sachsen-Meininger Gebiet
Der geometrische Riss von Peter Zweidler zeigt alle 20, im Jahr 1513 gesetzten Grenzsteine einschließlich des Dreiherrensteines Hohe Tanne. Zusätzlich werden bei den beiden Dreiherrensteinen, Am Kießlich und Hohe Tanne auch die Wappen der Anliegerherrschaften dargestellt.
Geschichtliche Entwicklung auf dem Gebiet des Fürstentumes Reuß
Bis 1270
Die Herren von Lobdaburg- Arnshaugk besitzen das Gebiet.
1270
Die Vögte von Gera erbten das Gebiet.
1547
Burggräflich- Plauische Herrschaft durch Heinrich dem V. Er erhält das Land von Kaiser Karl dem V. nach dem Sieg über den Kurfürsten von Sachsen.
1564
Reuß jüngere Linie ergreift Besitz von der Herrschaft Lobenstein, begründet von Heinrich dem X., Nachfolger von Heinrich Postumus, die Speziallinie Lobenstein bestand bis 1824.
1711
Teilung nach dem Aussterben der Hirschberger Linie. Das Gebiet verbleibt bei Lobenstein (auch Blankenstein, Kießling, Schlegel, ½ Rodacherbrunn). Die andere Teillinie ist Ebersdorf (mit Grumbach und ½ Rodacherbrunn).
1824
Erlöschen der Lobensteiner Linie, das Gebiet fällt an Reuß- Schleiz.
Geschichtliche Entwicklung auf der bayerischen Seite
Bis 1803
Bistum Bamberg (nur im 30-jährigen Krieg unter den Schweden: Herzogtum Franken, Herzog Bernhard von Weimar wird damit belehnt)
1633
Bernhard überträgt die Verwaltung seinen Bruder Ernst.
1634
In Folge der Schlacht bei Nördlingen geht das Herzogtum verloren.
1693- 1729
Es regiert Bischof Lothar Franz, auch Erzbischof zu Mainz.
1729- 1746
Bischof Friedrich Karl und seine drei Nachfolger, die zugleich Fürstbischöfe zu Würzburg sind, beherrschen das Gebiet.
1802
Säkularisierung des Bistums zu Gunsten des Königreiches Bayern (Reichsdeputationshauptschluss)
Seit 1817
Die Gebiete fließen mit in das Erzbistum ein.
Richtigstellungen
Grenzsteine
Entlang des Pläncknerschen Rennsteiges müssten nach Auswertung aller zugänglichen Katasterunterlagen 1007 historische Länder- und Ämtergrenzsteine stehen. Der tatsächlich vorhandene Bestand beläuft sich auf etwa 800 Grenzsteine. Die fehlenden Grenzsteine wurden entweder gestohlen oder wurden aufgrund der Urbanisierung der Region beseitigt. Hin und wieder kommt es vor, dass der eine oder andere Grenzstein nach intensiver Auswertung von vorhandenem Archivmaterial wieder gefunden, oder nach einer Kompletterfassung zerstört oder gestohlen wird. Aus diesem Grund beziffern wir die Anzahl der vorhandenen Grenzsteine auf etwa 800. Die gewonnenen Daten stammen aus meiner seit über 40 Jahren durchgeführten Recherchearbeit zu den historischen Grenzsteinen des Rennsteiges.
Die in zahlreichen Medien und im Internet genannte Zahl 1300 Grenzsteine ist somit falsch, selbst wenn die zahlreichen Forstgrenzsteine entlang des Rennsteiges mit hinzugerechnet werden. Die Zahl 1300 Grenzsteine stammt aus den 20-er und 30-er Jahren des 20. Jahrhunderts und wurde im Mareile, dem Boten des Rennsteigvereins, im Zusammenhang mit damals durchgeführten Grenzsteininventuren in Umlauf gebracht.
Länge des Rennsteiges
Der Pläncknersche Rennsteig veränderte sich im Laufe der Jahrhunderte ständig in seiner Länge. Die Gründe lagen in der Besiedlung der Region. Der Wegeverlauf musste geändert werden, was in den wenigsten Fällen offiziell, sondern meistens illegal erfolgte. Seit 1997 steht der Pläncknersche Rennsteig in seiner Sachgesamtheit unter Denkmalschutz. Eine Wegeänderung ist somit ohne entsprechende denkmalschutzrechtliche Genehmigung nicht mehr möglich.
Für die Berechnung von Wegelängen und für die Erfassung von Sachteilen des Rennsteiges sollten die Messwerte der amtlichen Neuvermessung des Rennsteiges im Jahre 2002 und 2003 durch Mitarbeiter des Thüringer Landesvermessungsamtes Erfurt in Zusammenarbeit mit dem Thüringer Rennsteigverein e.V. Neustadt am Rennsteig verwendet werden. Die exakte Rechenlänge wurde mit 169 Kilometer, 293 Meter und 77 Zentimeter ermittelt. Gerundet sind das 169,3 km. Damit ist der Rennsteig insgesamt ca. 1 km länger als nach dem historischen Maß 168,3 km. Die Erfassung erfolgte bewusst nicht mit moderner Messtechnik, sondern mit Hilfe jener Methoden, die Vergleichswerte zu den historischen Messungen zulassen.
Für Genauigkeitsuntersuchungen wurden Teststrecken vergleichsweise mit dem elektrooptischen Steckenmess-gerät, mit dem Messband, mit GPS-Technik (aller Genauigkeitsstufen), mit dem Messrad, mit Lasergeräten und tachymetrisch gemessen. Dabei stellten wir fest, dass das Messrad auf den Teststrecken bereits bei glattem Untergrund (Asphalt) zwischen Hin- und Rückmessung erhebliche Differenzen im Meterbereich aufwies, die nicht kompensiert werden konnten. Aus diesen Gründen wurde auf das Messrad gänzlich verzichtet.
Dreiherrensteine
Im Verlauf des Plänknerschen Rennsteiges gibt es Grenzpunkte, an welchen in den vergangenen Jahrhunderten 3 Herrschaftsgebiete aneinander gestoßen sind. Diese Punkte wurden mit sogenannten Dreiherrensteinen markiert. Entlang des Rennsteiges gibt es insgesamt 9 solcher Dreiherrensteine. Die in der Literatur und im Internet verwendete Zahl 13 ist falsch, weil hierbei 4 Dreiherrensteine mit hinzu gerechnet wurden, die nicht am Rennsteig stehen.
Dreiherrensteine am Rennsteig (von Ost nach West)
- Dreiwappenstein am Kießlich
- Dreiherrenstein Hoher Lach
- Dreiherrenstein Am Saarzipfel
- Dreiherrenstein Hohe Heide
- Großer Dreiherrenstein
- Dietzel-Geba-Stein
- Gustav-Freytag-Stein
- Dreiherrenstein Am Hangweg
- Dreiherrenstein Am Großen Weissenberg
- Dreiherrenstein Hohe Tanne (65 m)
- Dreiherrenstein im Sperbersbach (10 km!)
- Kleiner Dreiherrenstein (300 m)
- Dreiherrenstein Am Glasbach (1 km)
Runst
Der Rennergruß "Gut Runst"
Gut Runst, Gut Runst, Gut Runst! Oh lebe fort auf edle Art,du herrlich schöne, du schöne Rennsteigfahrt - Gut Runst!

1956, Runstgesang am Waldhaus "Weidmannsheil" (Foto: Günther Weiss)
Bereits im Jahre 2002 veröffentlichte ich im damaligen Mitteilungsblatt des Rennsteig-Museums Neustadt am Rennsteig (Heft 2/2002, Seite 29-30) eine erste Deutung des Begriffes "Gut Runst" nach meinen ausführlichen Recherchen der geschichtlichen Hintergründe des Grußes. 2009 stellte ich diesen Beitrag im Mareile, Bote des Rennsteigvereins vor. Auf beide Artikel befindet sich ein Hinweis weiter unten im Beitrag unter der Überschrift: Quellen. Ich werde auch weiterhin versuchen aktuelle Rechercheergebnisse auszuwerten und auf meiner Homepage zur Verfügung zu stellen, bitte jedoch darum, bei Nutzung meiner Ausführungen für Veröffentlichungen, das Urheberrecht zu beachten, wobei ich kommerzielle Nutzung ohne vorherige Vereinbarung nicht gestatte.
Die Geschichte des Rennergrußes beginnt zur Pfingstrunst im Jahr 1900. Vom 02. Juni bis 08. Juni wollte man den Rennsteig von Blankenstein bis Hörschel bezwingen. Am 02. Juni, abends, fand im Waldhaus die Jahres-hauptversammlung statt. Anlässlich dieser Versammlung wurde aber, wie aus den nachfolgenden Ausführungen hervor geht, der Rennergruß "Gut Runst" nicht geprägt.
Vielmehr geht aus Berichten von Beteiligten der damaligen Runst hervor, dass der Gruß offenbar am 04. Juni 1900 in den Morgenstunden an der Teufelsbuche geprägt wurde.
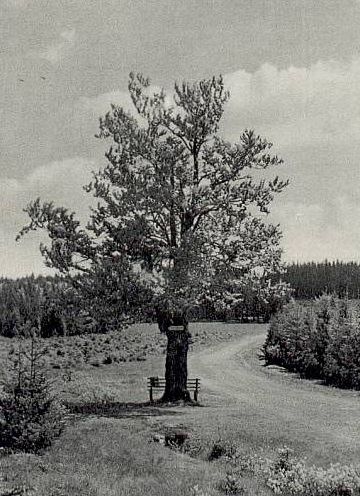
Teufelsbuche um 1950 (Foto: fotoarchiv-rüger)
Zuerst wurde der Schriftführer Hartenstein als geistiger Vater des Grußes genannt. Dieser verneinte aber in einer Stellungnahme im Mareile vom 05. Juli 1900 auf Seite 5, der geistige Vater dieses Scheusals zu sein. Er geht davon aus, dass der Gruß in den heißen Tagen des 02. bis 06. Juni entstanden ist.
Die erste schriftliche Erwähnung erfolgte am 07. Juni 1900 auf einer Postkarte, die Josef Berta an Ludwig Hertel von der Wartburg schrieb:
Was ist da meine ganze Kunst gegen seine gewaltige Runst!
Diesen Spruch lässt Berta einen Wartburgesel ausrufen, der seine Leistungen mit denen eines Renners vergleicht.
Um nun endgültige Gewissheit über den Zeitpunkt der Entstehung des Rennerspruches zu erhalten, müssen wir in das Jahr 1930 gehen.
Dort meldet sich der wirkliche Vater von "Gut Runst", Josef Berta, zu Wort:
So kam das Rennerhäuflein am Porphyr Trinii, der Schwalbenhauptwiese vorbei zur Teufelsbuche.
Hier, auf der Bank unter dieser merkwürdigen Buche wurde der seltsam anmutende Rennergruß
"Gut Runst" geprägt.
Soweit die Anmerkungen von Josef Berta im Mareile Nr. 5 vom 01. September 1930 auf Seite 136 – 137.
Noch auf der Bank an der Teufelsbuche sprachen Hartenstein, Hertel und Berta über die Notwendigkeit eines einheitlichen Rennergrußes. Eben da betonte Hertel, dass "Kunst" nicht von "können", sondern von "kennen" abzuleiten ist. Darauf folgerte Berta logischerweise, dass man "Runst" von "rennen" ableiten kann.
Frei nach Hertel kann man den Spruch auch so interpretieren:
Kunst kommt von kennen,
Brunst kommt von brennen
und
Runst kommt von rennen.
Der Spruch wurde mehr oder weniger ironisch in Gebrauch genommen, er hielt sich trotz seiner Derbheit und ist heute nicht mehr aus dem Sprachgebrauch der Renner zu verdrängen.
Übrigens wird im Wörterbuch der Deutschen Sprache von Jacob und Wilhelm Grimm im Band 11 der Begriff Kunst von können abgeleitet, eine weitere Deutung, die aber für unsere Betrachtung nicht weiter relevant sein soll.
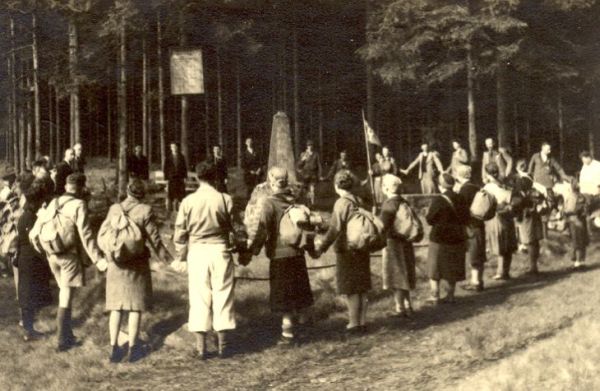
Runstgesang am Dreistromstein um 1950(Foto: fotoarchiv-rüger, Repro)
Auch die Sprachwissenschaft versuchte, den Begriff "Runst" zu deuten. Folgende Erklärungen wurden dabei gegeben:
1. Der Begriff Runs, Runs, Runst stammt aus dem Schwäbischen und wird dort mundartlich rons mit nasaliertem au gesprochen, daher oft auch Rauns geschrieben.
Er bedeutet das Fließen des Wassers, Wasserrinne, Bachbett, Graben, auch Felsspalt, steiler Bergeinschnitt, auf dem Holz zu Tal befördert wird.
2. In Band 14 des Wörterbuches der Deuschen Sprache wird Runst in Verbindung mit fließendem oder strömenden Wasser genannt (vergl. dazu auch den Begriff: blutrünstig), vielleicht auch in weiterem Sinne in der Bedeutung von laufendem Wasser.
3. Übersetzung aus dem Englischen: to run = rennen, laufen
Hier finden wir also die Querverbindung zu Laufen wieder, die in diesem Zusammenhang eigentlich auch Sinn macht.
Quellen
- Eigene Recherchen
- Mareile, Bote des Rennsteigvereins. Zweite Reihe. 05. Juli 1900. Seite 3,5.
- Mareile, Bote des Rennsteigvereins. II. Jahrgang. Nr. 5 vom 01. September 1930. Seite 136-137.
- Julius Kober: Im Zauberbann des Rennsteiges. Engelhard-Reyher-Verlag. Gotha 1939. Seite 107.
- Josef Schnetz: Flurnamenkunde 2. unveränderte Auflage. Erschienen im Selbstverlag des Verbandes für Flurnamenkunde in Bayern e.V. München 1963. Seite 51.
- Jacob und Wilhelm Grimm: Wörterbuch der deutschen Sprache. Mehrere Bände.
- Rennsteig-Museum. Mitteilungsblatt. Heft 2/ 2002 vom 01.07.2002. Seite 29-30. "Gut Runst" - seit 1900 Rennergruß am Rennsteig-Hintergründe und Bedeutung. Ulrich Rüger
- Mareile, Bote des Rennsteigvereins. 16. Jahrgang. Nr. 2 vom 01. Mai 2009. Seite 38-40 (Umschlagseite). Beitrag von Ulrich Rüger.
- Wolfgang Pfeifer: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (EtymWB). Akademie der Wissenschaften der DDR.

Runstgesang 1940 (Repro: archiv-rüger)

Runstgesang jetzt, 2001 in Masserberg
Recherchiert habe ich den Begriff "Runst" auch im deutschsprachigem Bereich anderer Länder in Europa. So konnte ich beispielsweise im Vinschgau im Umkreis des Ortes Naturns in Südtirol eine Straße mit dem Namen "Via Runst" finden, die an einem "Runst-Hof" vorbei führt und oben am Berg bei einer "Runster-Mühle" endet.
Nach meinen Recherchen im Meraner Stadtarchiv, hat der Name Runst in Südtirol eine ähnliche Bedeutung wie bereits oben erwähnt in Schwaben.

Via Runst in Naturns, Vinschgau, Südtirol

der Wegweiser zur Runster-Mühle

vorbei am Runst-Hof

die Mühle


Im Landkreis Traunstein im Freistaat Bayern gibt es einen kleinen Fluss mit dem Namen "Runst", der in den Chiemsee mündet.
Ich bin mir sicher, dass es im deutschsprachigem Raum noch weitere geografische Namen mit der Bezeichnung "Runst" gibt und ich denke, dass der Begriff "Runst" nicht der Fantasie von Hertel, Hartenstein oder Berta entsprungen ist, sondern ganz einfach ein zwar selten gebrauchter volkstümlicher Ausdruck in bestimmten geografischen Regionen des deutschsprachigen Raumes ist, der bereits lange vor seinen "angeblichen" Erfindern bekannt war. Rückschlüsse darauf finden sich beispielsweise im Etymologischen Wörterbuch von Wolfgang Pfeifer. Dort lässt sich das Wort "Runst" bis in das Altlhochdeutsche als "runs", "runsa", Lauf, Strom, Flut, fließendes Wasser, bis in das 8. Jh. zurück verfolgen.
Runstordnung
Mit freundlicher Erlaubnis des Rennsteigvereins 1896 e.V. stelle ich die momentan gültige Runstordnung für die offizielle Durchführung einer Rennsteigwanderung nach den Richtlinien des Rennsteigvereins 1896 e.V. für verschiedene Rennsteige im deutschen Sprachraum ohne Wertung vor:
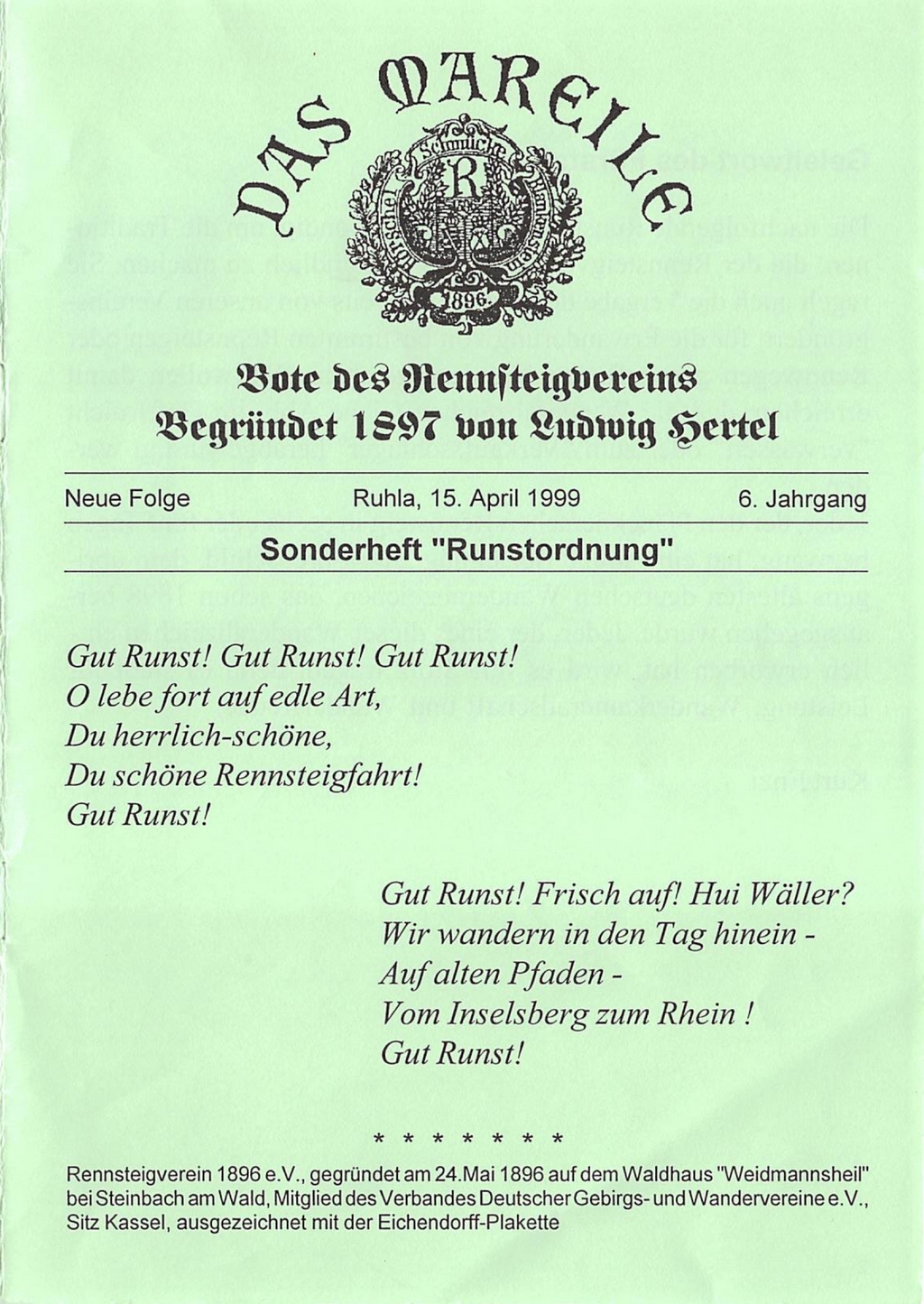
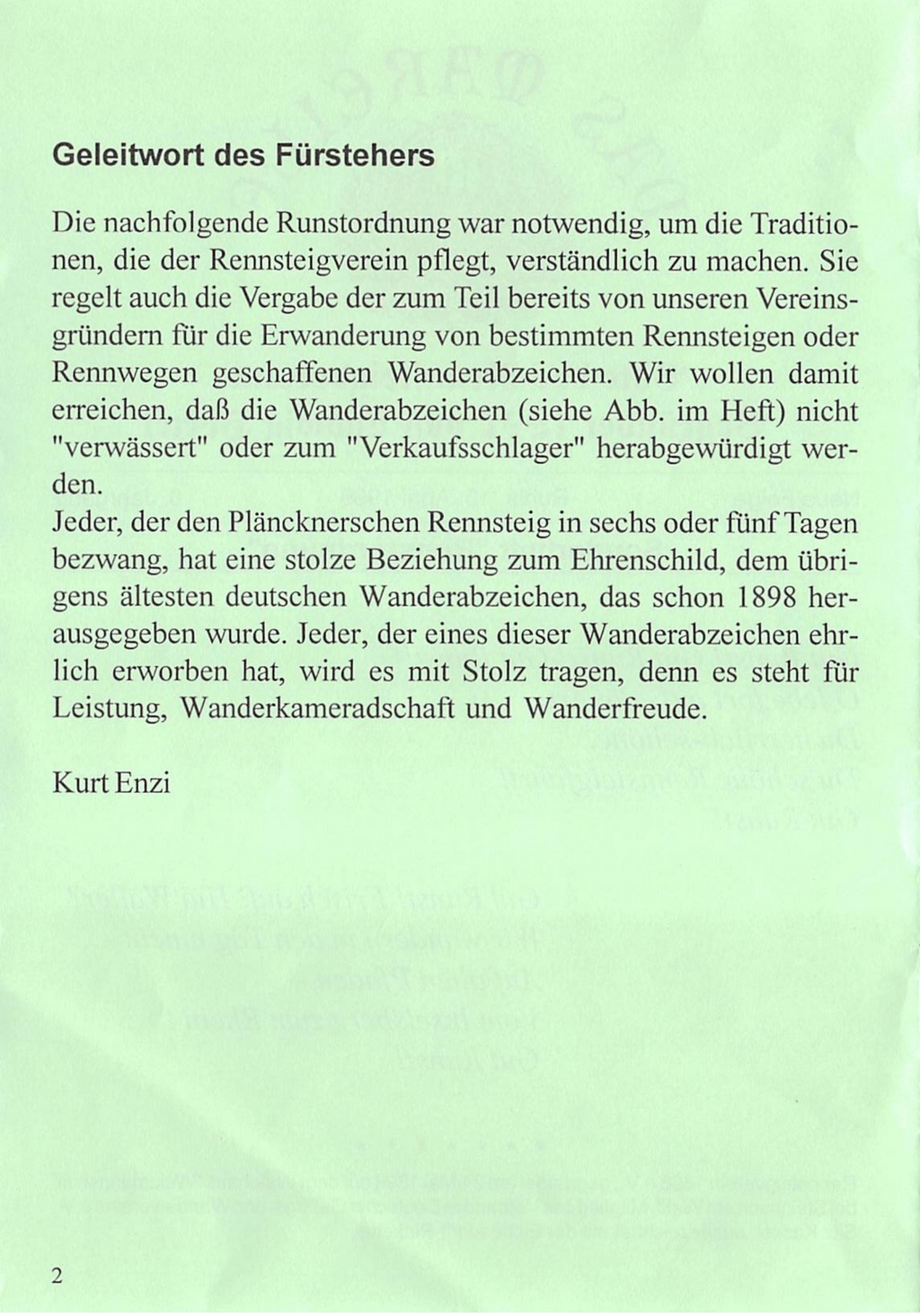
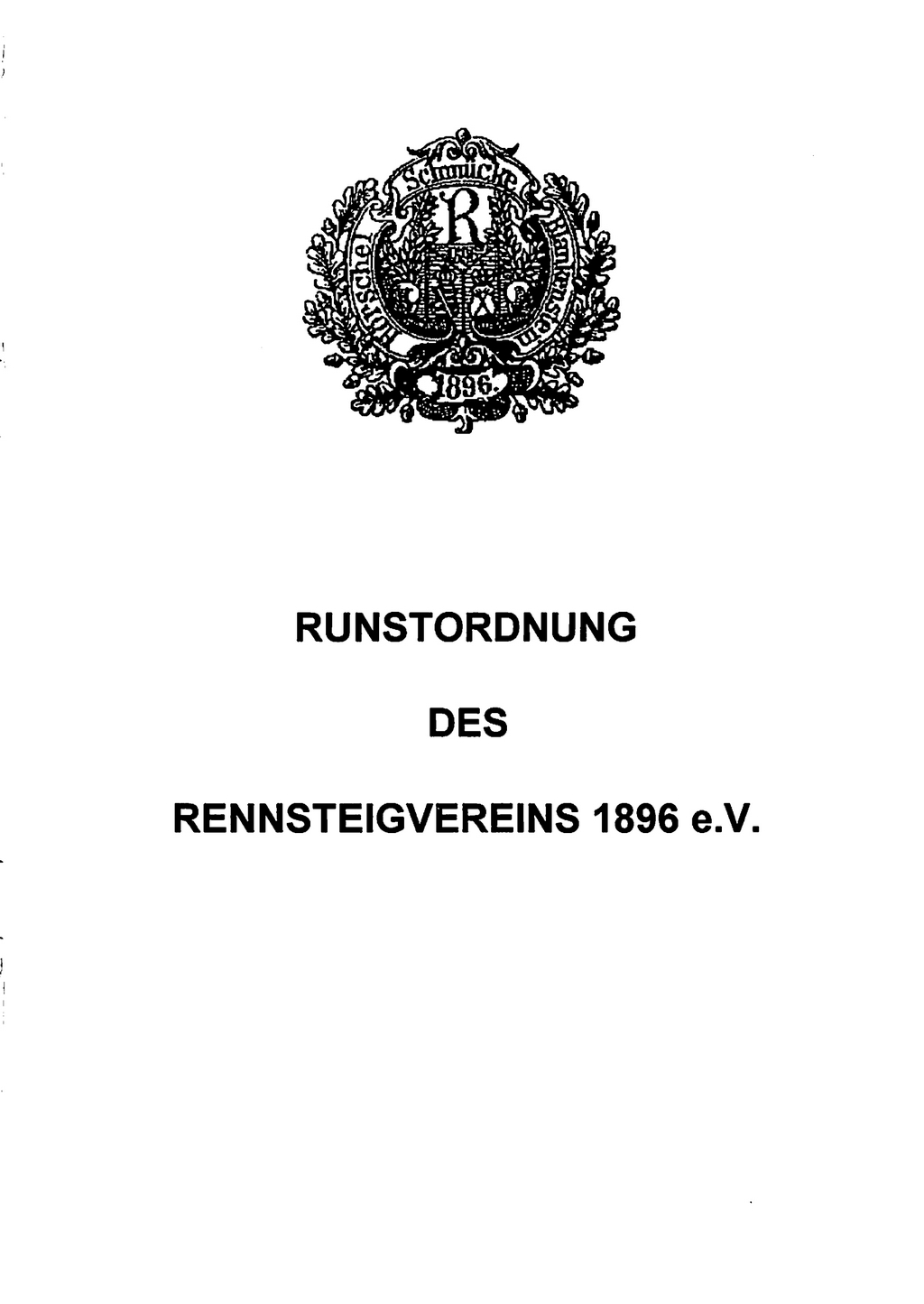
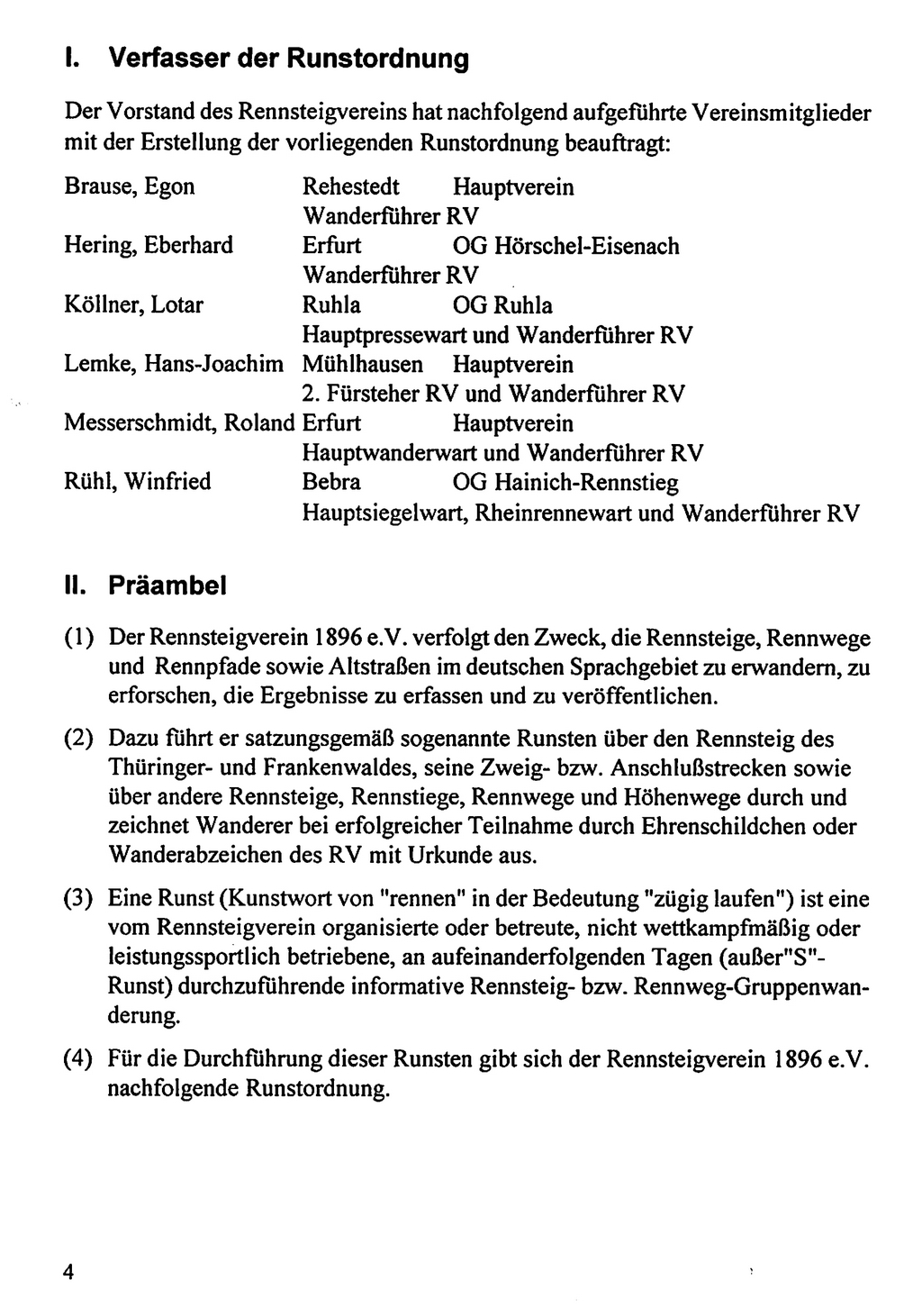
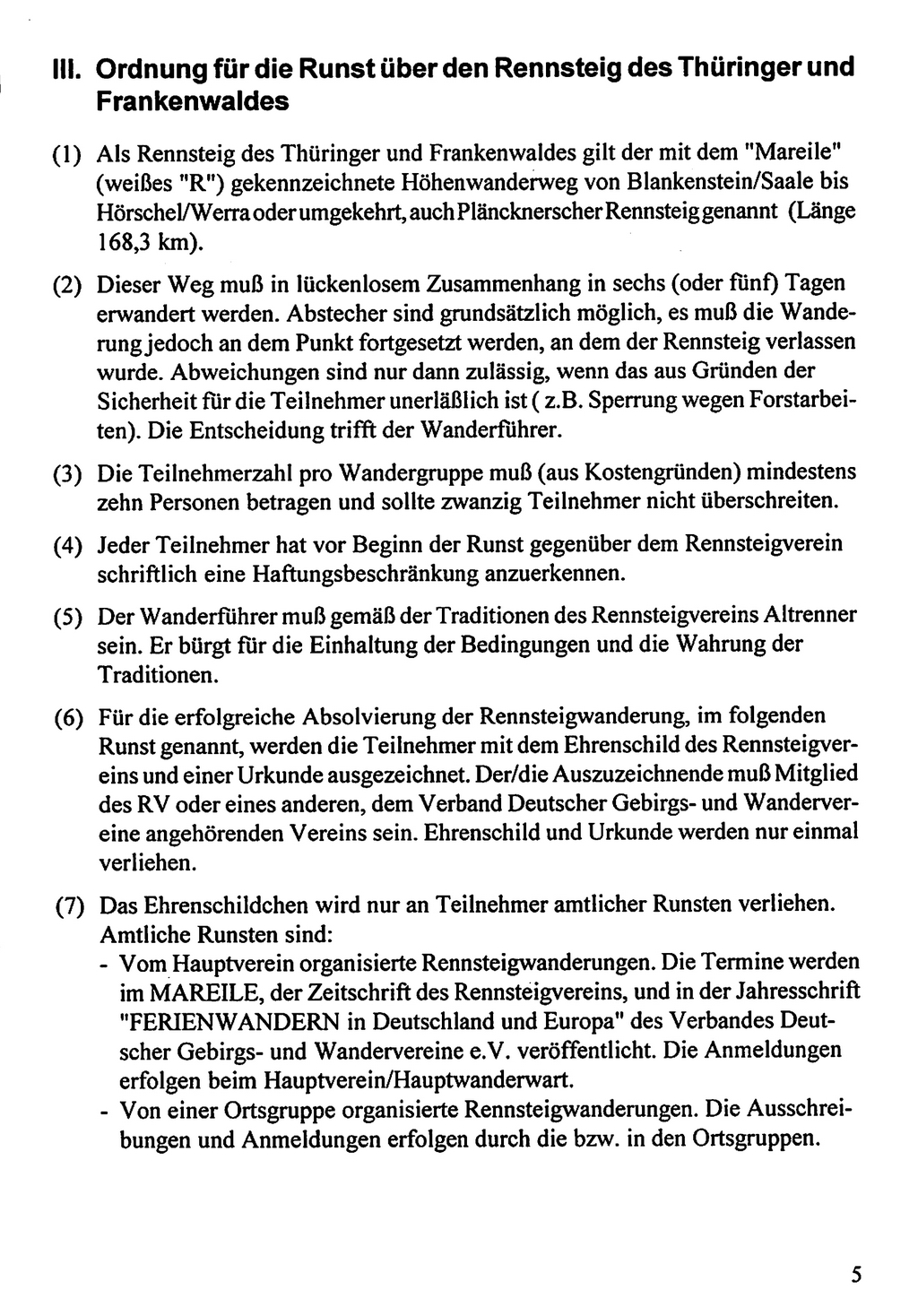
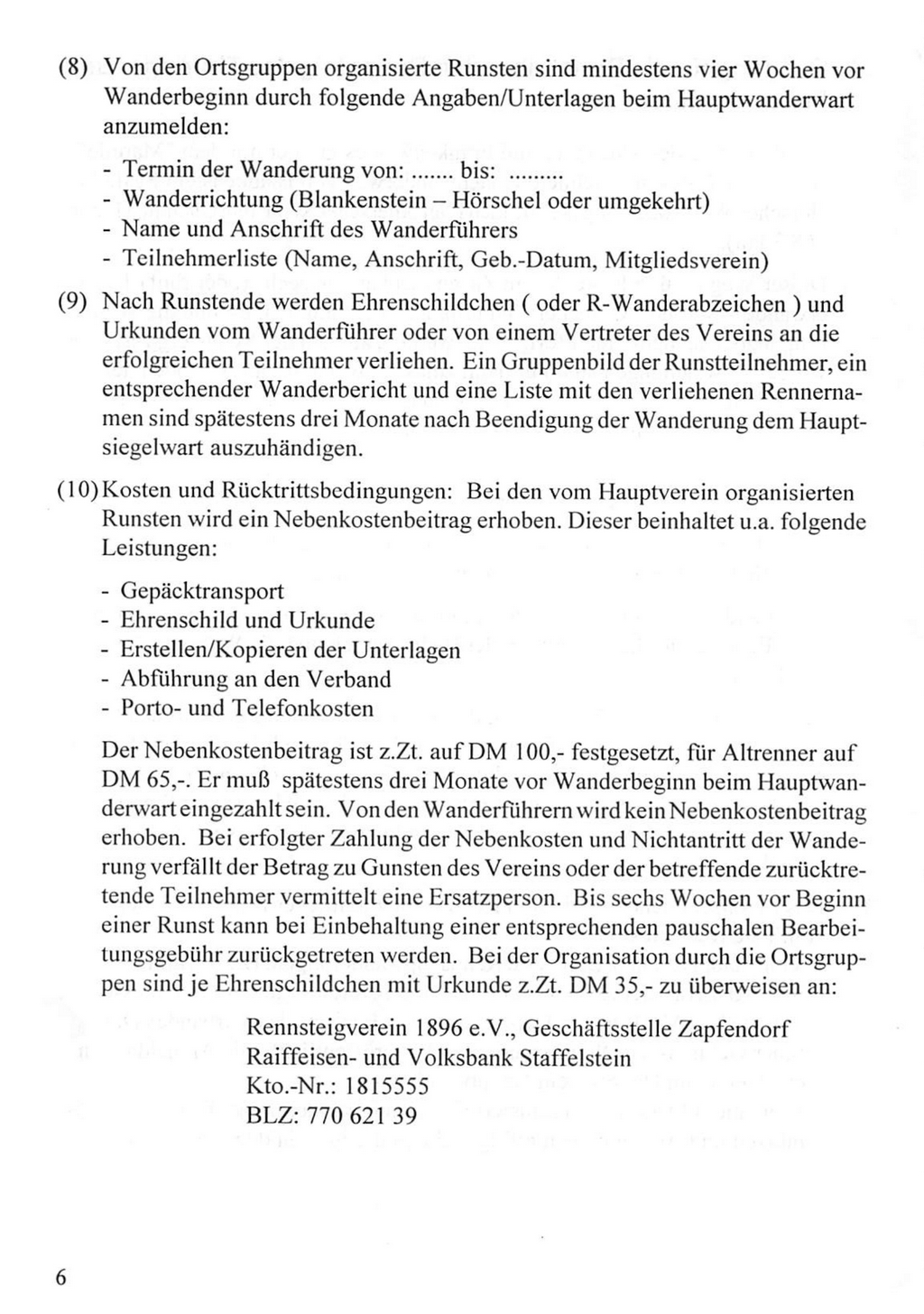
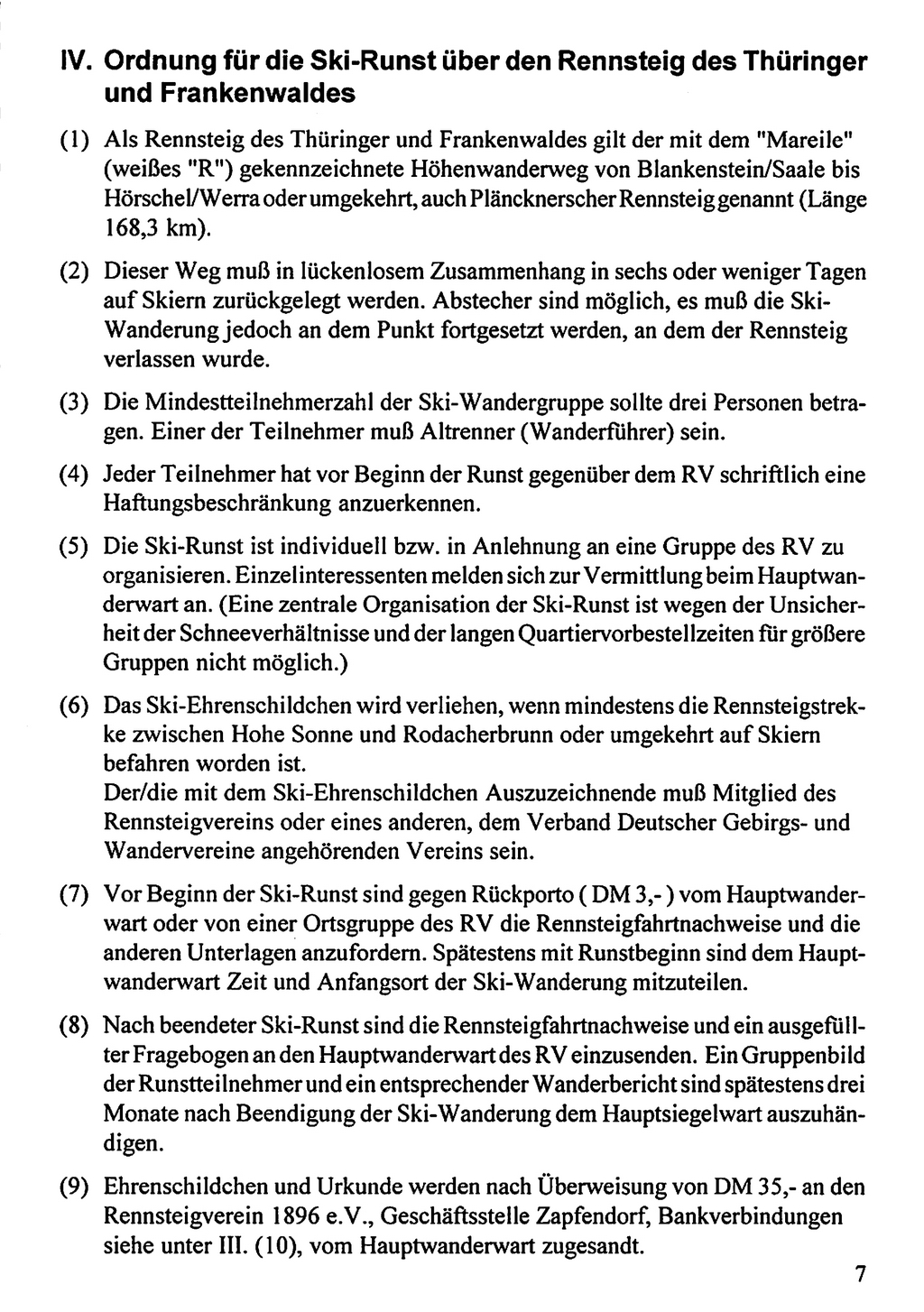
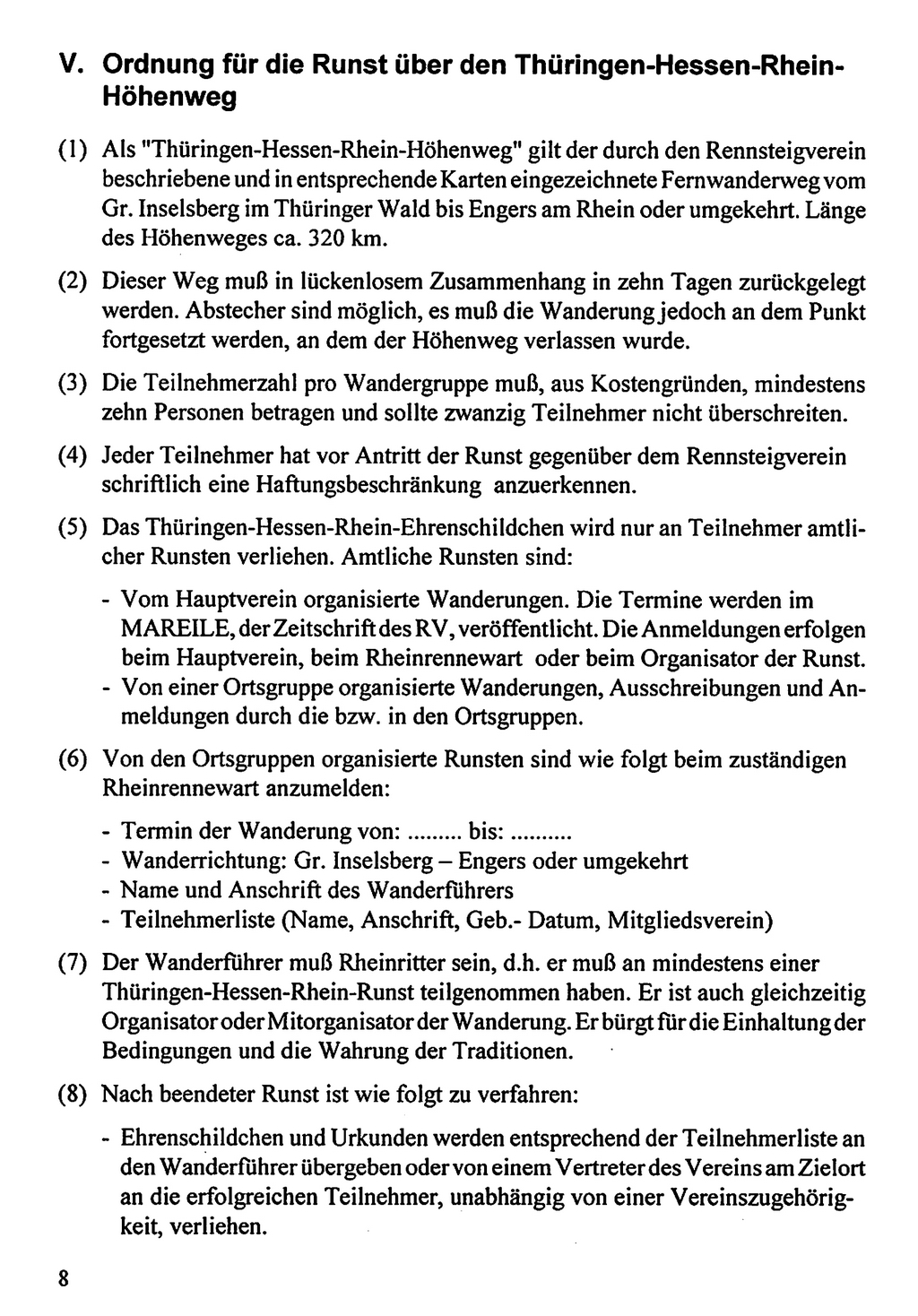
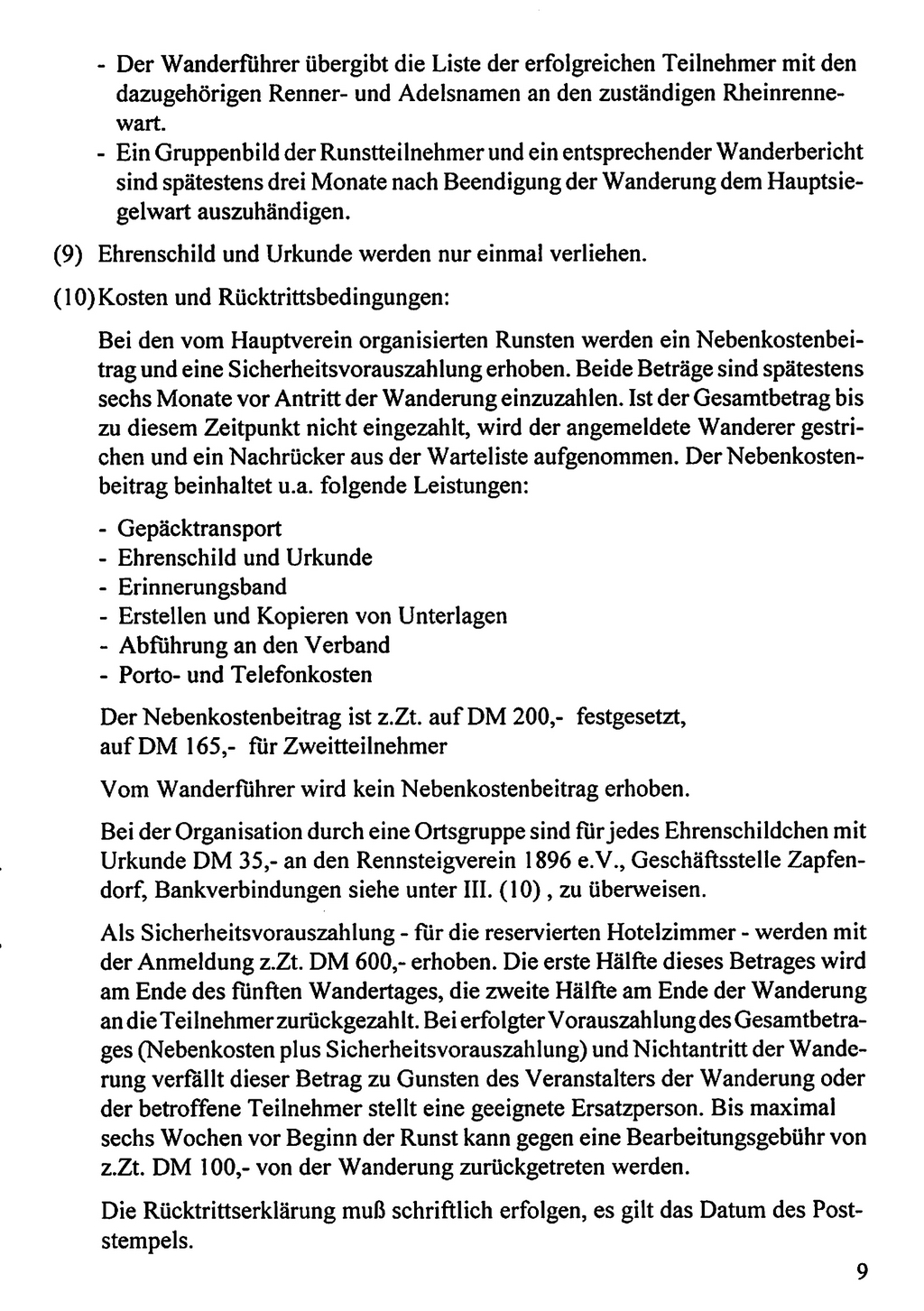
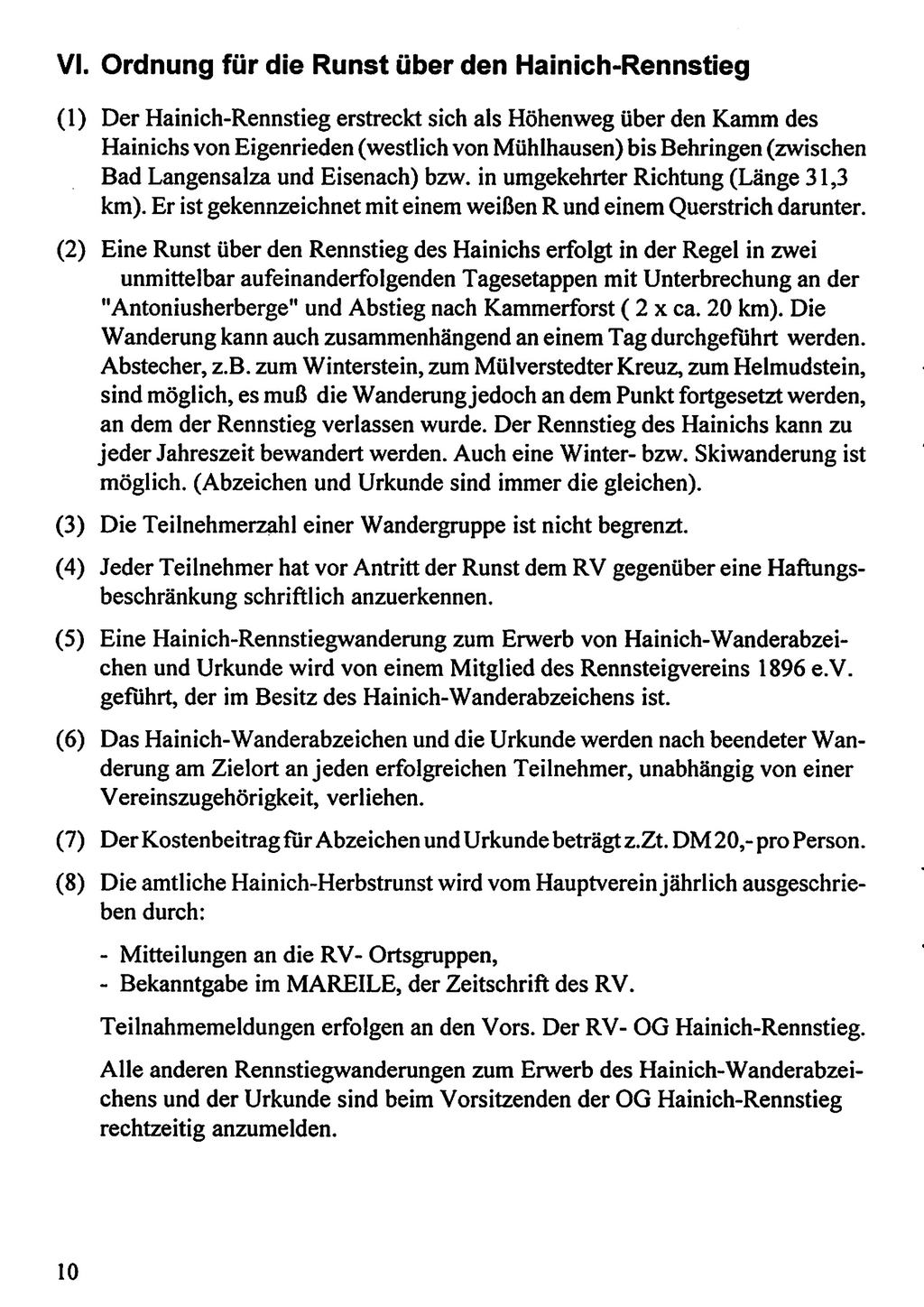
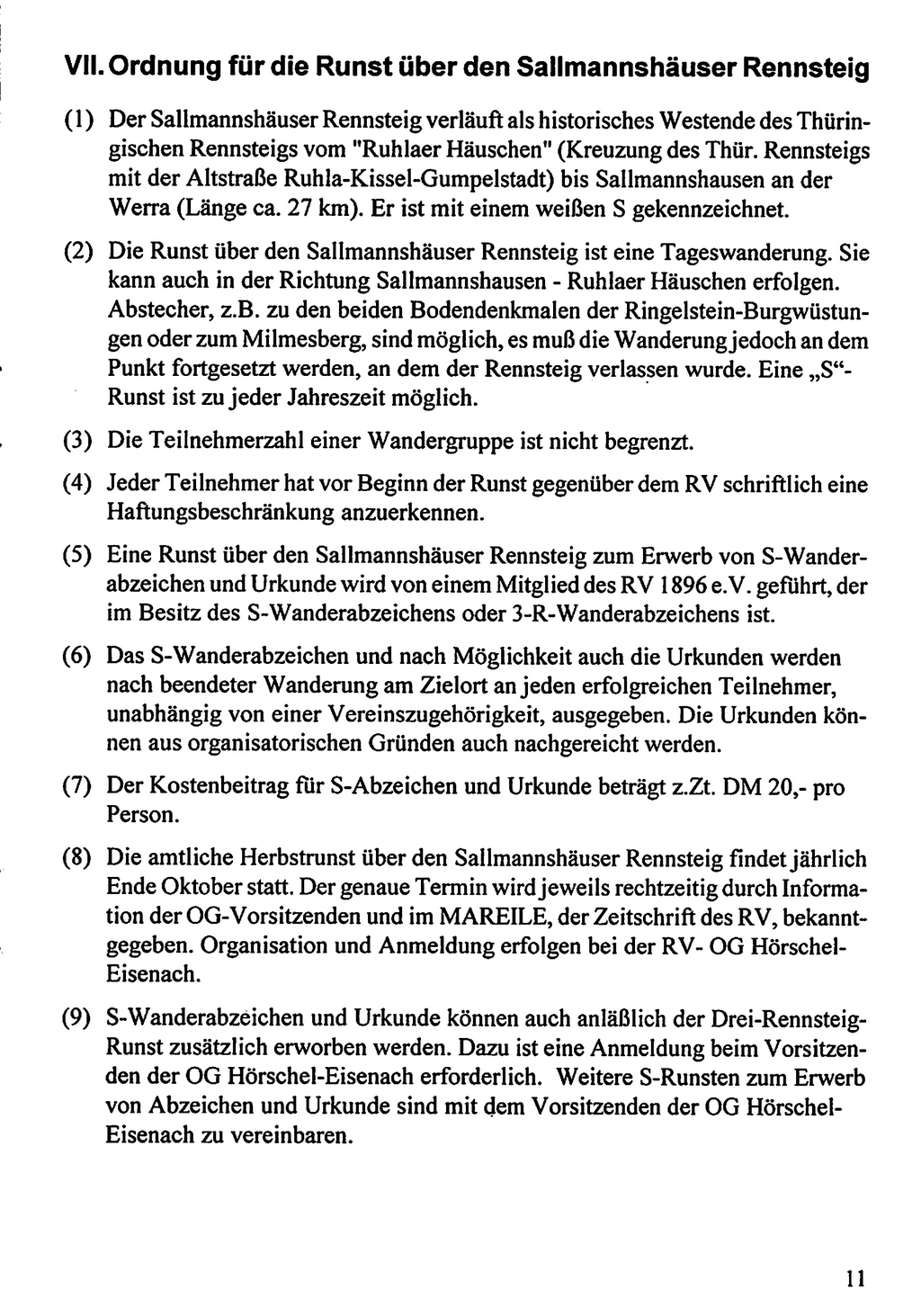
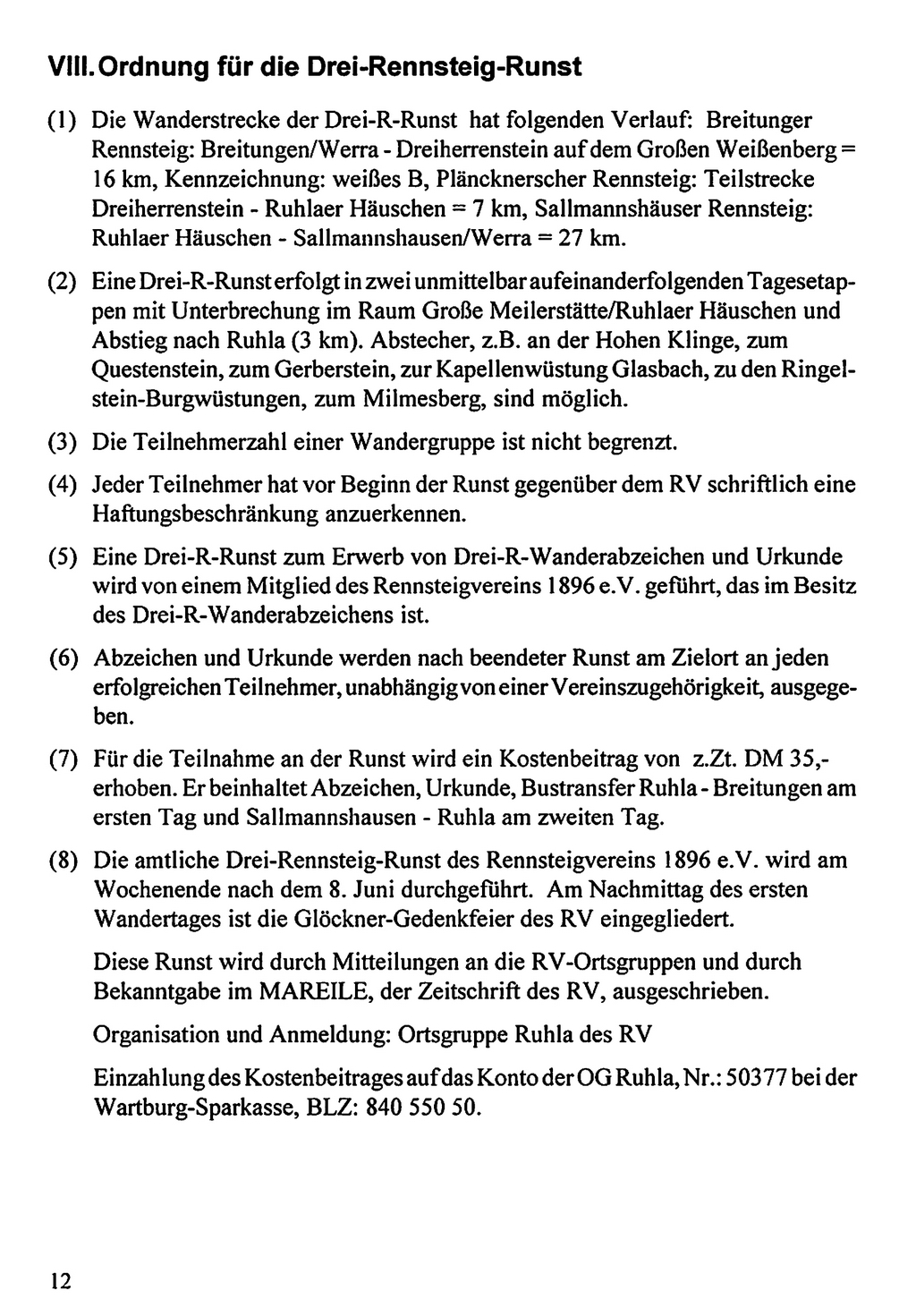
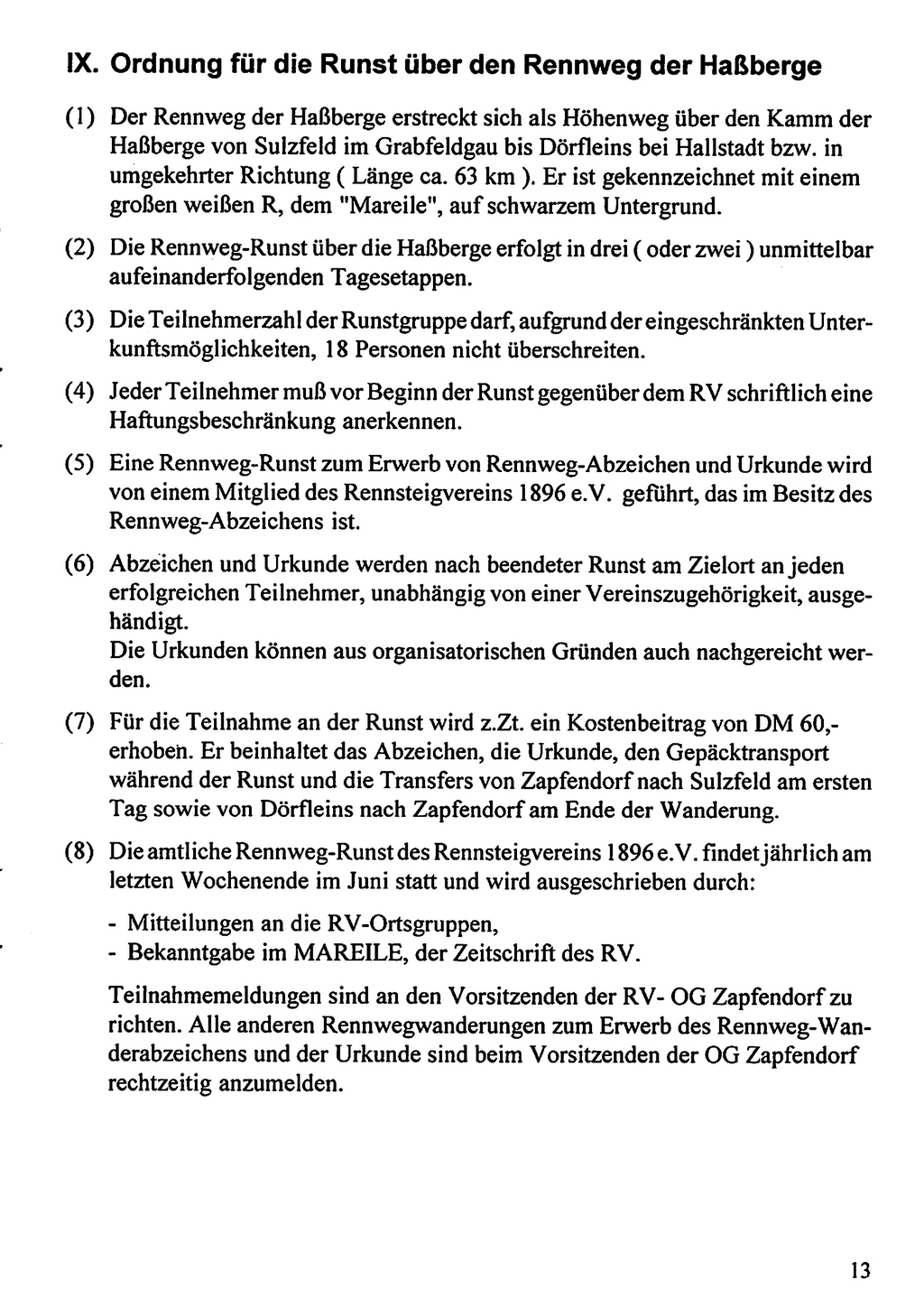
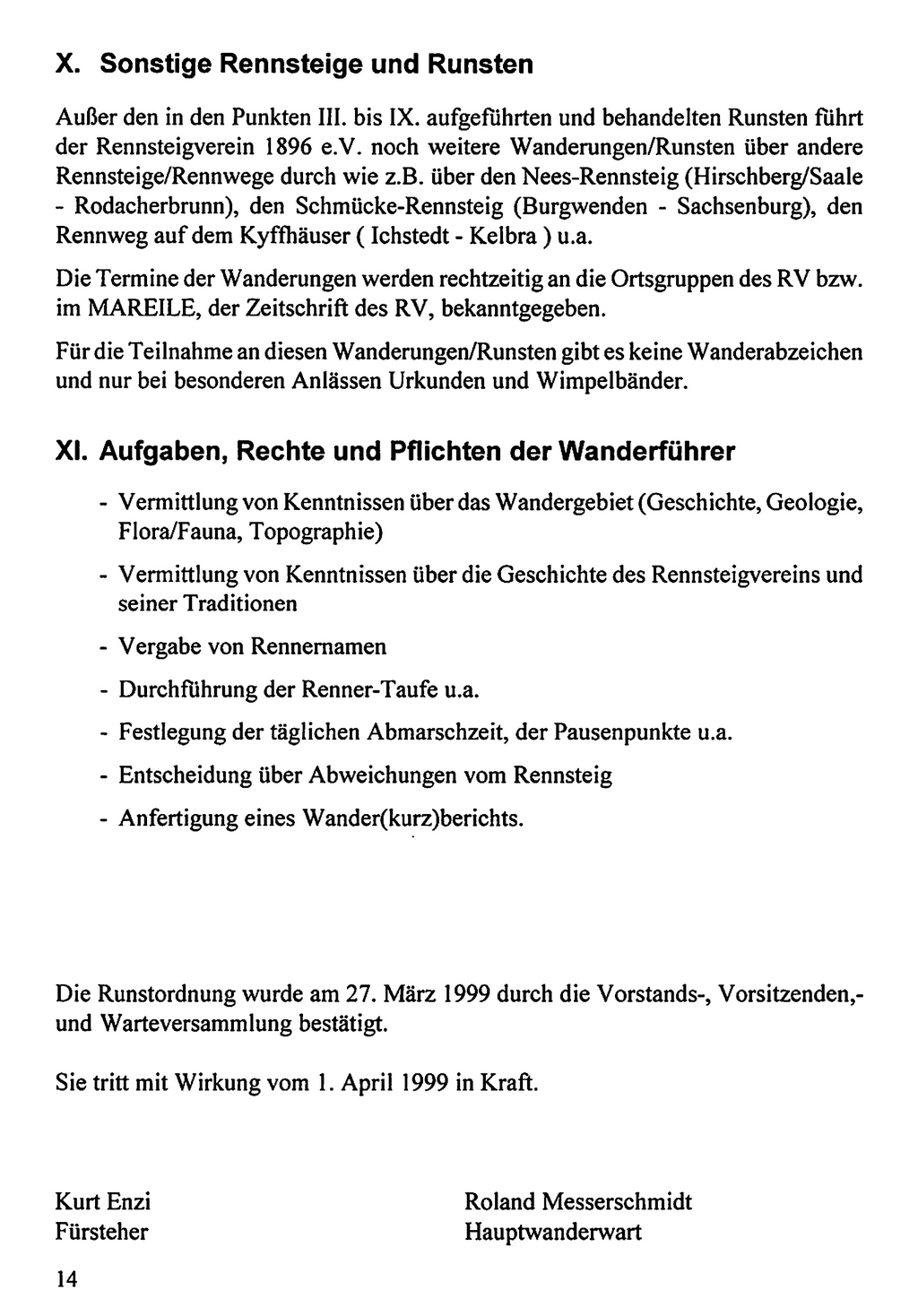
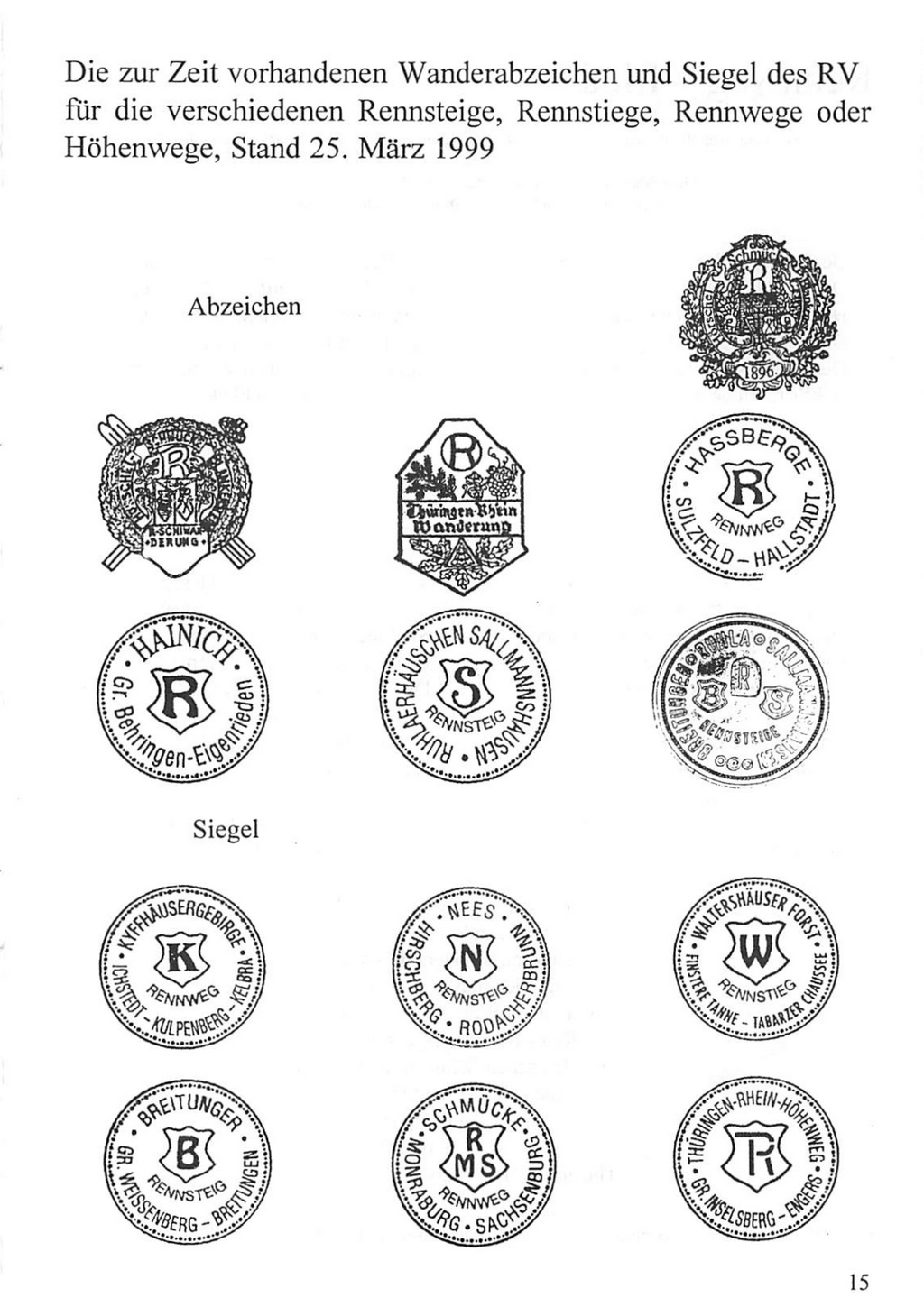
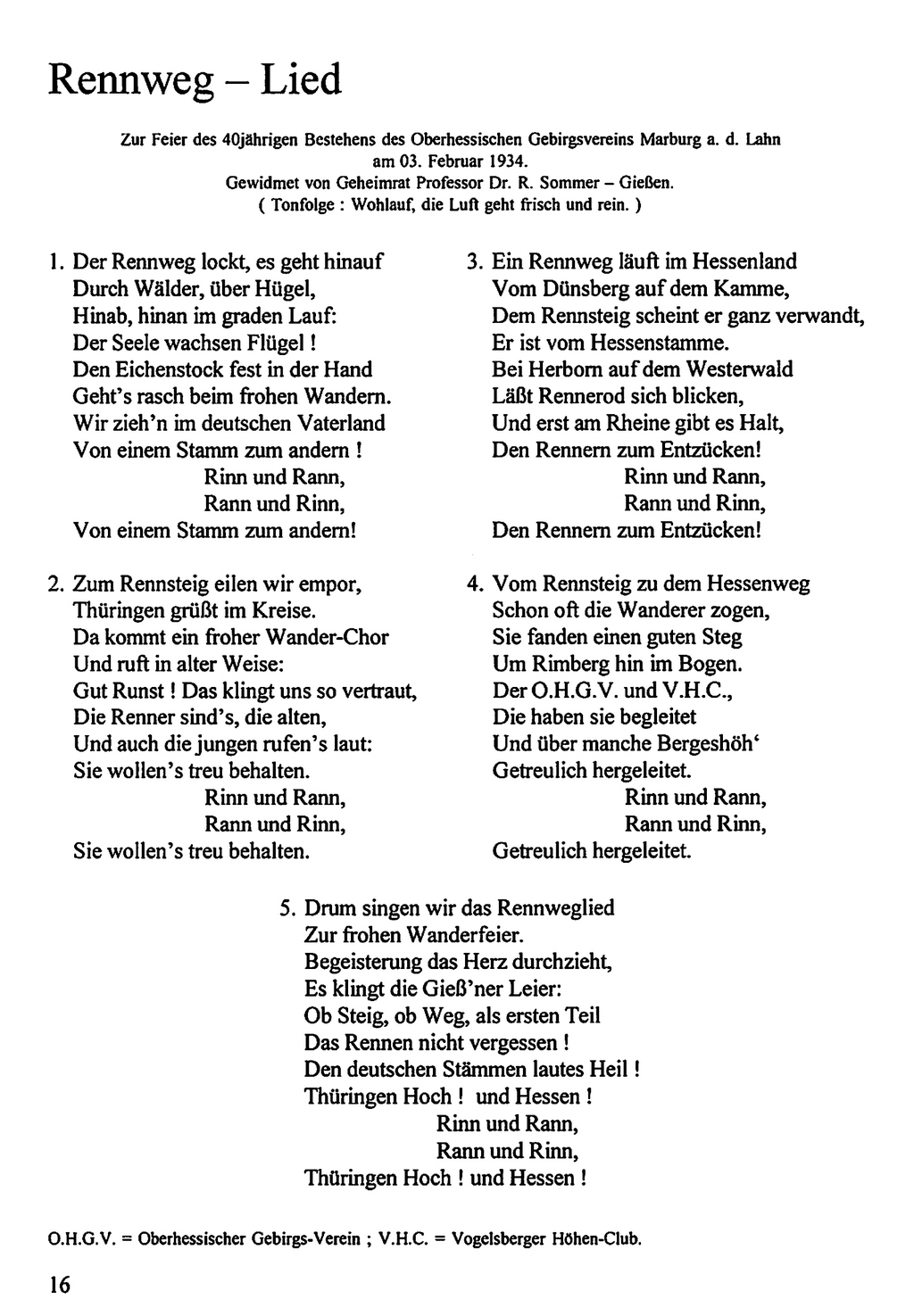
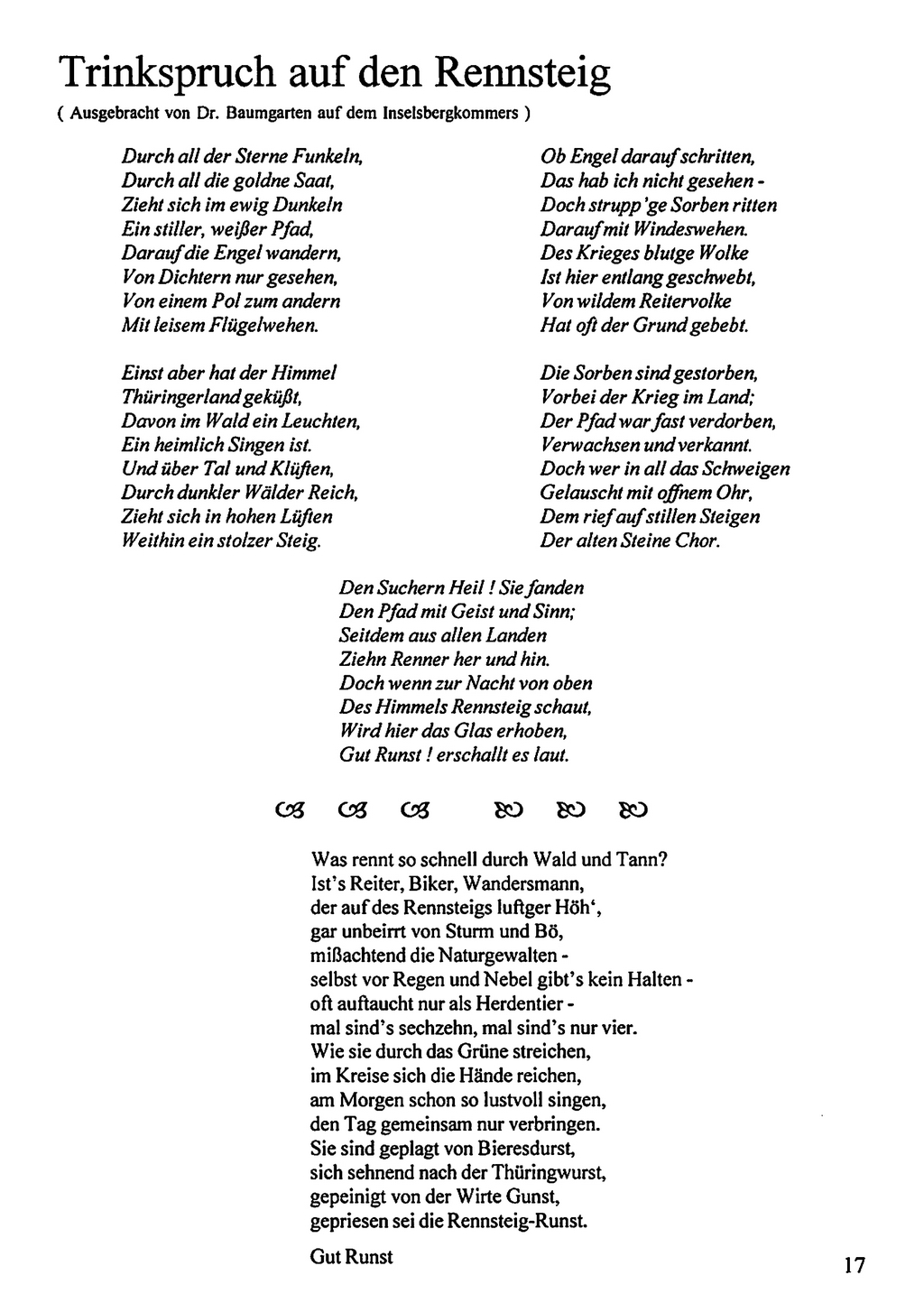

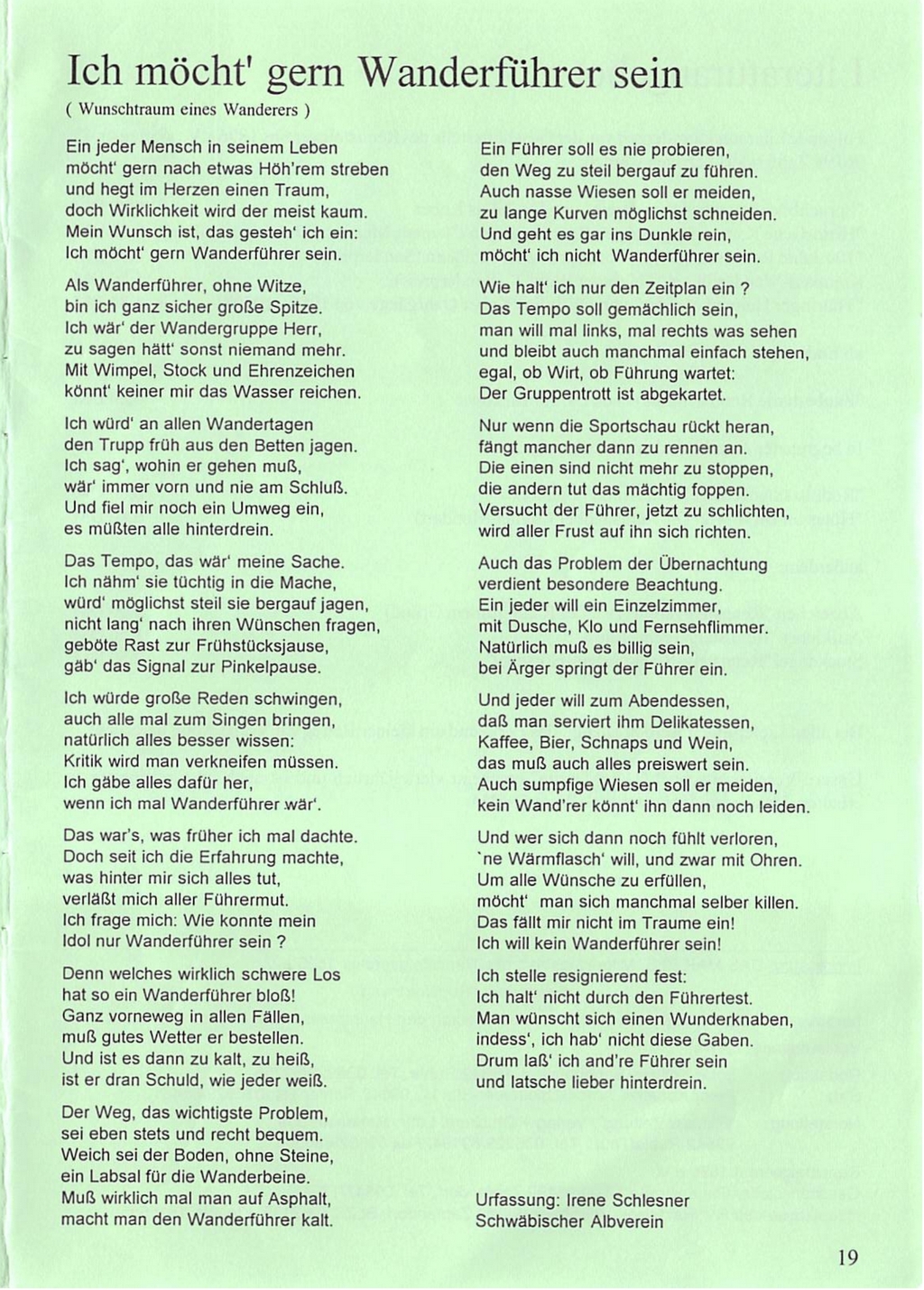
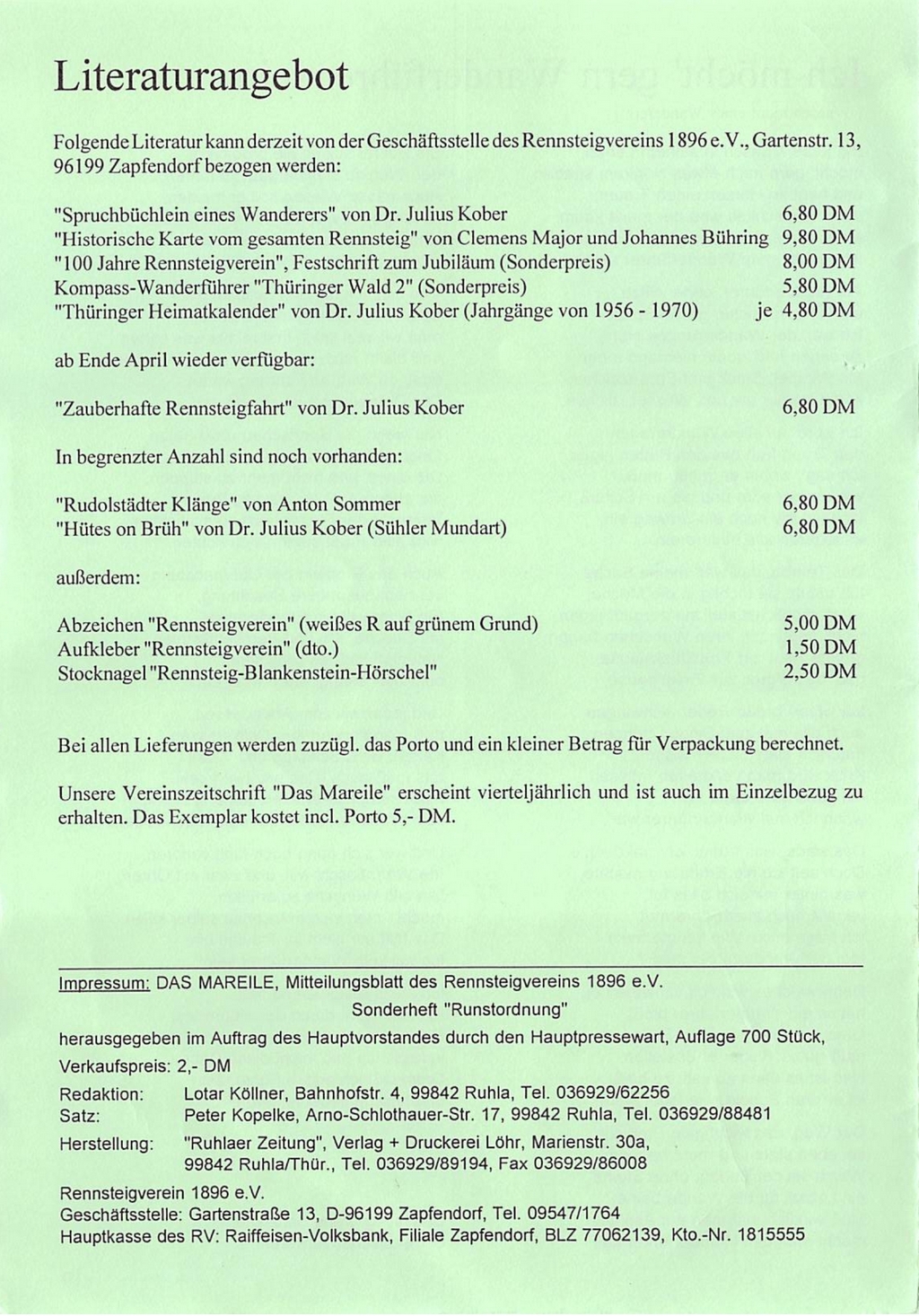
Quelle: Das Mareile, Bote des Rennsteigvereins. Begründet 1897 von Ludwig Hertel.
Neue Folge, 6. Jahrgang. Ruhla, 15. April 1999. Sonderheft "Runstordnung".
Sagen
Der Bilbert
Aus: Constantin Kümpel: Bei den Goldsuchern. Ein kulturhistorisches Bild aus Thüringens Vorzeit. Verlag G. Neuenhahn. Jena 1927. Seite 191-192.
In fernen Landen lebte einst ein hochbetagtes Ehepaar. Es hatte 8 Kinder. Sieben davon waren recht brav und daher bei allen Leuten gerne gesehen und wohlgelitten. Das achte Kind – wir wollen es Dietrich nennen – war ein Tunichtgut. Alle Ermahnungen der Eltern und Geschwister reichten nicht aus, den Knaben vom Verderben zu retten. Grausam und herzlos gegen die Tiere, scham- und gefühllos gegen seine Kameraden, frech gegen die Eltern und Erwachsenen: das waren die Eigenschaften, auf die er sich etwas einbildete. Die Eltern starben aus Gram, die Geschwister jagten den Bengel endlich aus dem Hause.
Aber die Welt sah anders aus, als er sich einbildete. Weil er die Arbeit scheute, so behielt ihn niemand. Der Hunger trieb ihn zum Diebstahl. Er wurde Gewohnheitsdieb und Einbrecher, Räuber und Todschläger. Niemals gelang es, des Verbrechers habhaft zu werden. Viele Jahre lang war er ein Schrecken allerlei Länder. Die zahllosen Schandtaten, die er beging, zermürbten seine Seele, zuletzt aber auch seinen Körper, so dass er keine Kraft mehr fand, Gewalt anwenden zu können.
Da führten ihn seine Irrwege in die Gegend der „Steinernen Heide“. Er hörte, dass es hier Gold gab. Am Sandberg des Göritztales fand er in den Trümmern der eingestürzten Sandsteinwand eine Höhle. In diese kroch er hinein und überlegte es sich, auf welche Weise er einen Raub ausführen könne, ohne allzu viele Kraft anwenden zu müssen.
Endlich hatte er einen Plan. Sobald es dunkel wurde, zog er einen Draht über den Weg, der viel von Handelsleuten begangen wurde. In der Höhle war dieser Draht mit einer Klingel versehen. Wenn nun jemand des Weges kam und an den Draht stieß, so kam er zu Fall. Dabei klingelte es aber in der Höhle. Dietrich sprang dann herbei und raubte den Gestürzten aus, noch ehe er recht zur Besinnung kam.
Diese Überfälle glückten viele Wochen lang und niemand auf der „Steinernen Heide“ getraute sich mehr, den gefährlichen Weg zu gehen. Da fielen die Leute in der bedrohlichen Gegend auf die Knie und baten Gott in ihrer Not, sie von dem Scheusal zu erlösen. Und Gott half.
In der Nacht erhob sich ein furchtbarer Sturm und trieb über der „Steinernen Heide“ alle Gewitterwolken zusammen. Ununterbrochen fielen feurige Schlangen vom Himmel. Der Regen goss in Strömen und alle Leute glaubten, die Welt gehe unter. Ein gewaltiger Blitz schlug in den Sandberg, warf die Steinblöcke durcheinander und versperrte Dietrich den Ausweg. In die Höhle aber strömte das Wasser und bereitete dem Unhold endlich den Tod. Der Brunnen aber, der unten am Sandberg quillt, heißt heute der Bilbertsbrunnen. An ihm heftet der Glaube, dass sein Wasser von allen Gebresten des Körpers befreie, wie Gott über ihm einst die „Steinerne Heide“ von einem Schrecken erlöst habe.
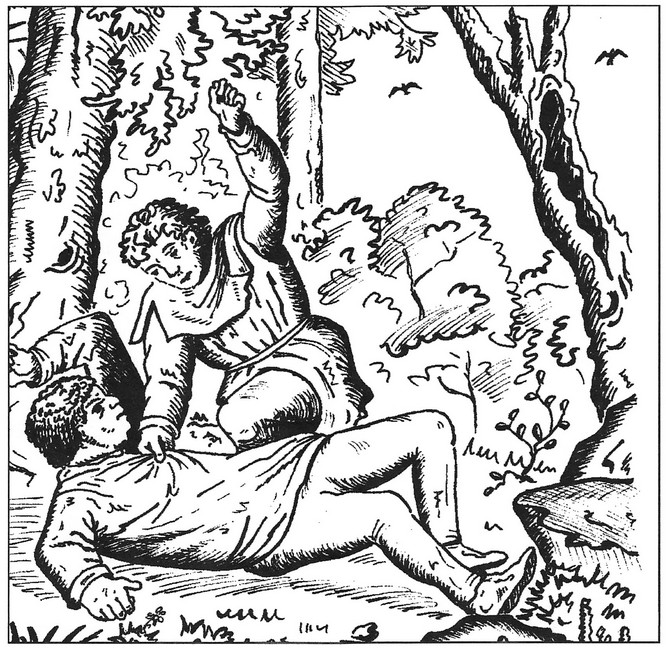
Der Teufel beim Brand von 1804
(Sage aus Steinheid)
Bei dem Brande im Jahre 1804 wurde beinahe das ganze Dorf ein Opfer des Feuers. Nur einige Häuser blieben übrig – und das kam so:
Als das Feuer auch auf diese letzten übergreifen wollte, ritt plötzlich ein Reiter auf schwarzem Ross einher und umkreiste die Häuser. Da hörte das Feuer auf. Der Reiter aber setzte mit seinem Rosse in großem Sprunge über die Antruf und verschwand unter Blitz, Donner und Schwefelgestank hinter dem Petersberg, seither heißt das Tal Teufelsgrund.
(Der „Teufel“ soll ursprünglich ein Spitzname für einen gewissen Eichhorn gewesen sein, der den Brand, um die letzten Häuser gehend „besprach“)
Die Frau am Hölzlein
(Sage aus Steinheid)
Auf den Wiesen am Hölzlein wurden einmal von einer Frau unbefugter Weise Grenzsteine versetzt.
Seit ihrem Tode treibt sie als Geist auf jenen Wiesen ihr Wesen, indem sie mit einer langen Stange messend einherschreitet.
Naht ihr aber jemand, so verschwindet sie plötzlich im Dunkel des Waldes.
Die verschüttete Goldader an der Fuchswand
(Steinheider Sage, nach H. Leuthäußer)
Vor langen Jahren lebte in Steinheid ein Bergmann bei seinen zwei Söhnen, mit denen er oft im Streit lag.
Da beschloss er, zu seiner Tochter nach Steinach zu ziehen. Der eine Sohn wanderte kurz darauf in die Fremde, der andere aber blieb in Steinheid und söhnte sich auch wieder mit seinem Vater aus. Als dieser nun auf dem Totenbette lag, ließ er seinen Sohn aus Steinheid kommen und vertraute ihm heimlich an:
Drüben über der Grümpen auf der Siegmundsburger Seite, läuft ein Wasser dem Berg hinab. Seine Quelle liegt unter der Vierhäuser Tanne. Fünf Schritte über dieser Tanne habe ich vor Jahren eingeschlagen und eine reiche Goldader entdeckt, die so ergiebig ist, dass man den ganzen Waldteil davon kaufen kann. Ich habe den Ort wieder verschüttet und dem Berggericht nicht gemeldet. Hätten wir uns nicht entzweit, so hätten wir zusammen die Fundstelle heimlich ausgebeutet. Allein konnte ich es nicht wagen. Nun siehe du zu, ob du Glück damit hast.
Der junge Bergmann schritt wenige Tage später seine fünf Schritte ab, schlug ein, fand aber nichts als taubes Gestein.
Der Goldsegen war dahin. Die alte Tanne aber, steht jetzt noch über der Quelle und ist ein uralter, riesig hoher Baum.
Satire
Der letzte Fußwanderer (Von H. Schilling, Wurzen)
Aus: Der Grenzbote. Zeitschrift für Politik, Literatur und Kunst. Verlag Grunow. 57. Jg. Leipzig 1898.
Bemerkung:
Aufgrund der Parallelen zur aktuellen Konfliktsituation Mountainbiker/ Wanderer am Rennsteig, eine sicherlich amüsante Satire aus der Zeit der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. (Rechtschreibung wurde stellenweise angepasst)
Im Jahre 1950 hatte der Fahrradsport eine Verbreitung erlangt, von der man sich am Ende des neunzehnten Jahrhunderts noch keine Vorstellung gemacht hatte, obgleich schon damals die Erwartungen hochgespannt gewesen waren. Dazu hatten unter anderen mehrere epochemachende Erfindungen beigetragen.
Nachdem der Kettenantrieb, dessen Nachteile sich mehr und mehr bemerkbar gemacht hatten, schon längst durch den Zahnradantrieb ersetzt worden war, er-fand ein Schneider in Kötzschenbroda das elektrische Rad, das unter dem Namen „Patent- Universal- Zentral- Normal- Idealrad- Elektric“ oder kürzer nach den Anfangsbuchstaben „Punznie“ schnell Verbreitung fand und seinen Erfinder ungeheure Reichtümer einbrachte; hinterließ dieser doch bei seinem Tode außer einem riesigen Barvermögen fünf Schlösser am Starnberger See und ausgedehnten Grundbesitz in Ungarn und Südrußland. Bei diesem Rade werden durch die Umdrehungen der Pedalkurbeln stehende elektrische Schwingungen (die schon früher bekannten Hertzschen Wellen) erzeugt und wirken unmittelbar an der Welle des Triebrades, wodurch man den Vorteil erzielt, daß jede Reibung wegfällt und die Übersetzung bis auf 225 gesteigert werden kann, was einer Geschwindigkeit von 48,17 Meter in der Sekunde entspricht.
Übrigens wurde durch ein Reichsgesetz wegen der mit einer solchen Geschwindigkeit verbundenen Gefahr für den Straßenverkehr eine Übersetzung von 112,5 als Maximalgrenze vorgeschrieben. Ein weiterer sehr bedeutender technischer Foertschritt war die Unzerstörbare Hyperideal- Transcendental- Pneumatik Adamas, „Uthpa“, die Erfindung eines jungen Technikers Namens Jahnert, der dadurch in 3 Wochen zum Millionär wurde. Zur Bekleidung der Radreifen verwandte dieser eine aus Steinkohlenteer dargestellte Verbindung, die die vierfache Härte des Diamants hatte und das bis dahin gebräuchliche Kautschuk an Elastizität und Biegsamkeit 3,4 mal übertraf, dabei vollständig undurchlässig war, eine Beschädigung durch Nägel, spitze Steine u. dergl. unmöglich machte und niemals einer Reparatur bedurfte. Zur Füllung wurde flüssiges Helium verwendet, das man damals in jedem Materialwarenladen billig erhalten konnte. Endlich darf nicht unerwähnt bleiben, daß es gelungen war, ein
durchaus stabiles Rad herzustellen, das ein Gewicht von nur 0,5 bis 3
Kilogramm hatte, und dessen Schwerpunkt unter der Unterstützungsfläche lag, so daß es sich nach Art der bekannten Stehaufchen von selbst wieder aufrichtete, wenn es umgeworfen wurde. Auf diese Weise war es selbst kleinen Kindern und ganz alten Leuten möglich, sich ohne Gefahr und ohne nennenswerte Anstrengung dem Genuß des Radfahrens hinzugeben. So kann es denn niemand wunder nehmen, daß um das Jahr 1950 das Radeln allgemein eingeführt war, namentlich seitdem die gesamte Produktion auf genossenschaftlichem Wege durch den Staat betrieben und jedem über drei Jahre alten Reichsangehörigen ein seinen vernunftsgemäßen Bedürfnissen entsprechendes Rad gebühren- und taxfrei überwiesen wurde.
Daß unter solchen Umständen das Fußwandern mehr und mehr außer Gebrauch kam, ist natürlich. Alle, die von Berufs wegen kleinere oder größere Strecken zurückzulegen hatten, von den Schulkindern bis zu den Landbriefträgern, Fleischern und Hausierern, bedienten sich des Rades, und endlich benutzten selbst die Botenweiber in Gebirgsgegenden ausschließlich Räder, die zur Überwindung starker Steigungen besonders konstruiert und mit patentierten Gestell für den Tragkorb versehen waren.
Verhältnismäßig lange erhielt sich die Gewohnheit des Fußwanderns bei den Gebirgsreisenden und Alpenfexen, doch verschwand sie auch hier allmählich, nachdem alle irgendwie hervorragenden Berggipfel in Europa und Zentralasien durch elektrische Zahnrad- und Drahtseilbahnen bequem zugänglich gemacht worden waren.
Um diese Zeit erregte ein älterer Mann, der nach seiner Aussage niemals ein Rad benutzt hatte und das Fußwandern gewerbsmäßig betrieb, großes Aufsehen. Er hatte ganz Europa und Asien wiederholt durchwandert und führte auf seinen Reisen ein Tagebuch, worin er sich die durchlaufenen Strecken von den Gemeindebehörden amtlich beglaubigen ließ. Seinen Unterhalt erwarb er sich durch geographische Vorträge, die große Zufahrt fanden; das große Publikum wollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, eine solche Merkwürdigkeit kennen zu lernen, während für die gebildeten Kreise das Pathologische dieses Falles von besonderem Interesse war. Die bedeutendsten Autoritäten auf den Gebieten der Medizin und der Anthropologie unterwarfen ihn eingehenden Untersuchungen. Geh. Rat Professor Parchow demonstrierte ihn der anthropologischen Gesellschaft in Berlin und bemerkte bei dieser Gelegenheit unter anderem folgendes*) „Sie sehen in Herrn Klutenpedder einen kräftig gebauten Mann von 58 Jahren und mittlerer Größe. Knochen und Muskulatur sind gut entwickelt, insbesondere sind diejenigen Muskeln, die beim Radeln vorzugsweise in Aktion treten, keineswegs, wie man erwarten sollte, rudimentär. Die Sinnesorgane sind normal entwickelt, das Sensorium ist durchaus frei, auch
*) Archiv für elektrophysiologische Anthropologie, Jahrgang 1949, S. 117 ff
_die Untersuchung von Gehirn und Rückenmark hat nichts abnormes ergeben, während die Intelligenz sogar zweifellos über dem Durchschnitt steht. Der Schädel ist mesodolichozephal und orthognath, und es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß Herr Klutenpedder dem nordgermanischen Stamm angehört. Um so wunderbarer muß es erscheinen, daß dieses scheinbar völlig normal entwickelte Individuum die Gewohnheit des Fußwanderns erwerben konnte, die einer weit zurückliegenden geologischen Epoche angehört und gegenwärtig nur als spezifisches Merkmal der Degeneration bei einigen durch Inzucht geschwächten kleinen Bergstämme in Neu- Guinea vereinzelt vorkommt. Ich konstatiere hiermit ausdrücklich, daß Herr Klutenpedder noch nie ein Rad bestiegen hat! (Bewegung)
Nach seiner eigenen Aussage ist er schon als Kind zu allerlei Seltsamkeiten geneigt gewesen und hat im reiferen Alter infolge einer unglücklichen Liebe eine Zeit lang Trübsinn gelitten; dies dürfte aber bei dem gänzlichen Mangel an objektiven physikalischen Befunden zur Erklärung des Phänomens schwerlich heranzuziehen sein.“
Nach längeren streng wissenschaftlichen Ausführungen, die für den Laien ohne Interesse sind, kam Professor Parchow zu dem Schluß, daß man einen Fall von atavistischem Rückschlag vor sich habe, wie er zwar bei Pflanzen, ferner bei Regenwürmern und anderen niederen Tieren nicht selten vorkomme, bei Menschen aber bisher noch nicht beobachtet worden sei.
Dieser Ansicht trat Professor von Drehstuhl, der Direktor einer der größten Irrenanstalten des Kontinents, scharf entgegen. Er tadelte die in neuerer Zeit immer mehr hervortretende Neigung, Verbrechen und Geisteskrankheiten vom anatomisch- entwicklungsgeschichtlichen Standpunkte aus zu erklären und auf atavistische Rückschläge zurückzuführen. Nach seiner festen Überzeugung stelle Herr Klutenpedder einen typischen Fall von primärer Verrücktheit dar; die Ursache sei in einer krankhaften Affektion des lokomotorischen Zentrums zu suchen. Der Mangel an objektiven Befunden spreche durchaus nicht dagegen, sei vielmehr gar nicht selten bei solchen Fällen von Paranoia, die mit Blödsinn zu enden pflegten.- Der bei diesem Anlaß zwischen beiden Forschern begonnene Streit läßt sich durch mehrere Jahrgänge des Archivs für elektrophysiologische Anthropologie verfolgen und wurde schließlich zu Ungunsten Parchows entschieden.
Über das Privatleben Klutenpedders finden sich in der Literatur jener Zeit nur dürftige Angaben. Seine Eltern sollen von normaler Beschaffenheit gewesen sein, sein Großvater von mütterlicher Seite soll sogar bei den Nationalfestspielen einmal den zweiten Radlerpreis errungen haben. Verheiratet war er zweimal, wurde aber von beiden Frauen geschieden, wobei als gestzlicher Scheidungsgrund seine unüberwindliche Abneigung gegen das Radfahren geltend gemacht wurde. Einige behaupteten, er sei das letzte Mitglied eines Geheimbundes, der unter dem Namen „Rennsteigverein“ gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts gegründet wurde, anfänglich unbehelligt blieb, dann aber auf Grund des Grobenunfugparagraphen verboten wurde, weil sich die Radlervereine durch ihn beunruhigt fühlten. Dieser Bund verehrte einen Dichter Namens Scheffel als Schutzheiligen und verpflichtete seine Mitglieder, alljährlich einmal unter geheimnisvollen Zeremonien den Rennsteig zu durchwandern, einen einsamen Waldweg, der über den Kamm des Thüringer Waldes in seiner ganzen Ausdehnung hinwegführt; es soll sich dabei um eine Art von abergläubischer Naturverehrung gehandelt haben.
Tatsache ist, daß Klutenpedder eines Tages tot auf dem Rennsteig gefunden wurde, und zwar in der Nähe des Dreiherrensteines am großen Weißenberge. Über sein Leichenbegräbnis bringt der „Universal- Normal- Anzeiger für Hildburghausen“ in der Nummer vom 12. September 1960 einen Bericht, den wir teilweise wiedergeben.
„Der Leichenzug gestaltete sich zu einer großartigen Kundgebung, an der fast die gesamte erwachsene Bevölkerung unserer Stadt teilnahm. War der Verstorbene doch als letzter Vertreter einer schon längst dahingegangenen Menschenklasse in den weitesten Kreisen bekannt und außerdem wegen seines biederen, freundlichen Wesen allgemein beliebt. Den Leichenzug eröffnete die Militärmusik auf sechs achtsitzigen Tandems; sie spielte den Chopinschen Trauermarsch. Es folgte der überreich mit Blumen geschmückte Sarg auf zwei von vier Trauermarschällen gesteuerten Viersitzern und zwei Geistliche auf versilberten Elektrics. Ihnen schloß sich ein unübersehbares Leichengefolge an; darunter bemerkten wir viele Trauerräder mit schwarz lackierter Pneumatik und umflorten Lenkstangen.-
Es waren eigenartige Empfindungen, die der Anblick des endlosen Zuges in uns erweckte; so mag man wohl auch in alter Zeit die letzte Personenpost und die letzte Dampfeisenbahn mit wehmütiger Teilnahme begleitet haben. Und wenn wir als Angehörige eines erleuchteten Jahrhunderts auch mit Stolz zurückschauen auf eine Zeit, wo sich ein großer Teil der Menschheit auf seinen Berufs- und Spazierwegen mit der lächerlich geringen Geschwindigkeit von 1,2 Meter in der Sekunde begnügen mußte, so will es uns in stillen Augenblicken doch zuweilen scheinen, als ob die Menschen damals zufriedener und glücklicher gelebt hätten. Unaufhaltsam rollt das Zweirad der Geschichte durch die Jahrhunderte; schärfer und heißer wird von Jahr zu Jahr der Kampf ums Dasein. Nun ist auch er dahingegangen, der letzte Zeuge eines idyllischen Zeitalters, er, der letzte Fußwanderer! Leicht sei ihm die Erde, die sein Fuß mit solcher Ausdauer betrat.“
Hase und Igel - eine Fabel im modernen Gewand
Ulrich Rüger
Erstmalig veranstalteten die Mannschaften der Tourismusverantwortlichen von Hase und Igel auf der Werra bei Hörschel zum Auftakt der Wandersaison auf dem hier beginnenden Rennsteig ein Wettrudern mit einem Achter.
Da der Rennsteig für die Hasen offenbar seinen Mythos verloren hatte, suchte man nach neuen Horizonten für diesen historischen Weg. Man fand heraus, dass seine Verlegung auf den Flusslauf der Werra ganz neue Perspektiven erschließen würde.
Beide Mannschaften trainierten lange Zeit hart, um ihre höchsten Leistungsstufen zu erreichen. Als der große Tag kam, waren beide Teams topfit, doch die Igel gewannen das Rennen mit einem Kilometer Vorsprung.
Nach der Niederlage waren die Hasen-Touristiker sehr betroffen und die Moral auf einem Tiefpunkt. Das Hasen-Management entschied, dass der Grund für diese vernichtende Niederlage herausgefunden werden solle. Ein Projektteam aus lauter schlauen Füchsen aus den westlichen Teilen des Landes wurde einberufen, um das Problem zu analysieren und geeignete Abhilfemaßnahmen zu empfehlen. Nach langen Untersuchungen und Diskussionen unter Zuhilfenahme weiterer Experten aus dem fernen Bonn wurden Videoaufnahmen in Super Slow-Motion ausgewertet. Man fand heraus, dass bei den Igel-Touristikern sieben Leute ruderten und einer steuerte, während bei den Hasen nur einer ruderte und sieben steuerten, wobei der Ruderer wegen der Ortskenntnis, versteht sich, ein Hiesiger war.
Das Management beauftragte sofort das Projektteam und eine Beraterfirma, eine Studie über die Struktur des Hasen-Achters zu erstellen.
Nach einigen Monaten harter Arbeit kamen die Berater zu dem Ergebnis, dass beim Hasen-Achter zu viele steuerten und nur einer ruderte. Um einer weiteren Niederlage gegen den Igel-Achter vorzubeugen, wurde die Struktur des Hasen-Achters komplett geändert. Es gab jetzt nur noch vier Steuerleute, zwei Obersteuerleute, einen Steuerdirektor und einen Ruderer. Die Funktion des Ruderers wurde aufgrund des erhofften Heimvorteils wieder mit einem Hiesigen, allerdings in Teilzeit, mit befristetem Vertrag, besetzt. Vorausgegangen war eine europaweite Aussschreibung, die bei Posten dieser Bedeutung Voraussetzung ist.
Außerdem wurde für den Ruderer ein Leistungsbewertungssystem eingeführt, um ihm mehr Ansporn zu geben: "Wir müssen seinen Aufgabenbereich erweitern und ihm mehr Verantwortung geben", sagte ein weiser Fuchs mit eigenartigem Akzent aus dem süddeutschen Raum.
Im nächsten Jahr gewann der Igel-Achter mit zwei Kilometer Vorsprung.
Daraufhin entließ das Management der Hasen-Touristiker den Ruderer wegen schlechter Leistung, verkaufte die Ruder und stoppte alle Investitionen für die Anschaffung eines neuen Bootes. Der Beraterfirma aus lauter schlauen Füchsen, wurde ein Lob ausgesprochen, der Personalchef wurde befördert und das eingesparte Geld wurde für eine neue erfolgversprechende Werbekampagne mit dem Titel: "Hoffentlich fällt mir nichts ein!" verwendet.
Bemerkung:
Ähnlichkeiten mit der Realität sind durchaus gewollt und beabsichtigt.
Dazu noch ein geeigneter Spruch von Ludwig Feuerbach:
Ein Mensch ohne eigenen Verstand ist auch ein Mensch ohne eigenen Willen.
Nur wer denkt, ist frei und selbständig.
Die Ernstthäler Mondstürer - Dorfgeschichte
Nacherzählt von Otto Schneider, Neuhaus am Rennweg
Der Fritz und der Karl, zwei Glasmacher in der alten Ernstthäler Glashütte hatten Feierabend. Bevor es heimging, musste aber erst beim „Dores“ eingekehrt werden, denn in der Hütte gab es kein Bier, nur Wasser und Tee und zu Hause gab es auch keins, denn die Frauen hatten nicht genug Geld, um solches zu holen. Aber die zwei hatten heute Geld, denn es war Lohntag gewesen und wenn die Frauen einmal das Geld in der Hand hatten, gab es wieder kein Bier. Nun wurden halt die alten Außenstände bezahlt, der alte Dores schrieb an, aber nicht lange und zwei Halbe konnte man sich schon leisten.
Als sie die hohe Treppe am Wirtshaus hinunter stolperten war es Nacht, aber eine helle Nacht, es war Vollmond.
Ihr Heimweg ging über das „Land“, eine Ebene oberhalb des Ortes, für sie ein Abkürzer. Zum Wasserlassen mussten sie rückwärts gucken, denn gegen den Wind zu pinkeln, waren sie zu nüchtern.
„Karl, guck dan Mond iewern Pappenheimer“. Die rotgoldene Vollmondscheibe stand gerade über den Baumwipfeln des gegenüberliegenden Berges.
„Fritz, dar stätt heit so tief, des mer na ronter kennt gastür, west ich ho beim alten Awer a langa Hippstangel an de Bud gasenne, mir holn sa uns unn stiern dan Mond roo“.
Nun gingen sie wieder retour, am Steinbruchweg stand „Awers Bud“, die „Hipp“ ist ja nur geborgt, so dachten sie und wenn wir fertig sind, stellen wir sie wieder hin.
Auf der Höhe des Weges nach rechts halten, das wussten sie, in der Richtung steht der Mond. Durch eine Lichtung leuchtete er hell und sie begannen zu „stüren“. Nicht lange und der Mond war weg – eine Wolke hatte ihn bedeckt. „Mier hann na runtergehäckelt“, sagte der Fritz, „nu ower häm“.
Die Hipp wieder zurückgelehnt und ganz schnell heim, es wurde Zeit. Auf dem Weg über das „Land“ kamen sie am oberen Teich vorbei, das „Arnstthaler Schwemmbad“, dort lag der Mond im Wasser wie es schien, denn die Wolke war weggezogen.
„Etza kriechen mer ne doch noch“, sagten sie sich, aber er lag ganz in der Mitte des Teiches.
„Mir holn die Kuh“, sagte Karl, „die seift das Wasser aus unn mir komme no“.
Die Kuh vom Fritz wurde in ihrer Ruhe gestört und musste mit zum Teich. Sie hatte noch nicht lange das Maul ins Wasser gehalten, war der Mond wieder weg. Eine andere Wolke hatte ihn verdeckt.
„Nu genn mer häm unn schlachtn die Kuh, die hott dann Mond inn Ranzen“.
Im Haus von Fritz wurde alles rebellisch gemacht, seine Frau sollte das große Messer bringen und die Schüssel für das Blut. Die Kuh sollte sterben.
Aber Fritzens Frau war Kummer gewöhnt, sie hörte sich die Geschichte an und machte die Stalltür auf.
„Do guckt ihr zwee, iwern Barch stätt de Mond inn seiner ganzen Pracht. Lasst die Kuh
in Ruh unn macht des ihr ins Bett kommt, ihr zwee Pappenheimer“.
Die Geschichte wurde durch die Weiber bekannt und die Lauschner Spötter hatten
einen weiteren Namen für ihre Ernstthäler Nachbarn. Erst waren sie die „Queeker“ und
nun auch noch die „Mondstürer“.
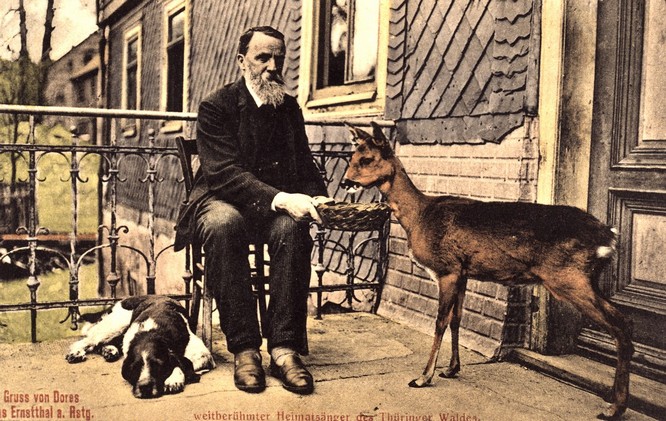
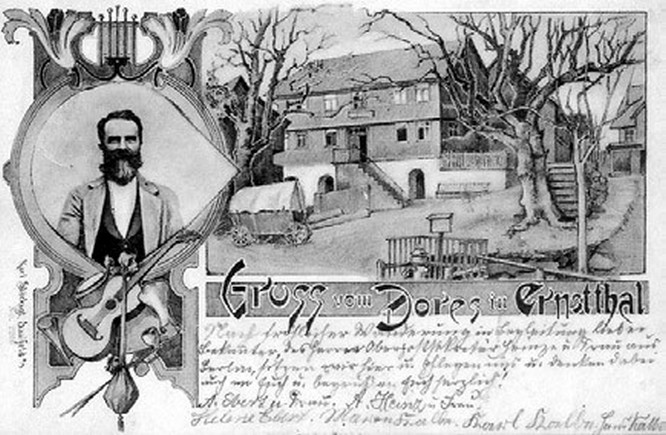
Bemerkung:
Dores: Historischer Gasthof in Ernstthal, Hippstange: Stange mit scharfem Eisenhaken, zum Abschlagen von Ästen an den Fichten
Schaubach, Ernst Adolph (1800 - 1850)
Wanderlust war von Jugend auf meine Freude, doch war das Ziel meiner Wanderungen nicht das Getreibe großer Städte... sondern es war die großartige Einsamkeit hoher Berggipfel, die mich zu ihnen zog.
(Ernst Adolf Schaubach: Die Deutschen Alpen. Jena Verlag Friedrich Frommann. 1847. Aus der Vorrede)
Ernst Adolf Schaubach wurde am 30. Januar 1800 in Meiningen geboren. Sein Vater, Johann Conrad Schaubach war ein bekannter Pädagoge. Seine Mutter, Ernestine Sophie, geb. Roitzsch, war die Tochter eines Pfarrers. 24 Tage vor der Geburt von Ernst Adolf starb dessen Bruder Eduard im Alter von 4 Jahren an den Blattern.
Auch Ernst Adolf hatte gesundheitlich eine schwere Kindheit. So konnte er die Schule nur unregelmäßig besuchen und wurde schließlich von seinem Vater privat unterrichtet. Frühzeitig erkannte Schaubach sein Interesse für Geographie, Naturwissenschaften und Geschichte.
Ab seinem 10. Lebensjahr stabilisierte sich aber seine Gesundheit. Schon während seiner Gymnasialzeit unternahm er ausgedehnte Wanderungen durch den Thüringer Wald, die Rhön, den Harz und durch das Fichtelgebirge. 1819 beendet Schaubach das Meininger Gymnasium als bester Schüler. Er hielt auch anlässlich der Entlassungsfeier am Gymnasium eine Rede in lateinischer Sprache zu Thema Religionsbegriff. So kam es auch, dass er von 1819 bis 1823 in Göttingen und Jena Religion studierte. Ab 1823 war er in Meiningen als Predigtamtscandidat tätig.
Schaubach hatte aber auch starke pädagogische Neigungen. So erteilte er Privatunterricht und ab 1830 unterrichtete er an der Bürgerschule in Meiningen und am Gymnasium. Nach der Trennung von Gymnasium und Bürgerschule im Jahre 1835 unterrichtete Schaubach bis zu seinem Lebensende nur noch an der Bürgerschule. Er lehnte sogar Angebote für eine Professur in Berlin und in München ab. Schaubach unterrichtete Religion, Latein, Mathematik, Geschichte, Geographie und Englisch.
1846 wurde er zum Herzoglichen Professor ernannt, 1850, kurz vor seinem Tode, zum Direktor der Bürgerschule.
Zwischen 1824 und 1847 unternahm er 10 Reisen durch die Tiroler Bergwelt. Diese wurde mit der Zeit seine zweite Heimat.
Seit 1833 war Schaubach mit Therese Friedericke Treiber verheiratet. Der Ehe entstammten ein Sohn und eine Tochter.
Schaubach befasste sich neben seinen ausgedehnten geographischen Studien auch mit Malerei. So entstammen seiner Feder Zeichnungen mit Meininger Ansichten oder Impressionen von seinen Reisen in die Welt der Alpen.
Nach einer Auflistung des Meininger Biografen Ferdinand Ortlepp malte Schaubach in den Alpen alleine 131 Aquarelle und 5 Panoramen.
Um seine Verdienste bei der Erschließung der Alpen zu würdigen, wurde eine Hütte in der Ortler-Gruppe nach ihm benannt.
Als Geograph verfasste Schaubach zahlreiche Schriften. Hie eine kleine Auswahl:
1. Der Dolmar, eine geographische Skizze mit einem Panorama und einer Übersichtskarte. Meiningen 1831. (Überarbeitung und Neuauflage von R.
Koch 1880)
2. Übersicht des Herzogthums Sachsen - Meiningen nach seiner physischen Oberfläche im allgemeinen. (Archiv für die herzoglich Sachsen - Meiningische
Landeskunde. Band 1, 2 Meiningen 1832-1834)
3. Die Nordsee - Mittelmeerbahn und der Main - Elbe-Kanal. Mit einer Eisenbahn- und Kanal - Karte von Deutschland. Hildburghausen 1845.
4. Die Deutschen Alpen. Ein Handbuch für Reisende durch Tirol, Oesterreich, Steiermark, Illyrien, Oberbaiern und die anstossenden Gebiete. 5 Bände. Jena
1845-1847 (1. Auflage).
Am 8. November 1850 starb Ernst Adolf Schaubach in Meiningen. Er hatte noch große Pläne für weitere Projekte, die er leider durch den frühen Tod nicht mehr realisieren konnte. So ist es eifrigen Geschichtsforschern, gerade aus dem Verein für Sachsen - Meiningische Geschichte und Landeskunde und später den Mitarbeitern der Meininger Museen zu verdanken, dass das Werk von Ernst Adolf Schaubach der Öffentlichkeit zugänglich ist und erhalten blieb, nicht zuletzt auch seine Verdienste als Vorreiter zur Errichtung des Dreistromsteines am Rattelsberg bei Siegmundsburg im Jahre 1906.
Man könnte hier ein dreieckiges Haus bauen, von dessen dreiseitigem Dache das
Wasser zum Rhein, zur Weser und zur Elbe hinabliefe. Wäre es nicht der Mühe wert,
auf dem Saar einen massiven Dreistromstein zu errichten, welcher manchen mehr
interessieren würde, als die Dreiherrensteine, denen man auf dem Thüringer Walde
wohl öfters begegnet, als auf einem anderen Gebirge?
Viele Wanderer würden dann an ihm verweilen und bereichert mit manchen
Gedanken die heilige Stätte verlassen, bei der sie sonst gedankenlos vorübereilten.
Dieser Gedanke von Ernst Adolf Schaubach wurde anlässlich der Jahreshauptversammlung des Rennsteigvereins am 01. Juli 1903 auf dem Inselsberg wieder aufgegriffen und beschlossen, am Saarzipfel einen Dreistromstein zu errichten.


Scheffel, Joseph Victor von
Joseph Victor von Scheffel, geadelt 1876 (* 16. Februar 1826 in Karlsruhe; † 9. April 1886 ebenda) war ein im 19. Jahrhundert viel gelesener deutscher Schriftsteller und Dichter, Autor von Erzählungen und Versepen sowie mehrerer bekannter Liedertexte. Er war indirekter Begründer des Begriffes Biedermeier.
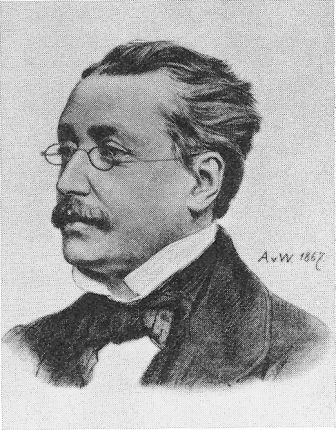
Scheffel, nach A. von Werner, 1867
Leben und Werk
Scheffel wuchs in Karlsruhe auf als Sohn eines Majors und Oberbaurats, auf dessen Wunsch er von 1843 bis 1847 an der Universität Heidelberg die Rechtswissenschaften studierte, später in München und Berlin. Zusätzlich belegte er germanische Philologie und Literatur. In Heidelberg war er zunächst Mitglied der Burschenschaft Allemannia (1844/1845), dann der Burschenschaft Teutonia (1845) und schließlich der Burschenschaft Frankonia II (1846/1847), der er bis zu seinem Tod angehörte. In Berlin war er bei der Alten Berliner Burschenschaft aktiv.[1] Er promovierte zum Doktor der Rechte und begleitete im Sommer 1848 den Reichskommissar Carl Theodor Welcker als Sekretär auf seiner Reise nach Skandinavien.
In der Folge arbeitete er an mehreren großherzoglichen Ämtern, 1850 bis 1851 als Rechtspraktikant in Säckingen, 1852 im Sekretariat des Hofgerichts zu Bruchsal, wurde nach einer Reise durch Italien zwar noch zum Referendar ernannt, gab die juristische Laufbahn dann aber auf, um Dozent an einer Universität zu werden, und ging dafür nach Heidelberg.
Die finanziellen Verhältnisse seiner Familie erlaubten es Scheffel, seinen künstlerischen Neigungen nachzugehen. Um sein Talent als Landschaftsmaler auszuprobieren, reiste er im Mai 1852 nach Rom, wo er aber seine Begabung zum Dichter erkannte. Er trat bald darauf mit seinem Erstlingswerk Der Trompeter von Säckingen, ein Sang vom Oberrhein (Stuttg. 1854) hervor, welchem schon kurze Zeit später der historische Roman Ekkehard (Frankfurt 1857) folgte, der auf der Lebensgeschichte des St. Gallener Mönchs Ekkehard II beruht.
Sowohl die kleine epische Dichtung als der Roman, eine Geschichte aus dem 10. Jahrhundert, zeigen Scheffel als frischen und humorvollen Dichter, der aufgrund seiner inneren Anschauung und genauer historischer Studien verschiedene Zeiten und Zustände lebendig schildern kann.
Nachdem der Dichter eine Zeit lang in München, dann 1858 bis 1859 als Hofbibliothekar des Fürsten Egon von Fürstenberg in Donaueschingen gelebt hatte, ließ er sich dauernd in seiner Vaterstadt Karlsruhe nieder. Dort wurde Scheffel mit Verleihung des Ordens der Württembergischen Krone am 3. Februar 1876 mit Diplom vom 16. Februar 1876 aus Anlass seines 50. Geburtstages durch den Großherzog von Baden in den badischen persönlichen Adelstand erhoben. Zu diesem Zeitpunkt war Scheffel bereits großherzoglich sächsischer Hofrat und Gutsbesitzer auf Seehalde und Mettnau bei Radolfzell.
Unter den späteren Produktionen Scheffels fanden die humoristischen Lieder und Balladen, die in Gaudeamus (Stuttgart 1867) gesammelt erschienen, wegen ihrer geistreichen Frische, ihres kecken studentischen Tons willen außerordentlichen Beifall. In Frau Aventiure. Lieder aus Heinrich von Ofterdingens Zeit (Stuttgart 1863) sowie der Erzählung Juniperus. Geschichte eines Kreuzfahrers (Stuttgart 1868) zeigen sich zu sehr Spuren von Scheffels Gelehrsamkeit, was ihnen die Lebendigkeit nimmt. Die Novelle Juniperus. Geschichte eines Kreuzfahrers entstand in seiner Donaueschinger Zeit und die nach ihr benannte Juniperus-Quelle in Allmendshofen, einem Ortsteil von Donaueschingen, erinnert daran.
Beide Dichtungen waren gleichsam Splitter eines geplanten großen historischen Romans, der die Entstehung des Nibelungenlieds und den Sängerkrieg auf der Wartburg schildern sollte, aber unausgeführt blieb. Scheffels letzte Produktionen sind die Bergpsalmen (Stuttgart 1870), das lyrische Festspiel Der Brautwillkomm auf Wartburg (Weimar 1873), Waldeinsamkeit, Dichtung zu zwölf landschaftlichen Stimmungsbildern von Julius Marak (Stuttgart 1880), Der Heini von Steier, Dichtung (München 1883), und Hugideo. Eine alte Geschichte (Stuttgart 1884).
Nachdem Scheffel die letzten Jahre seines Lebens zurückgezogen und durch eine fortschreitende Gehirnerkrankung behindert in seiner Villa bei Radolfzell am unteren Bodensee zugebracht hatte, starb er am 9. April 1886 in Karlsruhe. Nach seinem Tod erschienen noch: Fünf Dichtungen (Stuttgart 1887), Reisebilder (herausgegeben von Johannes Proelß, (Stuttgart 1887) und Gedichte (Stuttgart 1888).

Scheffeldenkmal in Heidelberg, 1898

Scheffeldenkmal in Karlsruhe um 1900

links das Scheffeldenkmal am Großen Weißenberg , vorne der Dreiherrenstein (hist. 1936)

2003, aufgenommen während der Rennsteigneuvermessung


Werke
- Der Trompeter von Säckingen (1853)
- Ekkehard (1855)
- Frankenlied (1859)
- Hugideo. Eine alte Geschichte.
- Juniperus. Geschichte eines Kreuzfahrers.
- Am Anfang (oder: Der Rennstieg) (1863)
- Reisebilder, postum herausgegeben von Johannes Proelß
- Episteln
- Der Heini von Steier (1883).
- Waldeinsamkeit
- Bergpsalmen
- Frau Aventiure. Lieder aus Heinrich von Ofterdingens Zeit.
- Gaudeamus. Lieder aus dem Engeren und Weiteren. Beispiel: Der Aggstein
- Das Lied „Altheidelberg, Du feine“ s.o..
- Werke 4 Bände, Nachdruck der Ausgabe von 1919 (Herausgeber Friedrich Panzer), Hildesheim, Olms 2004 ISBN 3-487-12067-4
Quelle: Wikipedia, Bilder: archiv-rueger
Im Jahre 1863 erschien "Der Rennstieg". Die nachfolgend abgebildete Version entstammt der Erstauflage "Frau Aventiure"
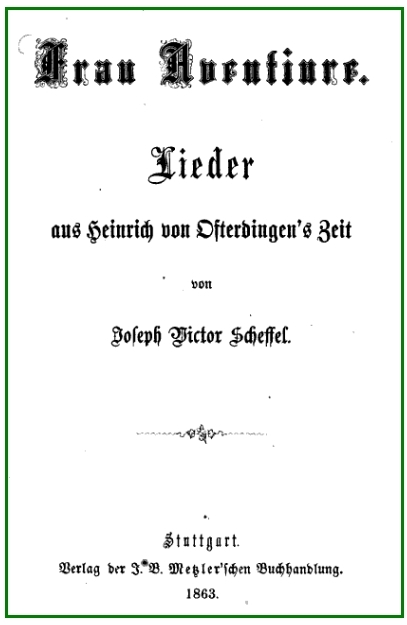
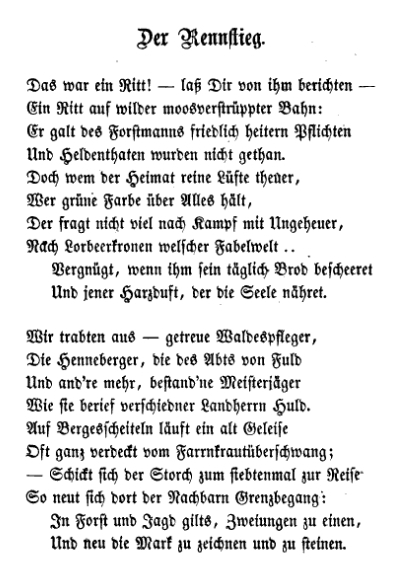
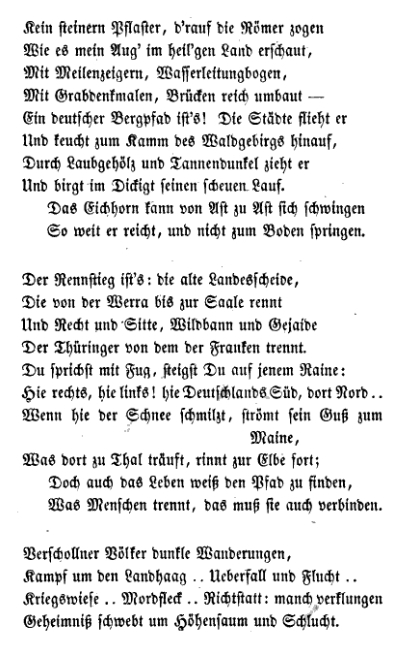
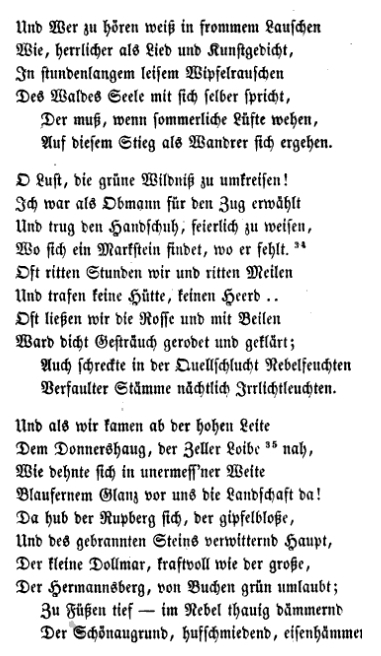
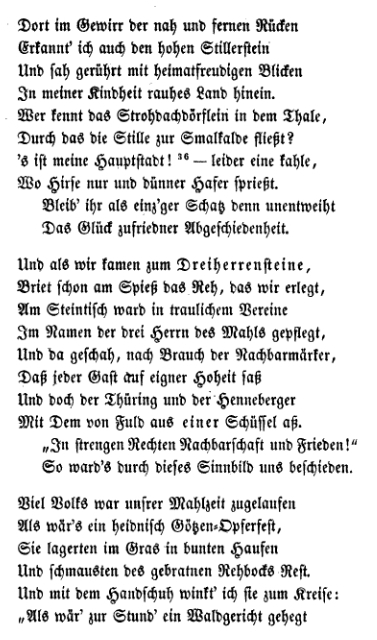
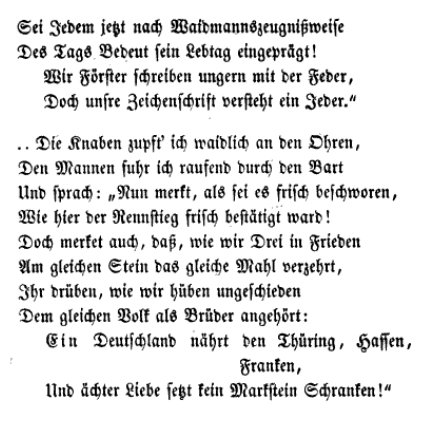
Die Schwarzburger Gabel- Herkunft und Geschichte


Übersichtskarte der beiden Fürstentümer vor ihrer Auflösung nach dem 1. Weltkrieg (hist. Quelle, im Besitz des Autors)

(Als Wappensymbol auf den Grenzsteinen am Rennsteig im
Bereich der ehemaligen Herrschaftsgrenzen von
Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen)
Bei meinen Vorortuntersuchungen am Rennsteig werde ich von interessierten Wanderern immer wieder nach der Bedeutung der Gabeln auf den Grenzsteinen am Rennsteig zwischen dem Dreiherrenstein Hoher Lach und dem Großen Dreiherrenstein gefragt.
Das war auch der Auslöser, dieses Thema im Speziellen aufzugreifen und aus meiner Sicht darzulegen.

Großes Schwarzburger Wappen (Bild: archiv-rüger. Repro)
Zunächst etwas Statistik:
Die Gabeln, in ihrer großen Vielfalt, schmücken die Grenzsteine in dem Bereich des Plänckner`schen Rennsteiges, wo dieser die Landesgrenze zu den ehemaligen Herrscherhäusern Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen bildete.
Die Grenze erstreckte sich vom Dreiherrenstein Hoher Lach bei Igelshieb bis zum Großen Dreiherrenstein zwischen Neustadt am Rennsteig und Allzunah auf einer Länge von 36 Kilometer, 476 Meter und 88 Zentimeter.
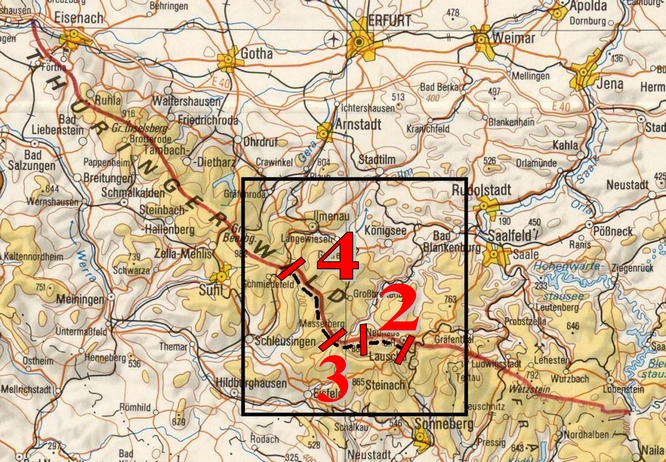
Repro, archiv-rüger
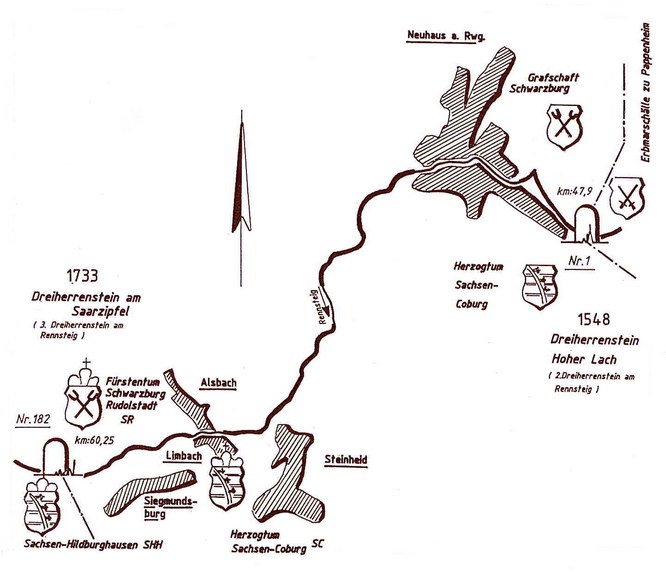

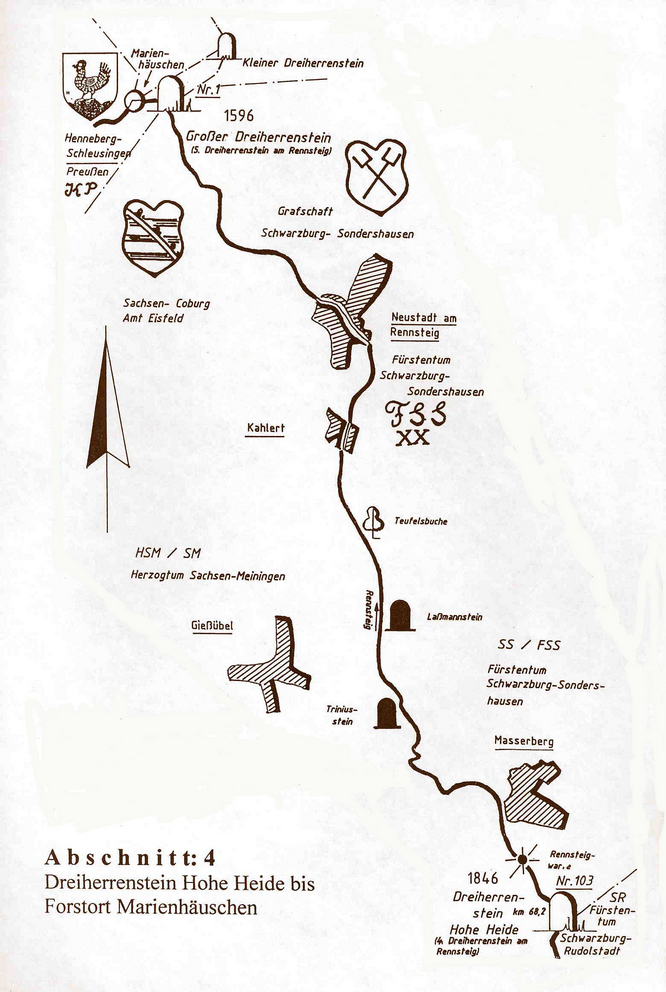
Übersichtskarten der Grenzabschnitte 2 bis 4
Die Weiterführung zum Kleinen Dreiherrenstein lassen wir außer Acht, da nach meiner Auffassung dieser Dreiherrenstein den Rennsteig nicht tangiert.
Insgesamt wurden vermutlich bis 1906 an diesem Grenzabschnitt 518 Grenzsteine gesetzt, von welchen nach meinen Untersuchungen zur Zeit noch 408 vorhanden sind. Das entspricht ca. 79 % des einstigen Sollbestandes.
Nachweisen konnte ich, dass an 312 Grenzsteinen Gabeldarstellungen in unterschiedlicher Form vorhanden sind oder vorhanden waren. Ein tabellarische Übersicht folgt im Anhang.
Alle 312 Grenzsteine sind aber längst nicht mehr örtlich vorhanden. Durch gezielte Auswertung der mir zugänglichen Fachliteratur, mit Hilfe von Archivunterlagen, speziell aus dem Thüringischen Staatsarchiv Rudolstadt und durch eigene Vorortuntersuchungen, konnte die Zahl untersetzt werden.
Der älteste Grenzstein, auf dem die Gabeln heute noch sichtbar dargestellt sind, befindet sich auf der Pechleite zwischen Friedrichshöhe und der Eisfelder Ausspanne. Offenbar stammt der Grenzstein (Nr. 52) aus einer Zeit vor 1572, wahrscheinlich von 1548, wie die unten benannte Urkunde belegt.[1]
Auf Blatt 9 und 10 der Urkunde finden wir einen Hinweis auf den besagten Grenzstein:
Auf Blatt 10 ist von einem neuen, sächsischen Stein am Eisfelder Weg von 1595 die Rede. Der Grenzstein konnte eindeutig als Nr. 51 identifiziert werden, der von Friedrichshöhe kommend, linksseitig am Abzweig des Rennsteiges zur Pechleite steht.
Auf Blatt 9 der Urkunde werden 2 Schwarzburgische Steine aus dem Jahre 1572 beschrieben, offenbar die Grenzsteine Nr. 54 und 56. Nr. 53 aus dem Jahre 1616 und Nr. 55 aus dem Jahre 1598 waren bis dato noch nicht gesetzt.
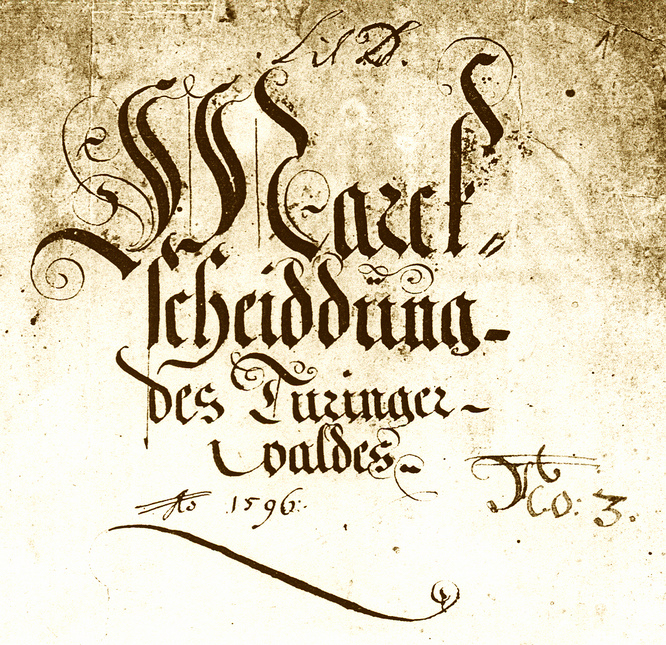
Deckblatt der Urkunde von 1596 (Bild: archiv-rüger. Repro. 2005)
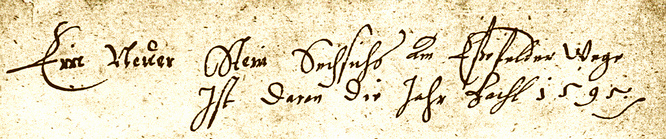
Beschreibung des Grenzsteines Nr. 51 in der Urkunde von 1596 (Bild: archiv-rüger. Repro. 2005)
Die Topographie, oberer Langenbach oder oberhalb Langenbach, stimmt ebenfalls, so dass es sich zweifellos um den Grenzstein Nr. 52 handelt. Die Schriftzüge am Grenzstein lassen darauf schließen, dass der Grenzstein vor 1572 gesetzt wurde.[2]
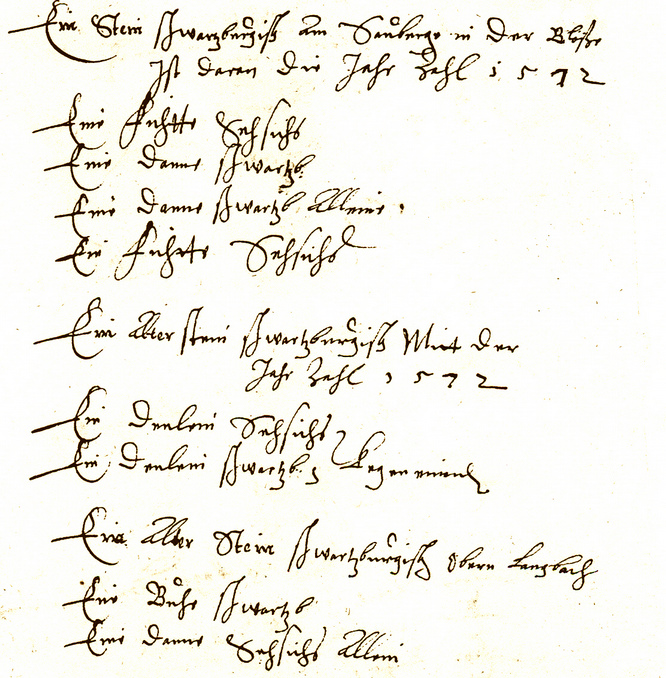
Die Grenzsteine 54 und 56 von 1572 und der alte Grenzstein Nr. 52 werden beschrieben (Bild: archiv-rüger. Repro. 2005)
In unserem ausgewiesenen Gebiet stehen 4 Dreiherrensteine, die alle noch vorhanden sind und eine sehr wechselvolle Geschichte repräsentieren.
Ohne Übertreibung kann behauptet werden, dass sich hier die noch am besten erhaltenen und im Zusammenhang vorhandenen Wappengrenzsteine des gesamten Rennsteiges befinden.
Gerade auf der Schwarzburger Seite gibt es einige Details bei der Wappengestaltung, die ihre Entstehungsursache in wichtigen politischen Ereignissen der Vergangenheit hatten.
Stellvertretend soll hier die Darstellung der Fürstenkrone auf dem Schwarzburger Wappen genannt werden.
Die Krone wurde auf einigen Grenzsteinen der barocken Zeit erst mit Beginn des 18. Jahrhunderts dargestellt. Vorher fehlt die Krone dem Schwarzburger Wappen gänzlich. Dieser Umstand hängt mit der Verleihung der Fürstenwürde an die Schwarzburger zusammen, die zwischen 1697 und 1711 erfolgte.
Nach dem endgültigen Vollzug waren die Schwarzburger berechtigt, die Krone in ihrem Wappen zu tragen, was auch bei der Wappendarstellung an den Grenzsteinen zum Ausdruck kam.
Ein Irrtum unterlief in diesem Zusammenhang auch so großartigen Rennsteigforschern wie Prof. Dr. Johannes Bühring und Prof. Dr. Ludwig Hertel bei der Gestaltung des Wappenschildes für den Rennsteigverein. Das dort abgebildete Wappen (s. Abbildung unten) zeigt symbolisch den Großen Dreiherrenstein mit der Jahreszahl 1596, dem eine Fürstenkrone aufgesetzt wurde. Historisch gesehen ist diese Darstellung in zweierlei Hinsicht nicht korrekt.
Einmal trägt der Große Dreiherrenstein keinerlei Darstellungen mit Fürstenkronen, zum anderen war die damalige Grafschaft Schwarzburg noch gar nicht berechtigt, die Fürstenkrone in irgend einer Wappendarstellung zu führen, da die Fürstenwürde erst zwischen 1697 und 1711 verliehen wurde.

Logo der Vereinszeitschrift des Rennsteigvereins 1896 e.V. (Bild: archiv-rüger. Repro 2005)
Kommen wir nun zur Bedeutung der Gabeldarstellung auf den Wappen der Grenzsteine.
Über den Ursprung gibt es verschiedene Theorien. Im großen Schwarzburger Gesamt- oder Vollwappen befindet sich die rote Gabel quer liegend im Schildfuß. Zusammen mit dem darunter liegenden Kamm, ranken sich um die beiden Zeichen viele Rätsel.
Auf Schwarzburger Münzen wird die Gabel erstmals um 1500 als Abzeichen benutzt.
Die älteste, in einer Urkunde im Zusammenhang mit einer Grenzirrung im Bereich um Steinheid, erwähnte Gabeldarstellung, konnte ich im Staatsarchiv Coburg finden. Sie stammt aus dem Jahre 1534. Ein nachfolgender Auszug aus der Urkunde zeigt unmissverständlich eine Gabel.[3]
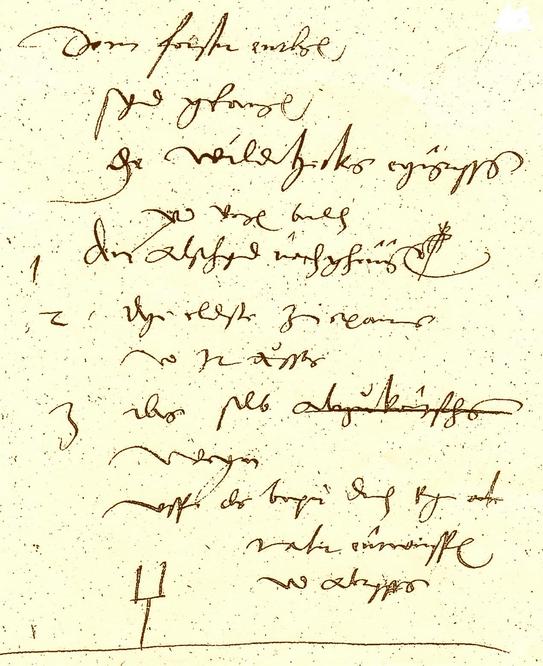
Urkundenausschnitt. Staatsarchiv Coburg. 1534 (Bild: archiv-rüger. Repro 2005)
Im Laufe der Forschungen zum Ursprung kristallisierten sich 2 Haupttheorien heraus:
- Die Streugabel in Verbindung mit Leutenberg oder die Stallmeistergabeltheorie.
- Die Verbindung der Gabel zur Montan- oder Hüttenindustrie
Eine weitere Theorie, die Gabel als Abwandlung einer Schafschere zu interpretieren soll hier zwar erwähnt, aber nicht weiter kommentiert werden, da es hierzu nur Vermutungen gibt.[4]
Zuerst möchte ich mich der sogenannten Stallmeistergabeltheorie zuwenden:
Nach Angaben des Lexikons der Heraldik[5] wird die Gabel als Streugabel in Verbindung mit der Herrschaft von Leutenberg gebracht., wo die Gabel im Wappenschild des Wappens der ehemaligen Grafen der Käfernburg dargestellt war. Bereits im 18. Jahrhundert jedoch kamen Zweifel auf, dass diese Darstellung in Verbindung mit der Übertragung der Reichsstallmeisterwürde an die Grafen von Leuchtenburg steht, nachdem in einem Wappenkalender diese Theorie aufgestellt wurde.[6]
Im Jahre 1882 erscheint die 2. Auflage des Heftchens: Heimatskunde der Fürstentümer Schwarzburg von G. Wallenhauer. Er vermutet ebenfalls eine Verbindung mit der Herrschaft Leutenberg, bemerkt aber in einer Fußnote, dass diese Herkunft historisch nicht nachgewiesen ist.[7]
Elisabeth Streller, die bekannte Grenzsteinforscherin der 20 er und 30 er Jahre des 20. Jahrhunderts, weist in einem Artikel über das Fürstlich Schwarzburgische Wappen auf historische Quellen hin, die die Gabel als Streugabel definieren, bittet jedoch die Leser um Mithilfe bei der Erforschung der Herkunft[8].
Moderne Zeitgenossen, die sich mit der Geschichte Thüringens befassen, kommen übrigens zum gleichen Schluss. So finden wir in der Erläuterung zum Wappenposter, welches vom Staatsarchiv Rudolstadt im Jahre 1990 ver-öffentlicht wurde, eine ähnliche Erklärung durch den Verfasser Dr. P. Langhof.[9]
Da das Staatsarchiv als Herausgeber dieses Posters zeichnete, ist anzunehmen, dass es sich bei dieser Erklärung um die offizielle Version der Gabelabstammung handeln dürfte[10].
Erwähnen möchte ich noch Peter Mast. Auch er bringt die Gabel in Verbindung mit den Leutenbergern und dem Reichsstallmeisteramt[11].
Kommen wir zur zweiten Theorie:
Diese sieht die Herkunft der Gabel in Verbindung mit der Montanindustrie und dem Hüttenwesen.
In der damaligen Zeit war das Hüttenwesen und der Bergbau in den Gebirgs-regionen der Schwarzburger Herrschaft stark verbreitet. Das alte Bergwerksregal, das Recht zur Betreibung von Bergwerken und Schmelzhütten, war ein Standbein der voranschreitenden industriellen Entwicklung. Gabeln wurden in Schmelzhütten als sogenannte Forken genutzt. Eine andere Version der Gabel wird mit der Goldwäscherei im Oberen Schwarzatal in Verbindung gebracht. Verschiedene Seitentäler bei Goldisthal tragen beispielsweise noch heute die Bezeichnung Seifen in ihrem Namen. Man sonderte in den oberen Bachläufen die Grobteile aus dem gewonnenen Rohmaterial und karrte den verbleibenden Rest ins Tal, wo das Gold ausgewaschen wurde. Für diese Arbeiten benutzte man sogenannte Seifengabeln, in der Form der Gabeln auf unseren Grenzsteinen.
Diese Aktivitäten fallen etwa in den Zeitraum, als erstmals die Gabeln auf den Grenzsteinen zur Kennzeichnung der Landeshoheit benutzt wurden, also nach 1500. Auch auf Schwarzburger Münzen, die um 1500 geprägt wurden, finden wir die Gabel. Eine Verbindung zum vorher erwähnten Goldbergbau wäre somit wieder gegeben.
Belege der Theorie gibt es in zahlreichen Veröffentlichungen der Heimatliteratur. So werden in einzelnen Ausgaben des Schwarzburgboten der Jahre 1932 und 1933 Abhandlungen zu den Gabeln veröffentlicht. 1932 berichtet beispielsweise Dr. Berthold Rein über die Hauszeichen der Schwarzburger Grafen. Dort werden die Schlackengabeln der Bergleute beschrieben.[12] Ein anderer Artikel, der über alte Goldfundstätten berichtet, zeigt die Seifengabel.[13]
Auch in jüngster Vergangenheit kommen wieder Zweifel an der Stall-meistertheorie auf. Ein namhafter Verfechter der Verbindung der Gabeln zur Montan- und Hüttenindustrie ist Heinz Deubler[14]. Auch sein Sohn Volker erläutert anhand von Beispielen den Bezug zu Bergregal und Münzrecht[15].
Nach anfänglichen Zweifeln scheint mir diese zuletzt genannte Theorie, diejenige zu sein, welche eindeutig vorzuziehen ist. Begründen möchte ich meine Behauptung mit der Tatsache, dass bei der Erforschung einer plausiblen Begründung für die Richtigkeit einer der beiden Theorien, bei dieser die einzigen gegenständlichen Zeugen gefunden wurden.
Zwei interessante Funde möchte ich hier vorstellen:
Bei Sanierungsarbeiten am Grenzstein 139 aus dem Jahre 1617, oberhalb von Limbach, fand ich als Steinunterlage (Zeuge) eine Porzellanmarke mit der Aufschrift: KAMERGUTSGRENZE, darunter befand sich ein Kamm und eine Gabel.[16]

Zeuge unter dem Grenzstein 139 bei Limbach (Bild: archiv-rüger. 1999)
Die Kammer überwachte den fürstlichen Haushalt und verwaltete den Grundbesitz. Also auch hier wieder die Verbindung Finanzen- Münzen- Goldbergbau (s. dazu auch Abbildung des Zeugen).
Der zweite Fund stammt aus dem Geißlermuseum in Neuhaus am Rennweg. Dort ist es dem unermüdlichen Sammeleifer von Siegfried Schönburg zu verdanken, dass er eine Originalschlackegabel vor einer Sperrmüllaktion in Sicherheit bringen konnte und sie dem Fundus des Museums übergab.
Diese Gabel fotografierte ich und stellte sie anlässlich eines Lichtbildervortrages im Neuhäuser Raum vor. Beim Einblenden des besagten Dias, rief ein Lau-schaer in seinem unverkennbaren Dialekt:
Dees is hinsä dooch ä Gobl van de ooltn Hütt!
(Übersetzt: Das ist doch eine Gabel aus der alten Hütte!)
Also wieder eine Verbindung zur Hüttenindustrie.
Zwischenzeitlich kann ich diese Theorie auch noch mit einem historischen Foto belegen, das Hüttenarbeiter von Lauscha mit diesen typischen Gabeln zeigt.
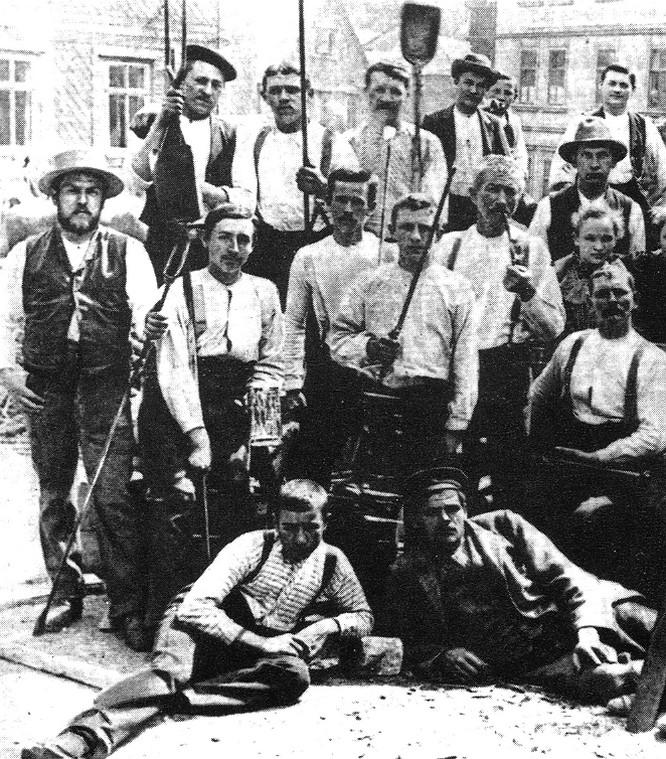
Glashüttenarbeiter aus Lauscha im 19. Jahrhundert mit ihren Schlackegabeln (Bild: archiv-rüger. Repro)

Gabel aus dem Geißlermuseum Neuhaus am Rennweg (Bild: archiv-rüger)
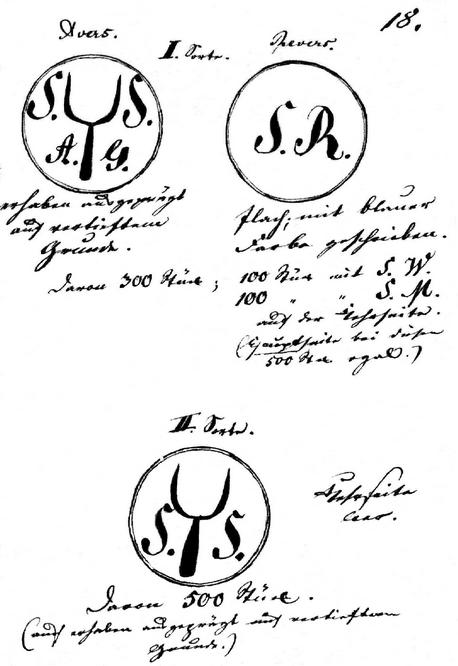
Aus: Thüringisches Staatsarchiv Rudolstadt. Amt Gehren. Nr. 286. Beschaffung von Porzellanmarken als Unterlage für die Landesgrenzsteine (Lieferant: Gotthelf Greiner, Breitenbach). 1845. (Bild: archiv-rüger. Repro. 2005)
Fassen wir zusammen:
|
Die Theorie der Stallmeistergabeln wurde bereits in vergangenen Jahrhunderten angezweifelt und nie bewiesen. Für die Theorie der Verbindung zum Bergregal und zur Hüttenindustrie wurden Zeugen gefunden, die diese Theorie eindeutig favorisieren und belegen. Wir müssen also davon ausgehen, dass die Schwarzburger Gabeln ihren Ursprung im Bergregal und der Hüttenindustrie des ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts haben. |
Gabelformen
Die Vielfalt der Gabeldarstellungen auf den Grenzsteinen resultiert aus dem Zeitraum von 321 Jahren, in welchem Gabeln auf Grenzsteinen verwendet wurden.
Innerhalb einer Epoche wurden teilweise sehr unterschiedliche Formen vorgefunden, was darauf schließen lässt, dass die jeweilig in Stein gehauene Gabelform mehr oder weniger der Phantasie des beauftragten Steinmetzes ent-sprang.
Auffällig im Vergleich zu der Darstellung auf der ernestinischen Seite der Grenzsteine ist, dass sich die Gabeldarstellungen durch sämtliche Epochen des Steinsatzes ziehen, während auf der ernestinischen Seite Symboldarstellungen zumindest in der 3. Epoche (ausgehendes 18. Jahrhundert) und 4. Epoche (ab 19. Jahrhundert) als Wappenelemente fehlen.
Es könnte sich hierbei um einen Ausdruck der wachsenden Macht der bürgerlichen Gesellschaftsform handeln, welche sicherlich durch die Ereignisse der Revolution in Frankreich 1789 und der Bürgerlichen Revolution 1847/48 in Deutschland beeinflusst wurde. Eindeutig scheint auch zu sein, dass die bürgerlichen Einflüsse in den ernestinischen Landesteilen deutlicher an Gewicht gewinnen, als in den Schwarzburger Fürstentümern, was wiederum seine Ursache in der relativen Homogenität des Schwarzburger Herrschaftsbereiches hat. Der 1713 von beiden Herrscherhäusern geschlossene Haus- und Suc-cessionsvertrag trug wesentlich zu dieser Homogenität bei.
Wappendarstellungen im Schild finden wir ab der 3. Epoche auf keiner der beiden Hoheitsseiten mehr. Offenbar wird auch hier der gestärkte bürgerliche Einfluss genutzt, um adlig- feudale Darstellungsformen zurück zu drängen, ohne dass seitens der immer noch herrschenden Regionalfürsten Widerstand aufkommt.
Sicherlich ist bei der Vereinfachung der Wappendarstellung ein ökonomischer Aspekt nicht von der Hand zu weisen. Aber dieser liegt im Rückgang der feudal-adligen Herrschaftsform. Den Regionalfürsten wurden durch eine entsprechende bürgerliche Gesetzgebung gewisse finanzielle Zwänge auferlegt, die zur Sparsamkeit, gerade in solchen Bereichen, drängten. Ein Erbe im Übrigen, dass auch in der Gegenwart wieder sehr aktuell ist, wenn auch unter dem Deckmantel einer vermeintlich anderen Gesellschaftsform, der Demokratie.
Aus Gründen der Sparsamkeit wurde beispielsweise im Jahre 1843 im Herzogtum Sachsen- Meiningen per Instruktion festgelegt, wie Grenzsteine bemessen sein mussten und welche Hoheitsbezeichnung sie haben sollten, eine Instruktion die somit unmittelbar auch die direkten nördlichen Nachbarn Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen betraf, da eine Seite des nunmehr normierten Grenzsteines ja auch diese Herrschaftsgebiet einschloss.[17]
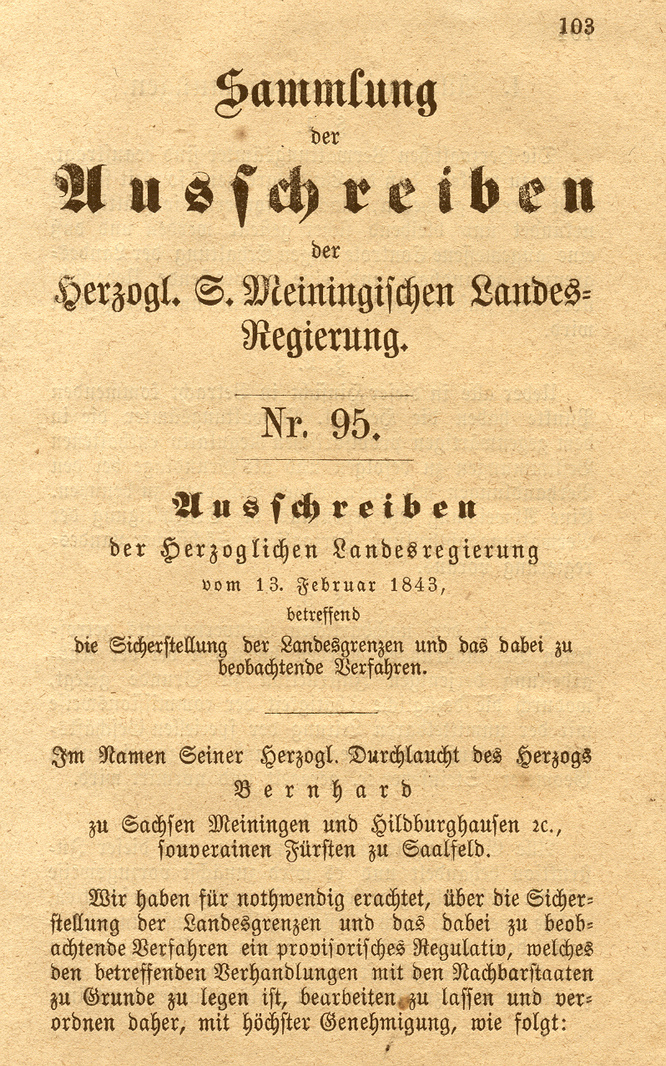
Ausschreiben von 1843, Deckblatt (Bild: archiv-rüger. Repro)
In Verbindung mit den Gabeldarstellungen auf den Grenzsteinen gibt es einige interessante Einmaligkeiten, die hier näher erläutert werden sollen :
- Grenzstein Nr. 15, 3. Abschnitt: Auf der Schwarzburger Seite befindet sich, einmalig im Untersuchungsgebiet, die quer liegende Gabel und ein Kamm, also das komplette Wappensymbol aus dem Schildfuß des Schwarzburger Wappens.

Grenzstein Nr. 15, 3. Abschnitt (Bild: archiv-rüger. 30. 05.2005)
- Grenzstein Nr. 52, 3. Abschnitt: Er weist als einziger Grenzstein diagonal gekreuzte Gabeln auf, deren Zinken nach unten zeigen. Es wird vermutet, dass es sich bei diesem Grenzstein um den wohl ältesten Grenzstein mit heute noch sichtbaren Gabeldarstellungen handelt. Er dürfte aus der Zeit um 1548 stammen, als die erste groß angelegte Steinsetzung zwischen dem Großen Dreiherrenstein und dem Dreiherrenstein Hoher Lach stattfand. Zahlreiche Lachbäume mit eingehauenen Herrschaftzeichen waren aufgrund ihres desolaten Zustandes nicht mehr für Grenzmarkierungen nutzbar. Man entschloss sich, an deren Stelle Grenzsteine aus Sandstein zu setzen.
 Grenzstein Nr. 52 im 3. Abschnitt am Anstieg zur Pechleite (Bild: archiv-rüger. 31.08.2004)
Grenzstein Nr. 52 im 3. Abschnitt am Anstieg zur Pechleite (Bild: archiv-rüger. 31.08.2004)
- Grenzstein Nr. 16, 4. Abschnitt: Dieser Grenzstein ist sehr gut erhalten und relativ wuchtig. Als einziger Grenzstein hat er 2 gegeneinander liegende Gabeln in Querlage im Feld. Offenbar wurde dieser Grenzstein aber beim Bau der Ferngasleitung in den 60 er Jahren des 20. Jahrhunderts von seinem Originalstandort an einen Ersatzstandort gesetzt.

Grenzstein Nr.16, 4. Abschnitt (Bild: archiv-rüger. 31.08.2004)
- Grenzstein Nr. 100, 3. Abschnitt: Ein Grenzstein mit einer Dreifachgabel, wie lange vermutet wurde. Ursprünglich befand sich am Grenzstein eine aufrecht gekreuzte Doppelgabel aus dem Jahr des Steinsatzes 1598. Nach 1843 wurden alle Grenzsteine der Abschnitte, die eine gemeinsame Landesgrenze mit Sachsen-Meiningen hatten, kontrolliert und neu nummeriert. In diesem Zuge wurde über die Doppelgabel eine für diese Zeit typische, quer liegende Gabel graviert, so dass zwangsläufig der Eindruck einer Dreifachgabel entstand.

Schwarzburger Seite des Grenzsteines 100 auf der Pechleite
- Der Germarstein, 3. Abschnitt: Der Kieselstein steht zwischen dem Grenzstein Nr. 57 und dem Grenzstein Nr. 58a. In meiner Übersicht der historischen Grenzsteine des gesamten Rennsteiges wird er als Grenzstein Nr. 58 geführt. Bereits im Vertrag zwischen Sachsen und Schwarzburg wegen der Grenze und Markung auf dem Thüringer Wald vom 10. Oktober 1548 wird der Kieselstein beschrieben. Der Kieselstein ist wahrscheinlich der älteste noch vorhandene Grenzstein am Rennsteig. Er ist wahrscheinlich noch älter, als der Kurfürstenstein am Schönwappenweg aus dem Jahre 1513. Nach Bruno von Germar soll unter der am 06. Juni 1925 angebrachten Gedenktafel zu Ehren des Rennsteigforschers Bruno von Germar ein Gabelsymbol versteckt sein, dass aber mit großer Sicherheit durch das Anbringen der Tafel zerstört wurde.[18]
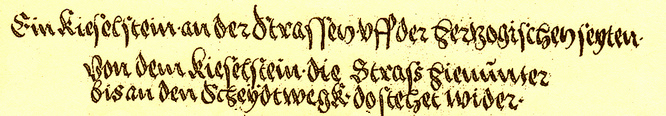
Beschreibung des heutigen Germarsteines, 1548 (Bild: archiv-rüger, Repro)[19]

Germarstein, 3. Abschnitt, aktuelle Ansicht (Bild: archiv-rüger. 31.08.2004).
Durch das Anbringen der Tafel, wurde wenn überhaupt vorhanden, die Gabeldarstellung zerstört, ein Umstand, den der Rennsteigforscher Bruno von Germar sicherlich nicht gewollt hätte.

Germarstein bevor die Tafel zu Ehren von Bruno von Germar an den Stein angebracht wurde
(Bild: archiv-rüger. Repro 2005)
Aufgrund der Größe der Gabel, auch im Vergleich zu Germars "fotografischer" Darstellung im Mareile, dem Boten des Rennsteigvereins, zweifle ich an, ob jemals eine Gabel auf dem Kieselstein vorhanden war, da man sie ansatzweise noch hätte erkennen müssen.
Bildbeispiele

(1) Grenzstein Nr. 93 im 3. Abschnitt am Anstieg zur Hohen Heide ist ein typischer Vertreter der barocken Wappenkunst. Im Jahre 1756 war bei den Schwarzburgern die Erhebung in den Reichsfürstenstand schon vollzogen und somit durfte man auch die Fürstenkrone im Wappen führen.

(2) Im Gegensatz zu Stein 93 aus dem dritten Abschnitt fehlt dem Grenz-stein Nr. 167 aus dem 2. Abschnitt, der nördlich von Siegmundsburg steht, die Fürstenkrone. Hier lag es offenbar im Ermessen des Steinmetzes, eine schlichtere Form zu wählen.

(3) Grenzstein 100 auf der Hohen Heide ist ein typischer Vertreter aus dem Jahre 1598 mit den gekreuzten Gabeln. Später, offenbar aus Anlass der letzten großen Grenzrevision im 19. Jahrhundert, wurde noch eine weitere quer liegende Gabel eingraviert.

(4) Grenzstein Nr. 85 aus dem 2. Abschnitt steht am Abstieg vom Rollkopf zum Sandwieschen. Er ist ein typischer Vertreter aus dem Jahre 1847, in welchem in diesem Grenzsteinabschnitt die letzte große Grenzrevision stattfand. Leider wurde der Grenzstein zu Beginn des 21. Jahrhunderts durch Grenzsteinvandalen stark beschädigt, so dass er sich in der hier dargestellten Form in der Örtlichkeit nicht mehr präsentieren kann.
Archivnachweise
Im Einzugsbereich der Grenzsteinabschnitte 2 bis 4, nämlich vom Dreiherren-stein Hoher Lach bei Igelshieb bis zum Großen Dreiherrenstein finden wir Archivunterlagen vor allem in folgenden Staatsarchiven:
- Thüringisches Staatsarchiv Rudolstadt
- Thüringisches Staatsarchiv Meiningen
- Staatsarchiv Coburg
Andere Archive, wie das Thüringische Hauptstaatsarchiv Weimar, das Stadtarchiv Sonneberg und das Stadtarchiv Schalkau sollen ohne die Auflistung historischer Quellen hier nur genannt werden.
Bei der Auswahl der historischen Quellen aus dem Thüringischen Staatsarchiv Rudolstadt wurde intensiver recherchiert als beispielsweise bei Meiningen und Coburg.
Deshalb wurden auch bei Meiningen und Coburg nur die aus der Sicht des Verfassers wichtigen Dokumente im Zusammenhang mit den historischen Grenzsteinen der Grenzsteinabschnitte 2 bis 4 erwähnt.
Mit der Bildung des Herzogtums Sachsen-Meiningen infolge der Erbausein-andersetzungen im Zusammenhang mit dem Tode des Gothaer Herzogs Ernst dem Frommen, verlor das ehemalige Herzogtum Sachsen Coburg die Territorialherrschaft über die betroffenen Rennsteiggebiete, so dass etwa ab Mitte des 18. Jahrhunderts keine Quellennachweise aus dem Staatsarchiv Coburg mehr recherchiert wurden[20].
Sachsen-Meiningen hingegen bestand weiter bis zur Auflösung der Herzogtümer nach dem ersten Weltkrieg. Der Meininger Herzog Bernhard III. legte am 10. November 1918 seine Ämter nieder.
Das gleiche Schicksal erlitten die beiden Fürstentümer Rudolstadt und Sondershausen, die seinerzeit in Personalunion von Fürst Günther Victor regiert wurde. Er war übrigens der letzte Thüringer Fürst, der seine Ämter nach dem Ersten Weltkrieg, nämlich am 23. November 1918, niederlegte.
Mit der Übernahme der Regierungsgeschäfte durch das Land Thüringen gingen auch die zahlreichen historischen Grenzsteine in Landeseigentum über, ein Eigentum, das auch verpflichtet, offenbar aber auch eine Aufgabe, mit der die Verantwortlichen im heutigen Freistaat Thüringen überfordert sind.
Thüringisches Staatsarchiv Rudolstadt
Bestände im Zusammenhang mit dem Rennsteig (Bestände in rot wurden bereits recherchiert)
Amt Gehren, Nr. 136
Beschreibung der Landesgrenze zwischen den Ämtern Gehren und Eisfeld auf dem Thüringer Wald. 1618, 1663, 1708. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 134
Grenzbegehungs- und Grenzbeschreibungsprotokolle zwischen den Ämtern Gehren und Königsee einerseits und Eisfeld und Sonneberg andererseits sowie den Ämtern Gehren und Eisfeld. 1605-1618, 1663. Abschnitt 2, 3 4
Amt Gehren, Nr. 133
Grenzbeschreibung des Thüringer Waldes mit den Herzögen zu Sachsen Coburger Linie (nur teilweise beschrieben). 1605. Abschnitt 2, 3, 4
Amt Gehren, Nr. 132
Gleicher Inhalt. Abschnitt 2, 3, 4
Amt Gehren, Nr. 130
Markscheidung des Thüringer Waldes mit Sachsen entlang des Rennsteiges bis zum Dreiherrenstein Sachsen-Schwarzburg-Pappenheim. 2 Exemplare. 1596. Abschnitt 2, 3, 4
Amt Gehren, Nr. 286
Beschaffung von Porzellanmarken als Unterlage für die Landesgrenzsteine (Lieferant: Gotthelf Greiner, Breitenbach). 1845. Abschnitt 3, 4
Amt Gehren, Nr. 151
Besichtigung der Landesgrenze mit Henneberg vom Kleinen Dreiherrenstein (Schorte) bis zum Großen Dreiherrenstein bei Allzunah (1619), 1672. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 147
Beschreibung der Landesgrenze vom Großen Dreiherrenstein (Langewiesener Forst) begonnen. Vermarkung von Forst- und anderen Grenzen. 1663, 1715-1717. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 146
Landesgrenzbesichtigung des Thüringer Waldes zwischen den Ämtern Eisfeld und Gehren. 1663, 1708. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 140
Besichtigung und Vermarkung der Landesgrenze mit dem Amt Eisfeld vom Großen Dreiherrenstein (?) bis zur Hohen Heide. 1647-1648., 1661-1669 (Besichtigungsprotokoll gefertigt 1661, Blatt 76ff). Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 137
Bericht über eine Grenzbesichtigung zwischen den Ämtern Ilmenau und Gehren vom Dreiherrenstein bis zum Einfluss der Schorte in die Ilm. Grenzsteine und Grenzzeichen zwischen den Ämtern. 1619 (und Abschrift des Berichtes, 18. Jh.). Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 164
Besichtigung der Landesgrenze zwischen den Ämtern Eisfeld und Gehren vom Dreiherrenstein (Langewiesener Forst) bis zur Hohen Heide. Besichtigung der Grenze, Einmessung von Grenzsteinen und Berichte darüber. 1708-1785. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 163
Gleicher Inhalt. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 162
Besichtigung der Landesgrenze mit dem Amt Eisfeld, begonnen am Großen Dreiherrenstein (Langewiesener Forst). 1708. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 161
Gleicher Inhalt. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 153
Niederschriften über die Grenzbeziehungen auf dem Thüringer Wald zwischen Sachsen und Schwarzburg. 1672-1708, 1796. Abschnitt 2, 3, 4
Amt Gehren, Nr. 152
Grenzbegehung und- berichtigung im Thüringer Wald zwischen Sachsen und Schwarzburg-Sondershausen. 1672-1736. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 260
Protokoll über die Landesgrenzbegehung mit dem fürstl. Hildburghäusischen Amt Eisfeld, besonders entlang des Rennsteiges. 1795. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 214
Revision der Landesgrenze mit Schwarzburg-Rudolstadt... vom Dreiherrenstein bei Goldisthal (?) bis Goldisthal. 1748. Abschnitt 3, (4)
Amt Gehren, Nr. 200
Grenzbesichtigung zwischen den Ämtern Eisfeld und Gehren. 1738-1753. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 210
Gleicher Inhalt. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 199
Gleicher Inhalt. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 193
Niederschrift über die Steinaufrichtung des umgefallenen Kleinen Dreiherrensteines und des Grenzsteines zwischen dem Großen und Kleinen Dreiherrenstein. 1736. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 188
Landesgrenze mit Hildburghausen vom Kleinen Dreiherrenstein in der Schorte und der alten Öhrenstocker Straße. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 282
Anweisung an die Forstbediensteten und Schulzen an das Amt Gehren zur jährlichen Besichtigung der Landesgrenze und Berichterstattung über den Zustand der Grenzsteine. 1843-1844. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 262
Grenzbeschreibungsprotokoll (Landesgrenze) zwischen den Ämtern Eisfeld und Gehren längs- bzw. auf dem Rennsteig vom Dreiherrenstein (Langewiesener Forst) bis zum Masserberger Forst, Amt Schwarzburg von 1795. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 261
Niederschrift über die zwischen den Ämtern Gehren und Eisfeld stattgefundene Landesgrenzbesichtigung. 1795. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 283 (s. auch Kammerverwaltung Gehren, Nr. 134)
Anzeige eines von Wilhelm Dreißigacker zu Neustadt S.M. z. Teil über die Landesgrenze auf Sondershäuser Gebiet überbauten Wohnhauses. Verhand-lungen wegen der Grenzausgleichung. 1843-1845. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 277
Landesgrenz-Vermessungsregister mit Meiningen zwischen dem Großen und Kleinen Dreiherrenstein, aufgenommen von G. Reinecke. 1835. Abschnitt
Amt Gehren, Nr. 272
Wiederaufstellung des umgefallenen Kleinen Dreiherrensteines an der Straße von Langewiesen nach Frauenwald. 1812. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 276
Besichtigung der Landesgrenze mit Henneberg vom Großen Dreiherrenstein bei Allzunah bis zum Kleinen Dreiherrenstein. Vorschlag der Veränderung der Grenzlinie in gerader Linie. 1834-1844. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 273
Einladung des Amtmannes in Gehren bzw. der von ihm Beauftragten zur Teilnahme an der Grenzhandlung... (Kleiner Dreiherrenstein). 1815. Abschnitt 4
Amt Gehren, Nr. 250
Protokoll der Grenzbeschreibung vom 29. Juli 1779 zwischen dem Großen Dreiherrenstein und der Hohen Heide. Abschnitt 4
Regierung Rudolstadt, Nr. 150
Grenzrevision zwischen dem Coburgischen Amt Neustadt und dem Schwarzburg-Rudolstädtischen Amt Königsee am 14. und 15. September 1728, protokolliert in Steinheid am 16. September 1728. Abschnitt 2
Kammer Rudolstadt, C,XI,1,a,Nr.2
-
Marckscheiddung des Turinger Waldes ao 1596, vom 21. und 22. Juni 1596 (Blatt 001-017).
-
Waldmarkung zwischen Graf Albrecht von Schwarzburg und Hunstein & Christoph von Pappenheim. Gräfenthal vom 26. Juli 1596 (Blatt 018-021). Abschnitt 2, 3, 4
Landratsamt Königsee, XV,1
Grenzrevision von der Hohen Lach bis zum Dreiherrenstein am Saarzipfel vom 21. bis 24. Juli 1794. Abschnitt 2
Thüringisches Forstamt Großbreitenbach, Nr. 131 (hist. Registratursignatur: 1368)
Errichtung und Unterhaltung des Kriegsgefangenenlagers in Neustadt am Rennsteig. 1941-1943.
Thüringisches Forstamt Großbreitenbach, Nr. 239 (hist. Registratursignatur: 1368)
Verwaltung und Versorgung des Kriegsgefangenenlagers in Neustadt am Renn-steig. 1943-1945.
Thüringisches Forstamt Großbreitenbach, Nr. 183
(hist. Provenienz: Schwarzburgische Oberförsterei Großbreitenbach, auch: Registratursignatur 3112) Markierung der Forstgrenzen.
Enthält u.a. Erhaltung der Grenzsteine am Rennsteig, Grenzprüfung, unbefugte Entfernung von Landesgrenzsteinen, Grenzunterhaltungsvorschläge und Ausführungsnachweise. 1913-1934. Abschnitt 4
Kammerverwaltung Gehren, Nr. 83
Grenzirrungen im Schortetal zwischen den Ämtern Ilmenau und Gehren. Enthält u.a. die Besichtigung und Berichtigung der Landesgrenze vom Grenzhammer bis zum Einfluss der Schorte in die Ilm bis zum Kleinen Dreiherrenstein, Vermessung und Anfertigung eines gemeinsamen Risses über die Grenze, Setzen von Grenzsteinen. 1768-1833. Abschnitt 4
Kammerverwaltung Gehren, Nr. 85
Landesgrenzbesichtigung zwischen den Ämtern Eisfeld und Gehren vom Gro-ßen Dreiherrenstein bis zur Streitecke an der Hohen Heide sowie Berichtigung der Grenze und Erneuerung von Grenzsteinen. 1795-1834. Abschnitt 4
Kammerverwaltung Gehren, Nr. 91
Breichtigung der Landesgrenze in der Schorte zwischen den Ländern Sachsen-Weimar und Schwarzburg-Sondershausen und Erneuerung beschädigter Grenz-steine. 1810. Abschnitt 4
Kammerverwaltung Gehren, Nr. 90
Besichtigung der Landesgrenze mit Sachsen-Weimar, begonnen am Grenz-hammer bei Langerwiesen entlang der Schorte und Setzen von Grenzsteinen. 1810. Abschnitt 4
Kammerverwaltung Gehren, Nr. 93
Erörterung der Kostenfrage für die Landesgrenzregulierung in der Schorte. 1811. Abschnitt 4
Kammerverwaltung Gehren, Nr. 98
Anfrage des Amtes Eisfeld über Zeitfestsetzung zur Wiederherstellung der um-gefallenen Landesgrenzsteine. 1815. Abschnitt 4
Kammerverwaltung Gehren, Nr. 122
Besichtigung der Landesgrenze mit Preußen zwischen Großem und Kleinem Dreiherrenstein (Bei Allzunah). Enthält u.a. einen Vorschlag zur Veränderung der Grenze in gerader Linie. 1834. Abschnitt 4
Kammerverwaltung Gehren, Nr. 125
Revision der Landesgrenze mit Preußen zwischen Kleinen und Großen Dreiherrenstein. 1834-1835. Abschnitt 4
Kammerverwaltung Gehren, Nr. 134 (s. auch Amt Gehren, Nr. 283)
Verhandlungen wegen der beim Hausbau des Wilhelm Dreißigacker zu Neustadt am Rennsteig erfolgten Grenzüberschreitung. Enthält u.a. Entschädigungsforderungen. 1843-1845. Abschnitt 4
Kammerverwaltung Gehren, Nr. 135
Revision der Landesgrenze mit Meiningen. 1843-1847. Abschnitt 4
Kammerverwaltung Gehren, Nr. 136
Berichte über die mit der Landesgrenze zusammenfallenden Forst- und Jagd-grenzen in der Oberherrschaft, Anordnung zur regelmäßigen Grenzbegehung durch die Forstbediensteten. Enthält auch Abschrift der Grundsätze bei Ländergrenzrevisionen, abgeschlossen zwischen Gotha, Meiningen und Rudolstadt. 1843-1849. Abschnitte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
A VIIIb Schwarzburgica, Nr. 7 Sammelband, Blatt 1-32
(hist. Provenienz: collegit Johann Ludwig Hesse, Registratursignatur: A.5.0, alte Archivsignatur: A VIIIb Nr. 7)
Historia Schwarzburgica, von M. Kreysig. Bibliografie zur Natur, Geschichte, Münzkunde, Verwaltungs,- Orts,- Kloster- und Kirchengeschichte beider Fürstentümer Schwarzburg.
A VIIIb Schwarzburgica, Nr. 7 Sammelband, Blatt 246-249
(hist. wie vor)
Auszüge aus topografischen Karten des 18. Jahrhunderts (Herzogtum Coburg, Schwarzburg).
A VIIIb Schwarzburgica, Nr. 10 Sammelband: Collectanea ad topographiam Schwarzburgicam spectantia, collegit J.L.Hesse, Blatt 148-159
(hist. Provenienz: Johann Ludwig Hesse 1783-1789, Alte Archivsignatur: A VIIIb Nr. 10)
Von Schülern gefertigte Ortsbeschreibung von Neuhaus. 1783-1789.
A VIIIb Schwarzburgica, Nr. 12, Sammelband: Bemerkungen über die Grafschaft Schwarzburg, Blatt 1-12
(hist. Registratursignatur: 149/1 (?), alte Archivsignatur: A VIIIb Nr. 12)
Stammtafeln, Notizen zur Histografie, zu Landesherren und Landesregierung, Wappen, Passivlehen, Streitigkeiten mit Kursachsen.
A VIIIb Schwarzburgica, Nr. 12, Sammelband: Bemerkungen über die Grafschaft Schwarzburg, Blatt 13- 35
(hist. wie vor)
Topografie der fürstlich Schwarzburgischen Lande (ausführlich).
A VIIIb Schwarzburgica, Nr. 27, Verzeichnis aller Münzsorten in dem... Münzcabinete...des...Ludwig Günthers Fürsten zu Schwarzburg...von Ludwig Albert Walther, 1776 (Fortsetzung von A VIII Nr. 26), Blatt 1-34.
(hist. Provenienz: Eschrich (?), alte Archivsignatur: A VIIIb Nr. 27)
Schwarzburgische Münzen. 1776.
Hessesche Collectaneen, A VIII 2c Nr. 29
Schwarzburg-pappenheimische Grenzbereitung vom 18. Juni 1548, im Amtsbuch des Amtes Schwarzburg (1545-1553). Abschnitt 2
Hessesche Collectaneen, A VIII 2c Nr. 29
Vermarkung der Landesgrenze vom Dreiherrenstein Hoher Lach bis zum Vorgänger des Großen Dreiherrensteines vom Freitag nach Vitus 1548. Abschnitt 2, 3, 4
Hessesche Collectaneen, A VIII 6d Nr. 20
(hist. alte archivarische Signatur: A 5 4 a)
Zeitgenössische Abschrift (?), Ende 16. Jh.
Teilungsvertrag der Grafen Günther von Schwarzburg und Albrecht von Schwarzburg über Wälder, Forsten und Jagdrechte. 25. Juli 1579 (am Tage Jacobi). Blatt 0-7, Quart.
Hessesche Collectaneen, A VIII 6d Nr. 47
Original oder zeitgenössische Abschrift, Ende 15., Anfang 16. Jh.
Teilungen nach dem Schwarzburger Hauskrieg. Enthält u.a. ein Register des Amtmannes Friedrich von Lonerstadt- Markscheidung der Wälder. Blatt 1-20, Quart.
Hessesche Collectaneen, A VIII 8b Nr. 1, Band 1, Blatt 0-502, Folio
Paul Jovius: Chronikon Schwarzburgicum (Schwarzburgische Chronik).
Vorwort und Kapitel 1-17. Abschrift Mitte 18. Jh. (?).
Hessesche Collectaneen, A VIII 8b Nr. 1, Band 2, Blatt 1-540, Folio
Paul Jovius: Chronikon Schwarzburgicum (Schwarzburgische Chronik). Kapitel 18-68. Abschrift, Mitte 18. Jh. (?).
Hessesche Collectaneen, A VIII 8b Nr. 1, Band 3, Blatt 1-368, Folio
Paul Jovius: Chronikon Schwarzburgicum (Schwarzburgische Chronik). Vor-wort und die Teile 1 und 2. Abschrift, Mitte 18. Jh. (?).
Hessesche Collectaneen, A VIII 8b Nr. 1, Band 4, Blatt 1-558, Folio
Paul Jovius: Chronikon Schwarzburgicum (Schwarzburgische Chronik). Teile 3 und 4. Gesperrt, Schadensliste-Nr. 1459. Abschrift, Mitte 18. Jh. (?).
Hessesche Collectaneen, A VIII 8b Nr. 1, Band 5, Blatt 1-510, Folio
Paul Jovius: Chronikon Schwarzburgicum (Schwarzburgische Chronik). Teil 5, Kapitel 1-28. Gesperrt, Schadensliste- Nr. 1460. Abschrift, Mitte 18. Jh. (?).
Hessesche Collectaneen, A VIII 8b Nr. 1, Band 6, Blatt 1-409, Folio
Paul Jovius: Chronikon Schwarzburgicum (Schwarzburgische Chronik). Teil 5, Kapitel 29-39. Abschrift, Mitte 18. Jh. (?).
Hessesche Collectaneen, A VIII 8b Nr. 1, Band 7, Blatt 1-366, Folio
Paul Jovius: Chronikon Schwarzburgicum (Schwarzburgische Chronik), Teil 5, Kapitel 68-76. Darin eingebunden sind Urkundenabschriften und Abschriften aus weiteren Quellen. Abschrift, Mitte 18. Jh.
Hessesche Collectaneen, A VIII 8b Nr. 1, Band 8, Blatt 1-482, Folio
Paul Jovius: Chronikon Schwarzburgicum (Schwarzburger Chronik), Teil 5, Kapitel 40-67. Darin eingebunden sind Urkundenabschriften und Abschriften aus weiteren Quellen. Abschrift, Mitte 18. Jh.
Hessesche Collectaneen, A VIII 8b Nr. 1, Band 9, Blatt 1-161, Folio
(hist. alte archivische Signatur A 5 5 b, Provenienz/ Eigentumsvermerke: Ex libris Friedrich Günther von Schwarzburg Rudolstadt)
Johann Nicolaus Schwarz: Index in Jovii Chronikon Schwarzburgicum. Abschrift (?), Anfang 19. Jh.
Hessesche Collectaneen, A VIII 4d Nr. 18, Seite 1-45, Oktav
Schwarzburgische Forstordnung von 1635, kopiert von einem Exemplar in der Stadtbibliothek zu Leipzig. Abschrift, Anfang 19. Jh.
Hessesche Collectaneen, A VIII 5b Nr. 2, Blatt 1-614, Folio
Grenzbeschreibung der Ämter der Rudolstädter Oberherrschaft. Abschriften, Anfang 19. Jh.
Hessesche Collectaneen, A VIII 5c Nr. 4, Blatt 1-914, Folio
(hist. alte archivische Signatur: A 8 5 c)
Beschreibung der Ämter des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt. Besteht aus grob nach Ämtern und Orten geordneten Originalschreiben, Tabellen und Exzerpten. Originaldokumente ab dem 16. Jh., zusammengefasst im 18. Jh.
Hessesche Collectaneen, A VIII 7c Nr. 7, Blatt I-II, 1-329, Folio
Flur- und Grenzbeschreibung der Ämter und Ortschaften der Schwarzburg-Rudolstädter Oberherrschaft. Unter Verwendung älterer Orignale, zusammengestellt um 1713.
Hessesche Collectaneen, A VIII 6a Nr. 15, Seite 0-760, Folio
(hist. alte archivische Signatur: A 5 3 b)
Johann Christian Juncker: Ehre der gefürsteten Grafschaft Henneberg, erstes Buch, Auszug aus dem Manuskript im Archiv in Gotha. Abschrift, 1828.
Thüringisches Staatsarchiv Meiningen
Bestände im Zusammenhang mit dem Rennsteig (Bestände in rot wurden bereits recherchiert)
Staatsministerium, Abt. des Innern, Sig. 11375, 860
Grenz-Acta des Amts Eisfeld. 1619. Abschnitt 3, 4
Staatsministerium, Abt. des Innern, Sig. 11371, 861
Grenzbeziehungsprotokolle zwischen den Ämtern Schalkau und Eisfeld. 1803. Abschnitt 2, 3
Staatsministerium, Abt. des Innern, Sig. 10163 (hist. Inneres alt 6, 3)
Landesgrenzen. Enthält u.a. Regulierung der Landes-, Forst- und Jagdgrenzen. 1839-1842. Abschnitt 1, 2, 3, 4
Staatsministerium, Abt. des Innern, Sig. 10164 (hist. Inneres alt 6, 4)
Landesgrenzen. Enthält u.a. tabellarische Übersichten der Landes-, Forst- und Jagdgrenzen. 1840. Abschnitt 1, 2, 3, 4
Staatsministerium, Abt. des Innern, Sig. 10164 (hist. Inneres alt 6, 8)
Übersichten über die in Grenzangelegenheiten mit Nachbarstaaten obschwebenden Differenzen. 1842-1845. Abschnitt 1, 2, 3, 4
Staatsministerium, Abt. des Innern, Sig. 10171 (hist. Inneres alt 6, 10)
Landesgrenzen. Enthält u.a. Tabellen über den Zustand derselben. 1843-1846. Abschnitt 1, 2, 3, 4
Staatsministerium, Abt. des Innern, Sig. 10172 (hist. Inneres alt 6, 11)
Landesgrenzen. Enthält u.a. Tabellen über den Zustand derselben. 1845. Abschnitt 1, 2, 3, 4
Staatsministerium, Abt. des Innern, Sig. 10174 (hist. Inneres alt 6, 13)
Landesvermessung. Enthält u.a. Versteinung der Landesgrenzen. 1859-1864.
Abschnitt 1, 2, 3, 4
Staatsministerium, Abt. des Innern, Sig. 11438
Marckungs Register und Verzeichnis der Markscheidung des Thüringer Waldes, begonnen am Großen Dreiherrenstein und beendet am Dreiherrenstein Hoher Lach, vom 21. und 22. Juni 1596. Abschnitt 2, 3, 4
Zinck-Mattenberg`sche Sammlung, 1231
Beschreibung des Amtes Eisfeld. 1648. Abschnitt 3, 4
Zinck-Mattenberg`sche Sammlung, 1232 a,b,c
Beschreibung des Amtes Eisfeld. 1666. Abschnitt 3, 4
Zinck-Mattenberg`sche Sammlung, 1254
Erbzins- und Lehensbuch mit einem Verzeichnis und einer Beschreibung der Grenzmarkung uff den Hohen Wäldern des Amts Sonneberg usw., Mittwochs und Donnerstags den 20., 21. Juni anno 1621. Erbbuch des Amtes Neustadt von 1659. Blatt 69- 85 Vorderseite. (s. auch Amtsgericht Sonneberg, 2.4a) Abschnitt 2
Zinck-Mattenberg´sche Sammlung, 1254, Blatt 38-40, 250-251
Glashütten in der Lauschaw. 1598, 1601. Abschnitt 2
Kreis Saalfeld 1307, 3213
(hist. Altsignatur 66,9 b)
Gräntz-Beschreibung des fürstl. Sächs. Ambts Gräfenthal anno 1670. Beinhaltet auch die Beschreibung der Hohen Lach. Abschnitt 2
Kreis Sonneberg, 639 (hist. 11,3a)
Anweisung zur Unterstützung der bayerischen und preußischen Vermessungsingenieure bei der Landesvermessung. 1820-1863. Abschnitt 2
Kreis Sonneberg, 743 (hist. 12, 13z)
Die Abtrennung des Gutes Glücksthal aus dem Gemeindeverband Lauscha und die Einverleibung in die Domänenwaldung. 1860. Abschnitt 2
Kreis Sonneberg, 51 (hist. 4, 2a)
Berichte und Übersichten über den Zustand der Landes-, Forst- und Jagdgrenzen sowie Bestimmungen zur Sicherung der Landesgrenzen. 1839-1850. Abschnitt 2
Kreis Sonneberg, 56 (hist. 4, 2k)
Anfertigung von Porzellanmarken zur Kennzeichnung der Landesgrenzsteine. 1843-1861. Abschnitt 2
Kreis Sonneberg, 81 (hist. 4, 2ar)
Protokolle über die Begehung der Landesgrenze zu Schwarzburg-Rudolstadt. 1812-1813. Abschnitt 2
Kreis Sonneberg, 97 (hist. 4, 2aag)
Veränderung der Landesgrenze zu Schwarzburg-Rudolstadt bei Igelshieb zur Fortsetzung des Straßenbaues. 1820-1827. Abschnitt 2
Kreis Sonneberg, 97 (hist. 4, 2aah)
Beaufsichtigung und Erhaltung der Landesgrenze zu Schwarzburg-Rudolstadt, besonders zum Amt Königsee. 1857-1864. Abschnitt 2
Kreis Sonneberg, 98 (hist. 4, 2aai)
Begehung, Revidierung und Versteinung der Landesgrenze zu Schwarzburg-Rudolstadt, besonders zum Amt Oberweißbach. 1830-1858. Abschnitt 2
Kreis Sonneberg, 99 (hist. 4, 2aak)
Festsetzung und Versteinung der Grenze zwischen S.-Coburg und Schwarzburg. 1716-1733. Enthält auch die Grenzrevision vom 21. bis 24. Juli 1794 zwischen Hoher Lach (Lange Marck) und Dreiherrenstein bei Siegmundsburg (Schießplatz) Abschnitt 2
Kreis Sonneberg, 100 (hist. 4, 2 aal)
Grenzberichtigung und Grenzsteinsetzung zwischen S.-Coburg und Schwarz-burg. 1716-1728. Abschnitt 2
Kreis Sonneberg, 101 (hist. 4, 2aam)
Grenzbeschreibung zwischen S.-Coburg-Meiningen und Schwarzburg-Rudolstadt. 1794. Abschnitt 2
Kreis Sonneberg, 103 (hist.4, 2l)
Ausschreiben der Herzoglichen Landesregierung vom 13. Februar 1843, betreffend die Sicherstellung der Landesgrenzen und das dabei zu beobachtende Vefahren (Druckausgabe). Abschnitt 1, 2, 3, 4
Amtsgericht Sonneberg, 2.4a
Verzeichnis und Beschreibung der Grenzmarkung uff den hohen Wäldern des Amts Sonneberg usw. Mittwochs und Donnerstags den 21., 22. Juni anno 1621.
Im Erbbuch des Amtes Neustadt von 1659. Blatt 69-85 Vorderseite. Abschnitt 2
Staatsarchiv Coburg
Bestände im Zusammenhang mit dem Rennsteig (Bestände in rot wurden bereits recherchiert)
Urk LA D 108
Grenze der Steinenheide gegen Schwarzburg vom 14. Januar 1473. Abschnitt 2
Urk LA D 740
Acta die zwischen dem Hause Sachsen und denen Grafen von Schwarzburg ufen Thüringer Wald entstandener Gräntzirrungen darob ausgerichteten Vertrag und gehaltener Besichtigung betreffend, ab ao. 1526 ad. 1583. Abschnitt 2
Urk LA D 741
Schriften, die Gränze zwischen Sachsen und Schwarzburg am Rennsteig und der Kleinen Heide betreffend. 1535. Abschnitt 2
Urk LA D 110
Vertrag zwischen Sachsen und Schwarzburg wegen der Grenze und Markung auf dem Thüringer Wald vom 10. Oktober 1548. Abschnitt 2, 3, 4
GA Kastenamtsbuch 1492-1510, 27, Blatt 211-212
Beschreibung des Forschengereuther Forstes, bis nach Limbach, Scheibe und an die Sahr. Ca. 1509/1510. Kastenamtsbuch von 1492-1510. Abschnitt 2
LA F 14602
Waldordnung der Pflege Coburg de. 1555. Abschnitt 2, 3, 4
Lreg. 1735
Grenze zwischen Schaumburg, Coburg und Rudolstadt, auch mit Saarzipfel, vom 03. August 1733. Abschnitt 2
Plansammlung 1044
Riss Kleine Heide, Hoher Lach von 1530. Abschnitt 2
Fußnoten
[1] Thüringisches Staatsarchiv Rudolstadt: Marckscheiddung des Turingerwaldes 1596. Originalprotokoll des Archives der Kammer Rudolstadt vom 21. Und 22. Juni 1596. C,X,1,a. Nr. 2.
[2] Vergl. hierzu auch: Bildnachweise zu Stein 52
[3] Staatsarchiv Coburg: LA D 740. 1526-83. Acta die zwischen dem Hause Sachsen und denen Grafen von Schwartzburg ufen Thüringer Wald entstandener Gräntzirrungen darob ausgerichteten Vertrag und gehaltener Besichtigungen betreffend, ab ao. 1526 ad. 1583.
[4] A. Werneburg: Beiträge zur Genealogie und Geschichte des Fürstlichen Hauses Schwarzburg. Verlag von A. Stenger. Erfurt 1877. Anhang: Über das Wappen der Grafen von Kevernburg und Schwarzburg. Seite 37-51. Werneburg verwirft zunächst die Annahme, die Gabel könne eine Mist- oder Stallgabel darstellen, verweist aber im weiteren Verlauf auf ihr Vorkommen auf Münzen der Zeit um 1500. Auf Seite 50 seiner Abhandlung stellt er dann die Vermutung auf, die Gabel (Schere) könne evtl. mit dem Sondershäuser Ort Scherenberg in Verbindung stehen, in welchem er den ursprünglichen Sitz der Herren von Sondershausen vermutete.
[5] Gert Oswald: Lexikon der Heraldik. VEB Bibliographisches Institut Leipzig 1984. Seite 335.
[6] Wappenkalender von 1738. Verlag Christoph Weigel. Nürnberg.
[7] G. Wallenhauer: Heimatskunde der Fürstentümer Schwarzburg. 2. Auflage. Druck und Verlag der Fürstlich privaten Hofbuchdruckerei F. Mitzlaff. Rudolstadt 1882. Seite 30.
[8] Mareile. Bote des Rennsteigvereins. II. Jahrgang Nr. 4 vom 01. Juli 1934. Seite 141.
[9] Thüringisches Staatsarchiv Rudolstadt: Fürstendiplome. Texte von Dr. P. Langhof. DEWAG Potsdam. 1990.
[10] Anmerkung: Inwieweit diese Auffassung heute noch vertreten wird ist dem Autor nicht bekannt. Das Wappen des Landkreises Saalfeld Rudolstadt zeigt ebenfalls den Kamm und die Gabel. In der Beschreibung dieses Wappens jedoch wird bereits von einer Schlackengabel gesprochen.
[11] Peter Mast: Thüringen- Die Fürsten und ihre Länder. Styria- Verlag 1992. Seite 155.
[12] Schwarzburgbote: Dr. Berthold Rein. Von Hauszeichen der Schwarzburger Grafen. Nr. 14 vom 22. 12. 1932.
[13] Schwarzburgbote: Alte Goldfundstätten- Nr. 12 vom 14.12.1933.
[14] Rudolstädter Heimathefte: Dr. Heinz Deubler. Bemerkungen zu den Angaben über Rudolstadt und das Schwarzburger Wappen in der neueren Heraldik- Literatur. Nr. 7/8. Juli/ August 1985. Seite 174- 175.
[15] Rudolstädter Heimathefte: Volker Deubler. Sonderausgabe. Die Grafen und Fürsten von Schwarzburg-Rudol-stadt. 3. Auflage 1991.
[16] Anmerkung: 1617 gab es in Thüringen noch kein Porzellan. Das wurde erst von J. G. Greiner im Jahre 1761 in Limbach nacherfunden. Der erste Porzellanbrand war im November 1772. Der Zeuge unter dem Stein stammt auch nicht aus Limbach, sondern aus Großbreitenbach, wurde jedoch erst nach 1843 eingebaut, nachdem per Verordnung alle Landesgrenzsteine neu zu nummerieren und zu kontrollieren waren.
[17] Ausschreiben der Herzoglichen Landesregierung vom 13. Februar 1843 betreffend die Sicherstellung der Landesgrenze und das dabei zu beobachtende Verfahren. No. 95.
[18] Die Tafel wurde vom Rennsteigverein 1896 gestiftet und angebracht. Damit wurde aber auch das zuvor von Germar entdeckte Wappensymbol unachtsamerweise zerstört.
Bruno von Germar fotografierte den Grenzstein im Juli 1912 und stellte eine nach unten zeigende senkrechte Gabel fest. Nach Kroebel soll diese Gabel der Rest einer Doppelgabel gewesen sein, deren oberes Gegenstück weggeplatzt ist. Dieses Gegenstück ist nach meinem Dafürhalten auf dem Foto von Germar noch deutlich erkennbar, im Gegensatz zu dem nach unten zeigenden Teil, der in seinen Proportionen auf dem Foto einen unnatürlichen Eindruck macht, als ob er mittels Fotomontage nachträglich eingefügt wurde.
[19] Staatsarchiv Coburg. LA D 110. Vertrag zwischen Sachsen und Schwarzburg wegen der Grenze und Markung auf dem Thüringer Wald vom 10. Oktober 1548.
[20] Der Erbfolger von Ernst dem Frommen, Herzog Albrecht von Sachsen-Coburg verstarb im Jahre 1699. Der daraus entstandene Erbstreit konnte erst im Jahre 1735 durch ein Reichshofratkonklusum gelöst werden. Durch den Tod des Herzogs fielen die nördlichen Coburger Landesteile an Saalfeld und Meiningen. Nördlich der Rennsteiglinie grenzten die beiden Fürstentümer Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg- Sondershausen an.
Gabelformen 1 bis 39
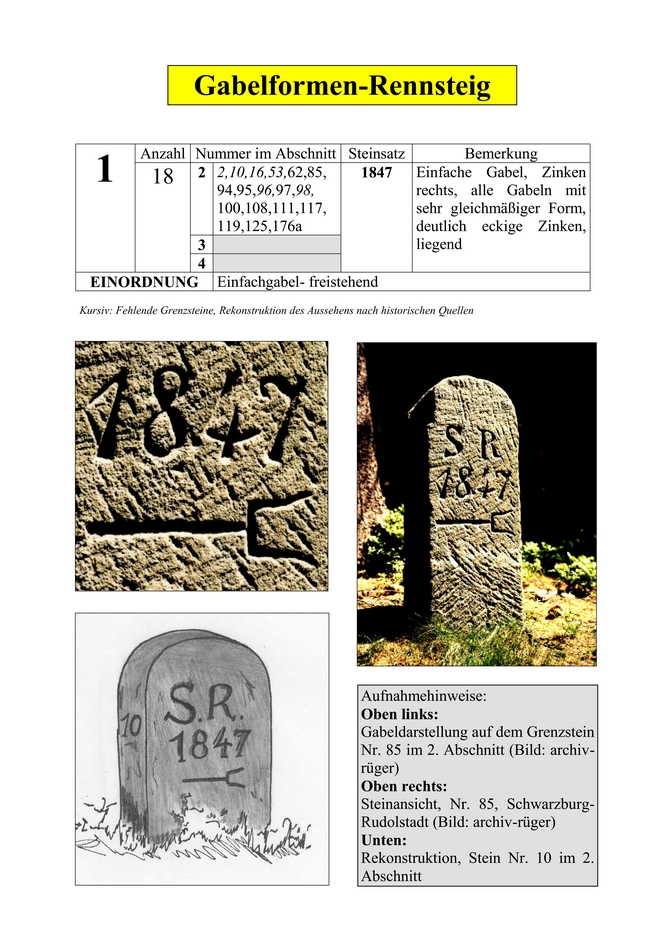
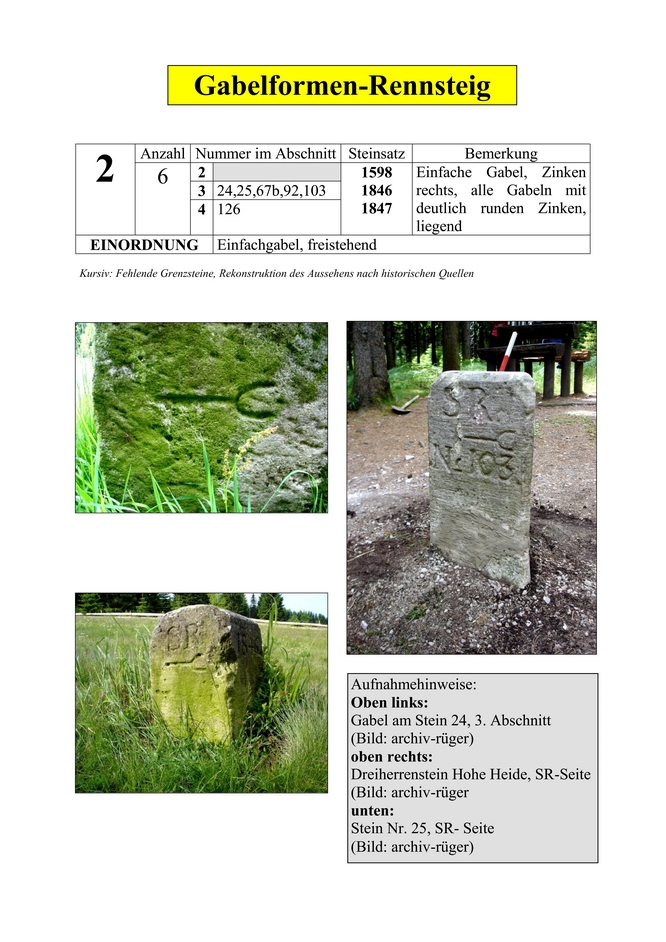
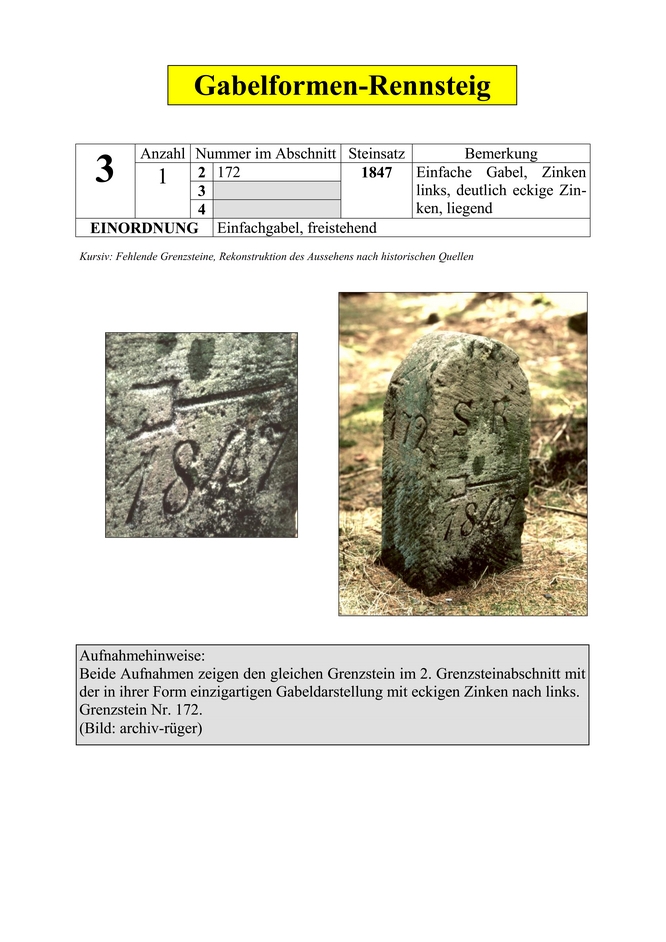
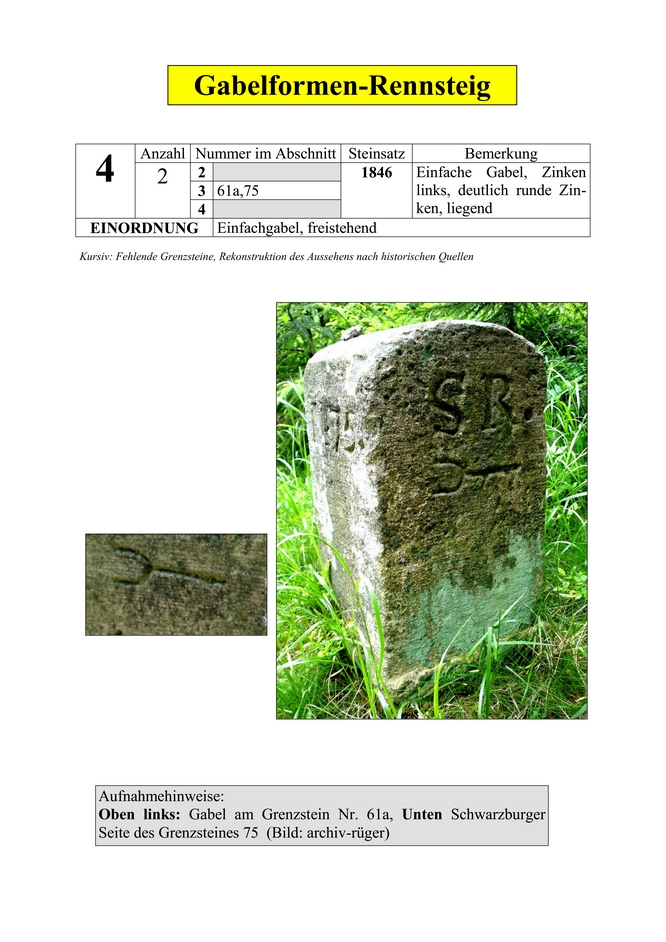
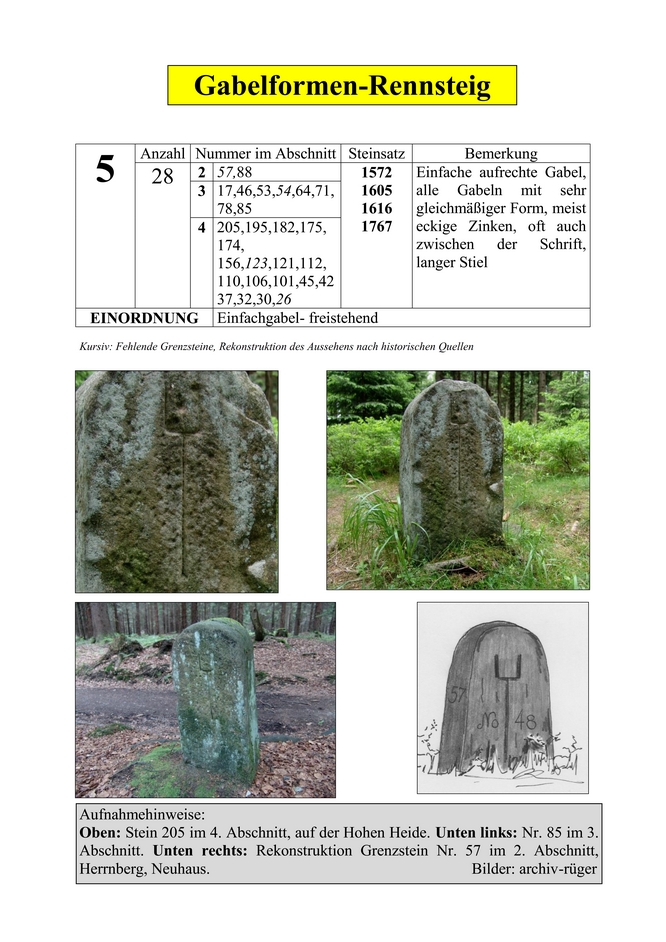
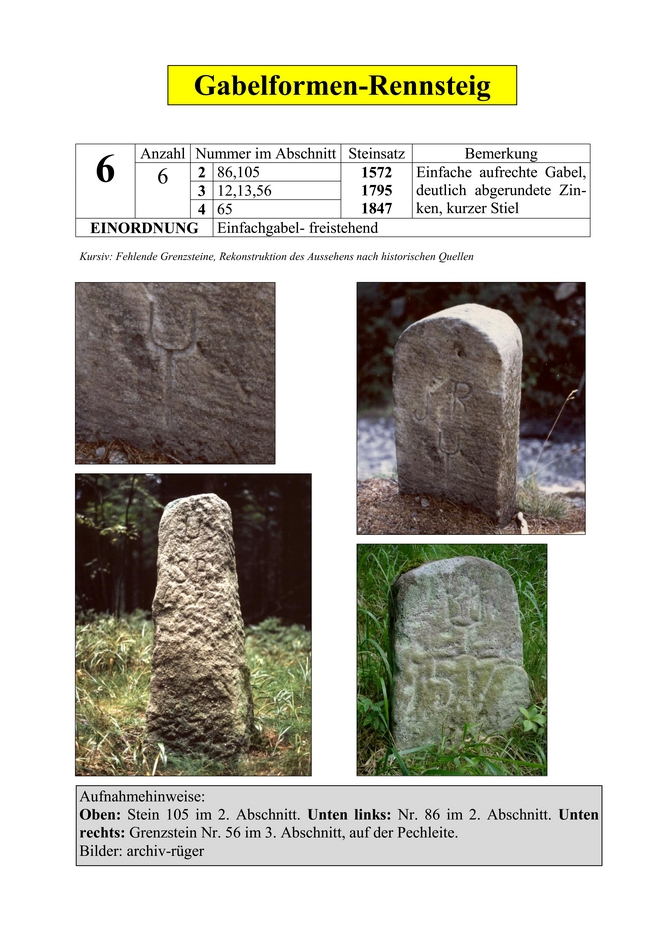

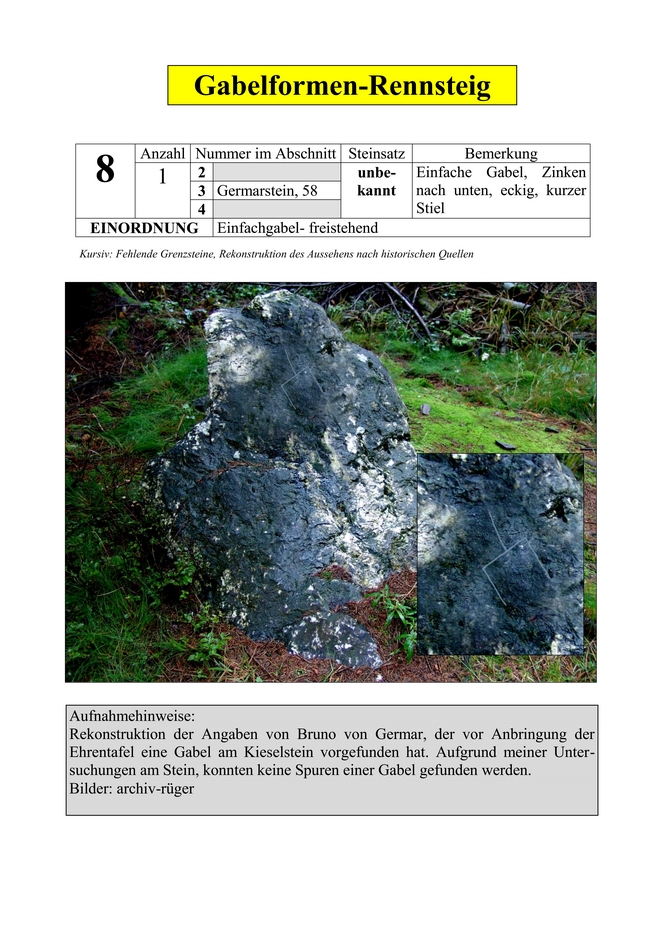

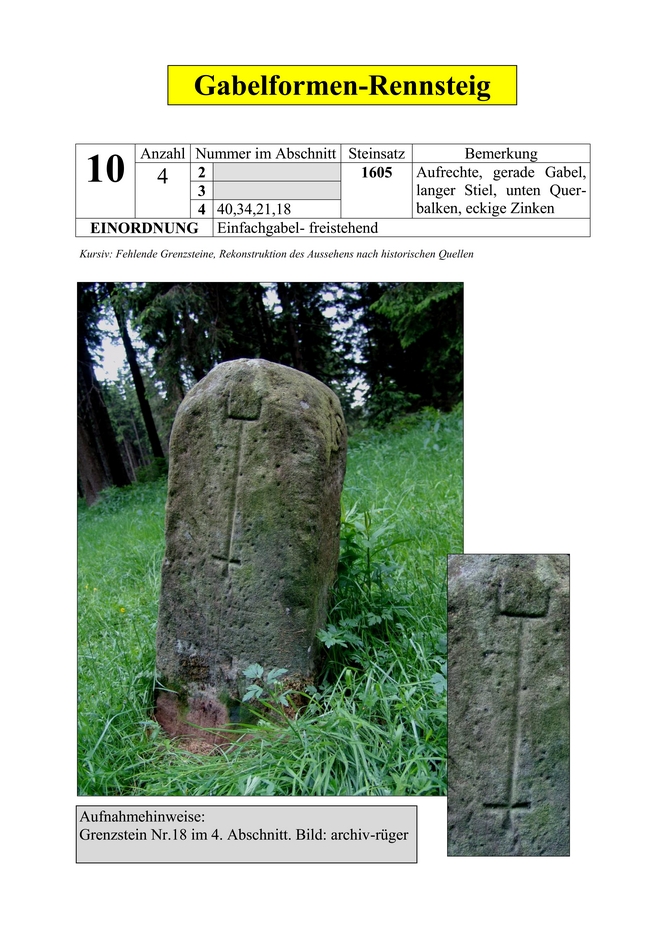

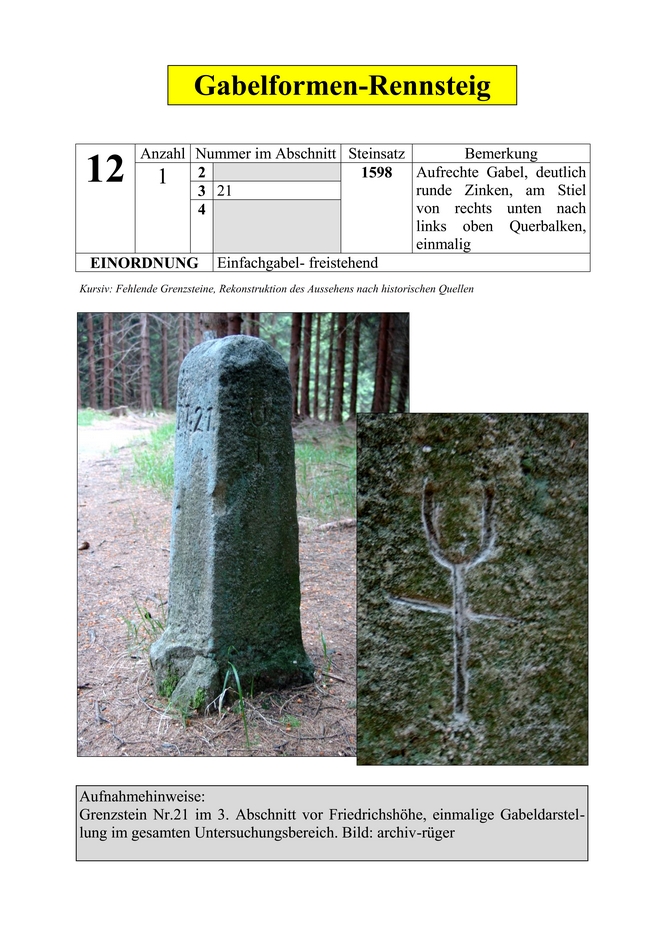
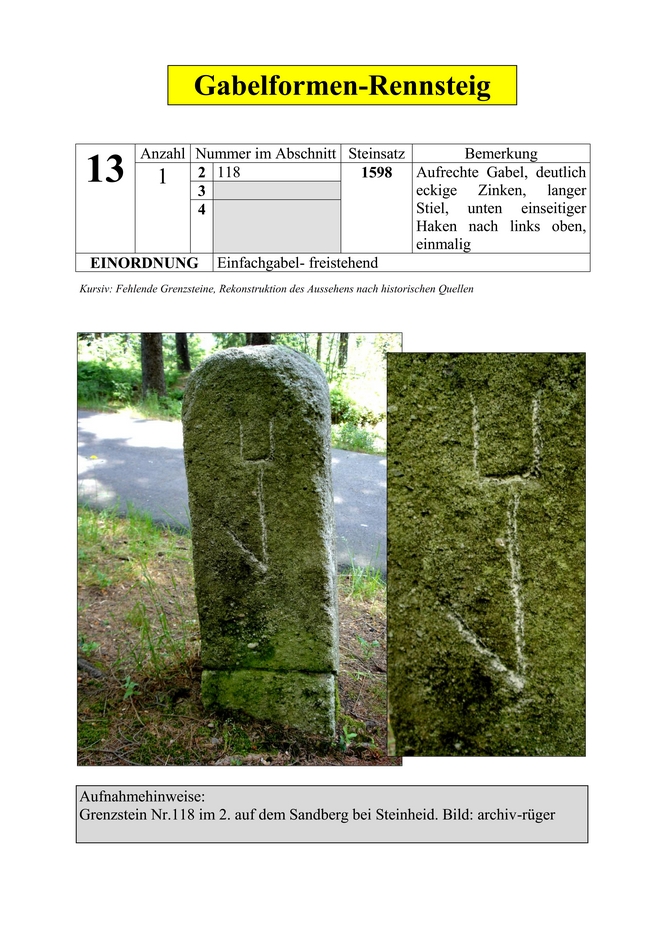
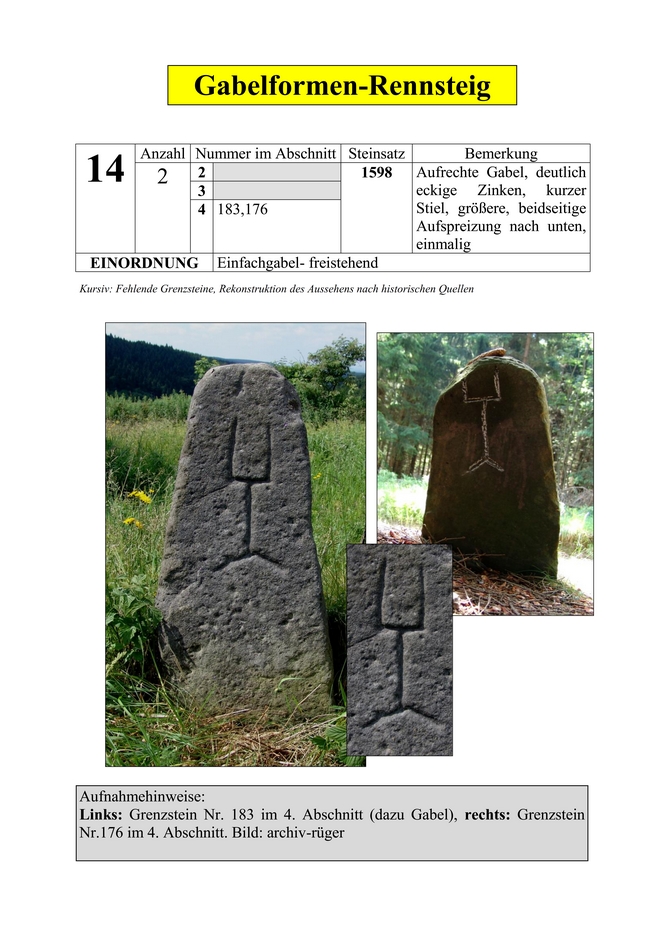
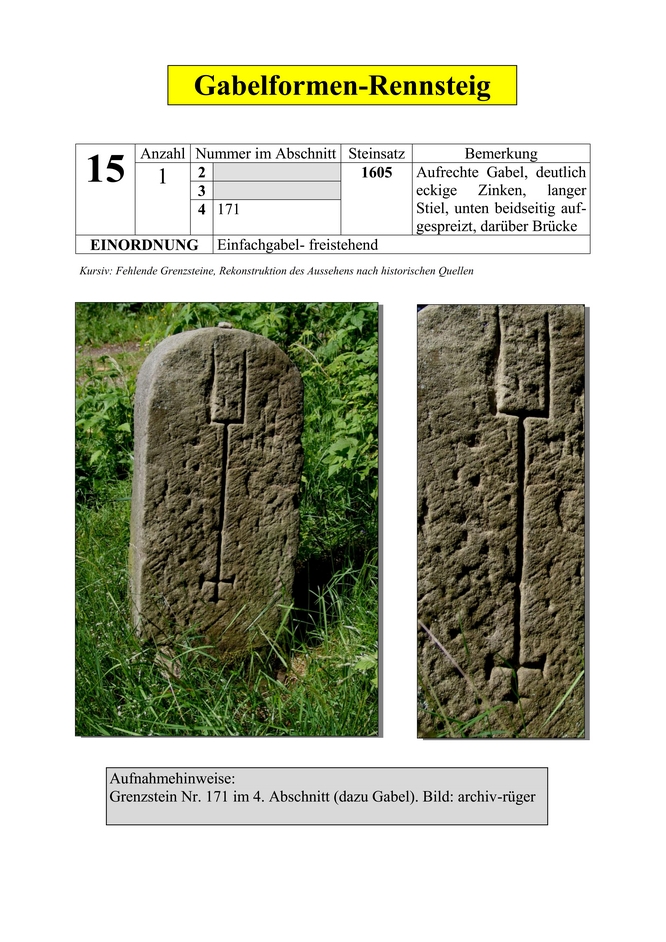
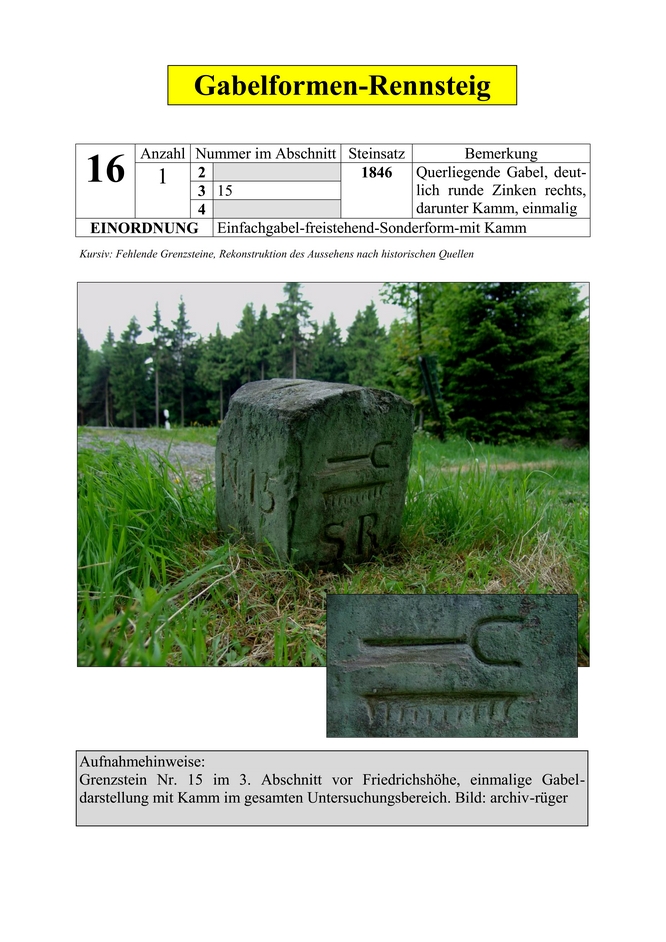
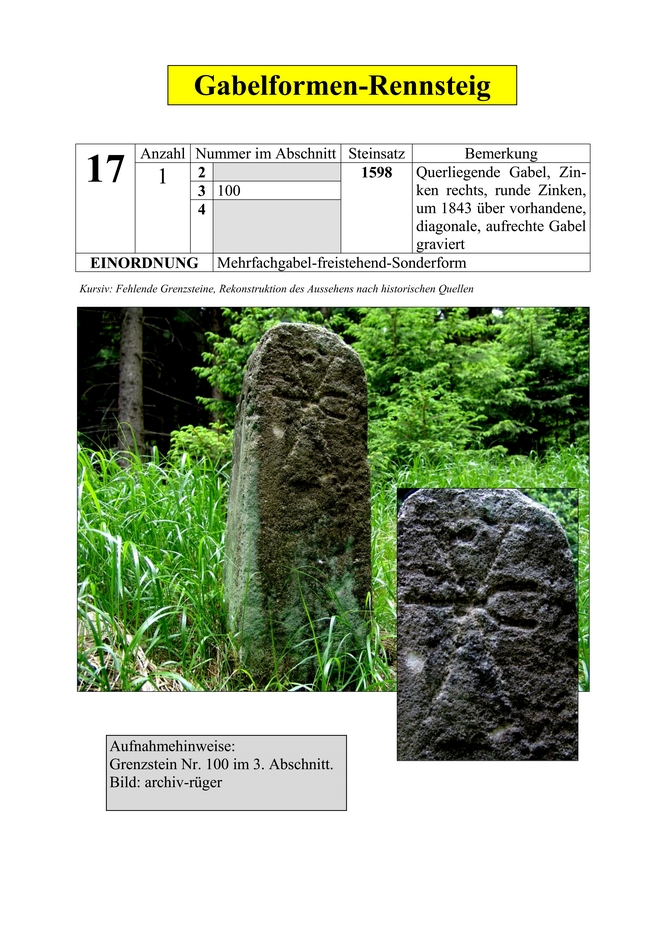
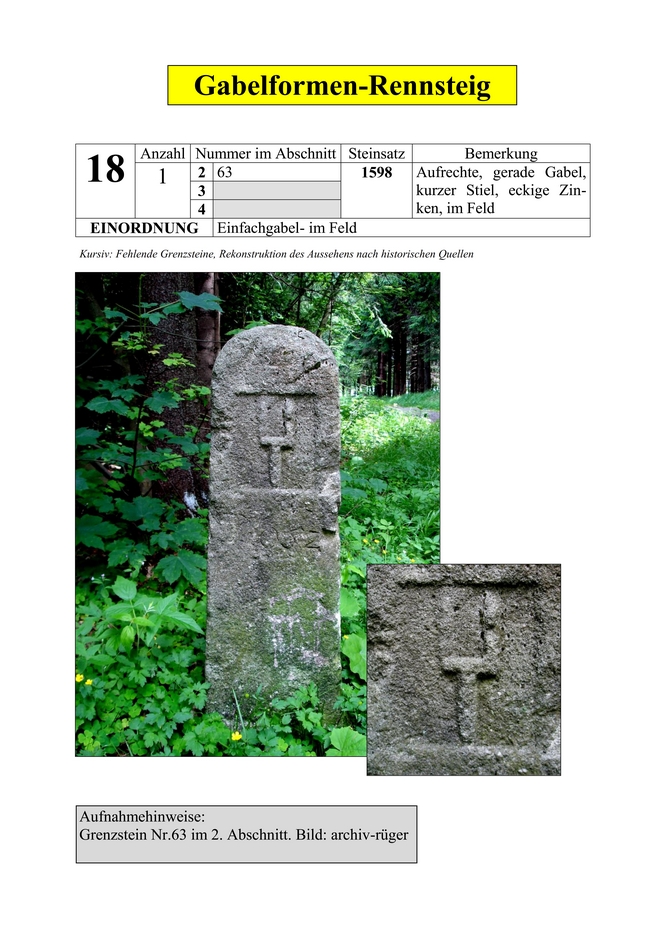
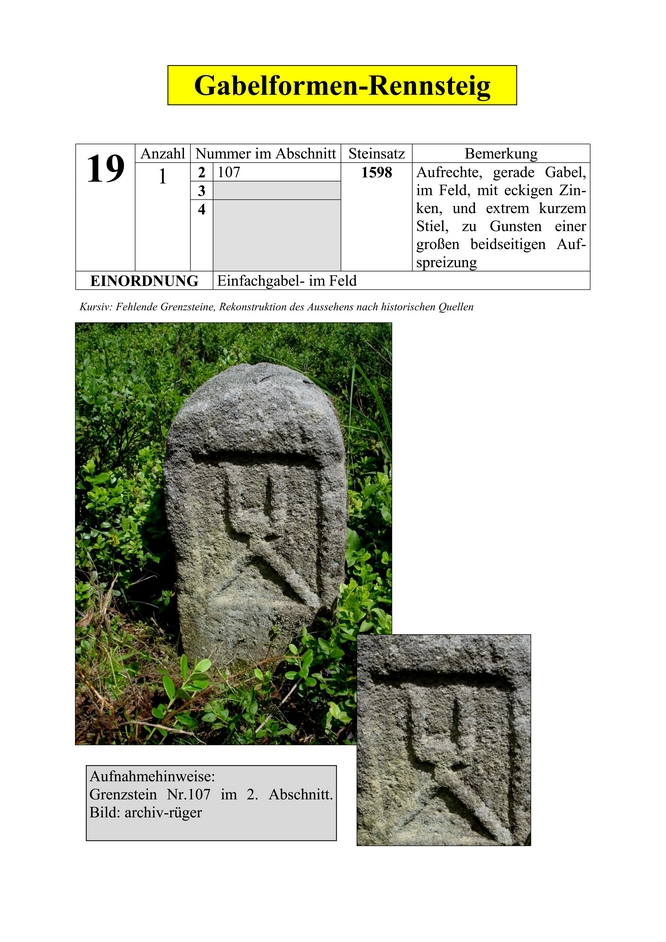
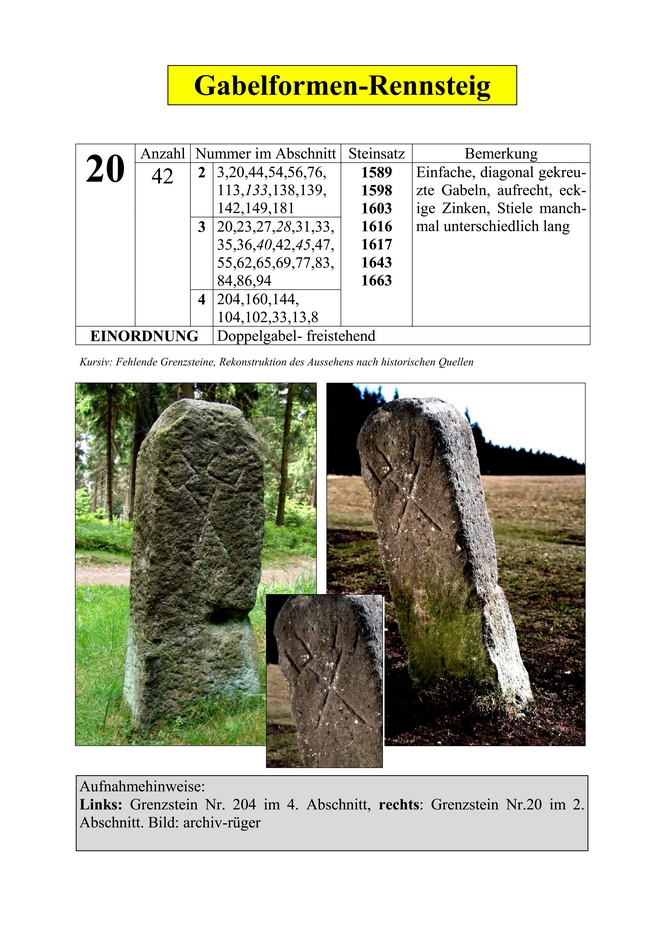
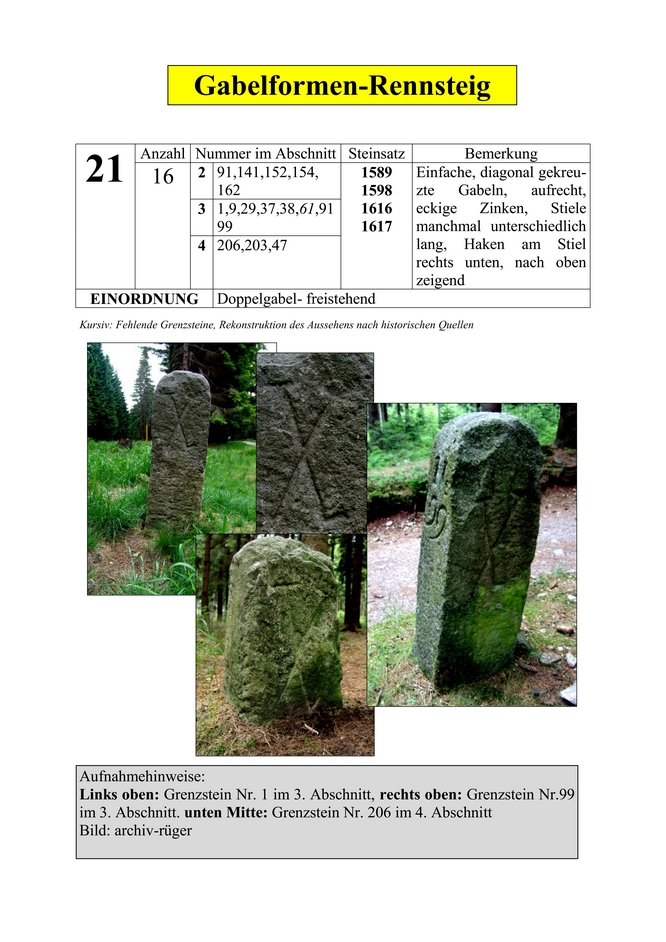
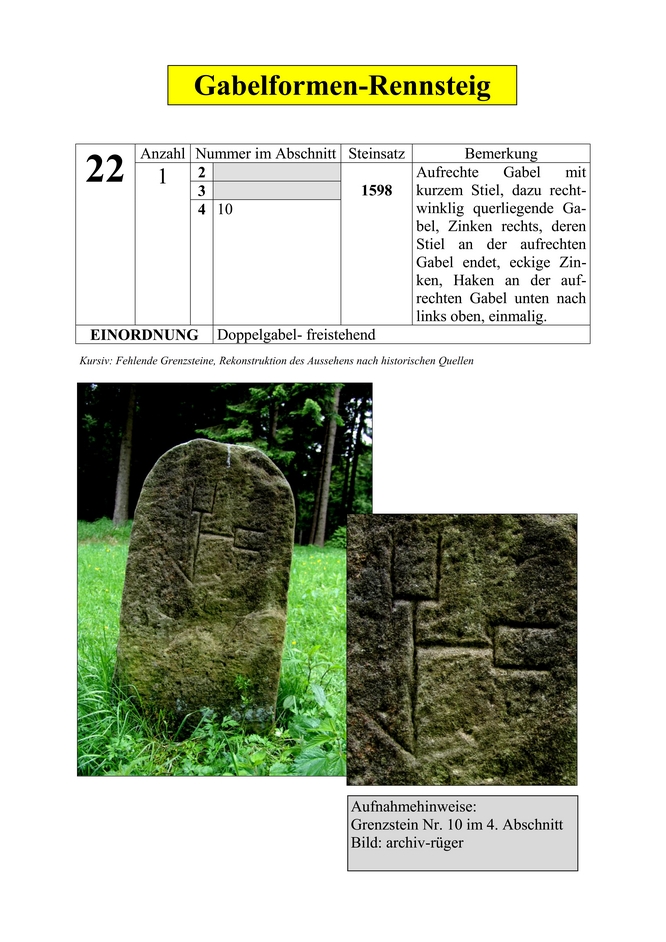
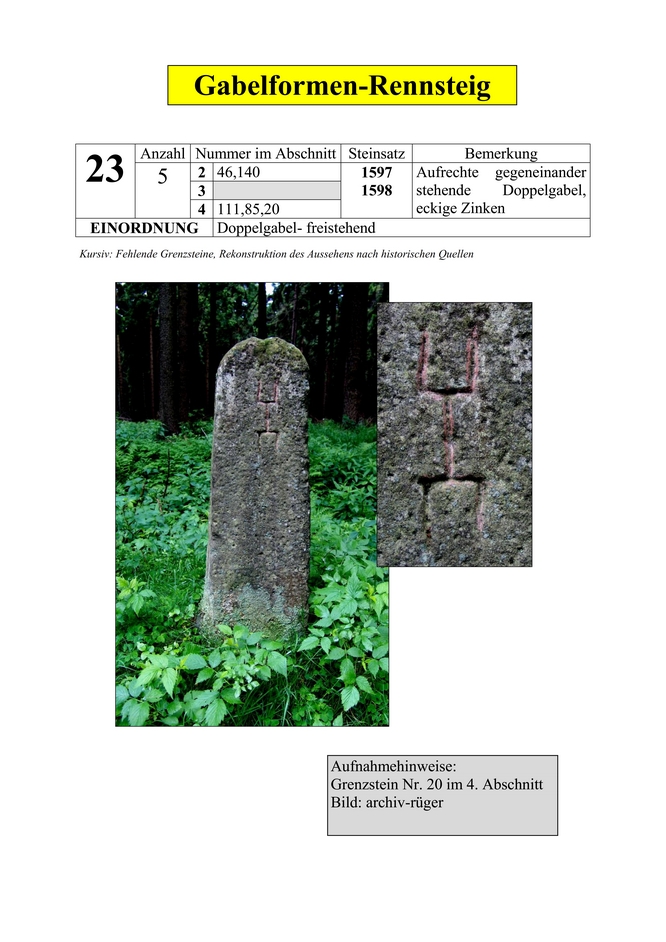
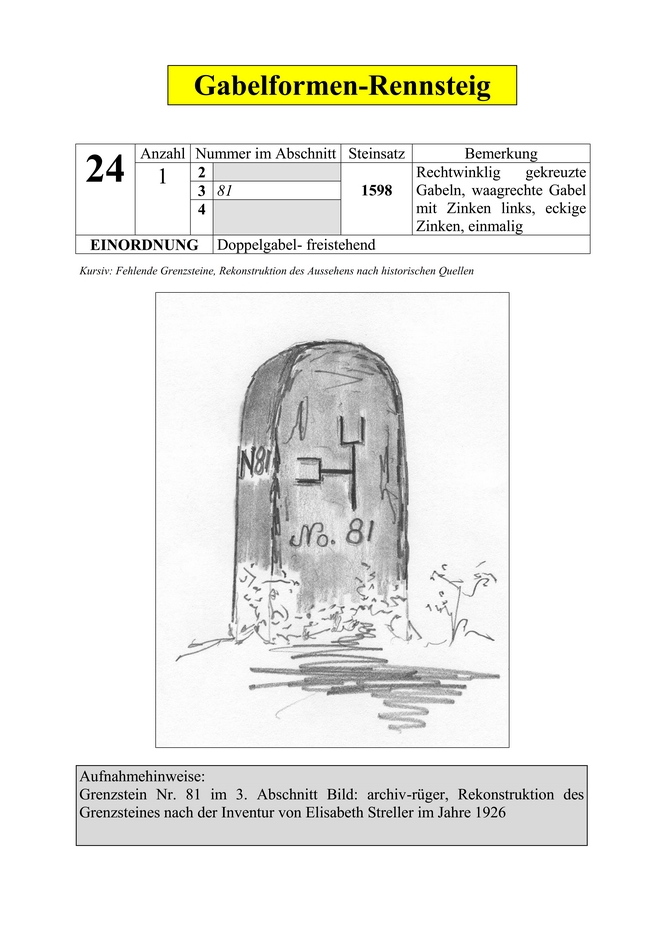
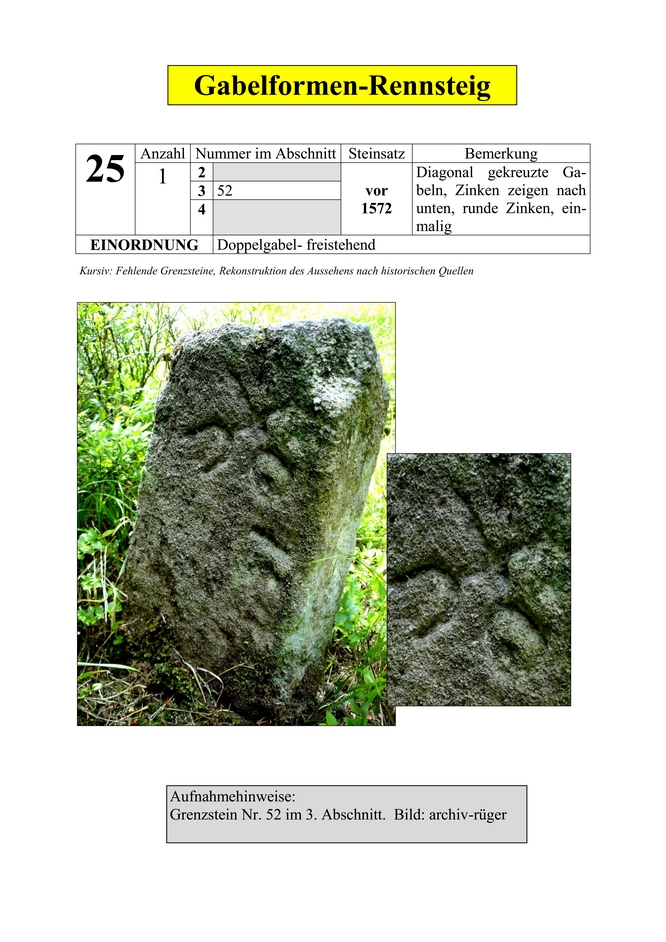
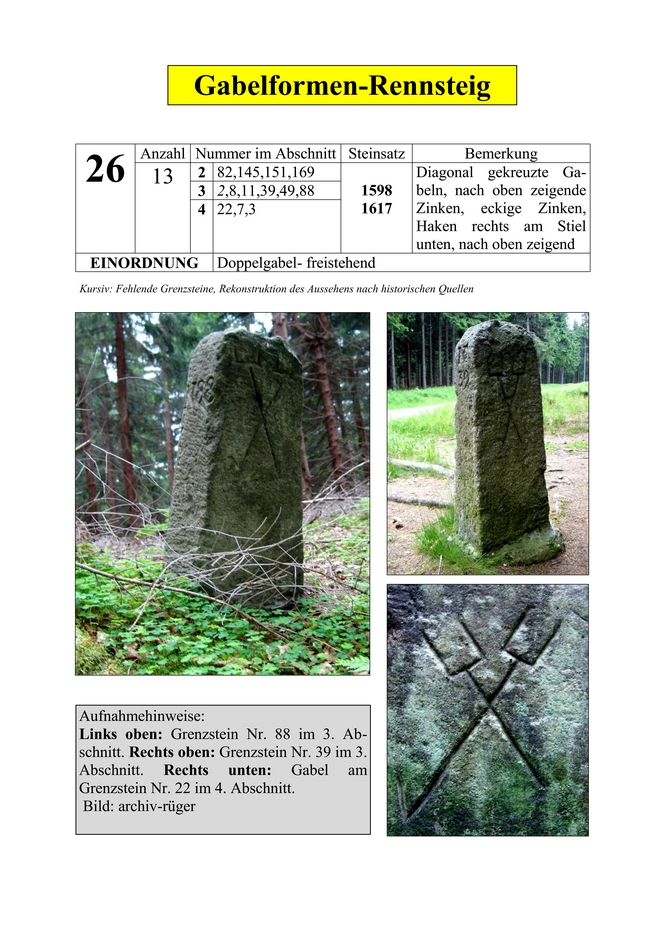
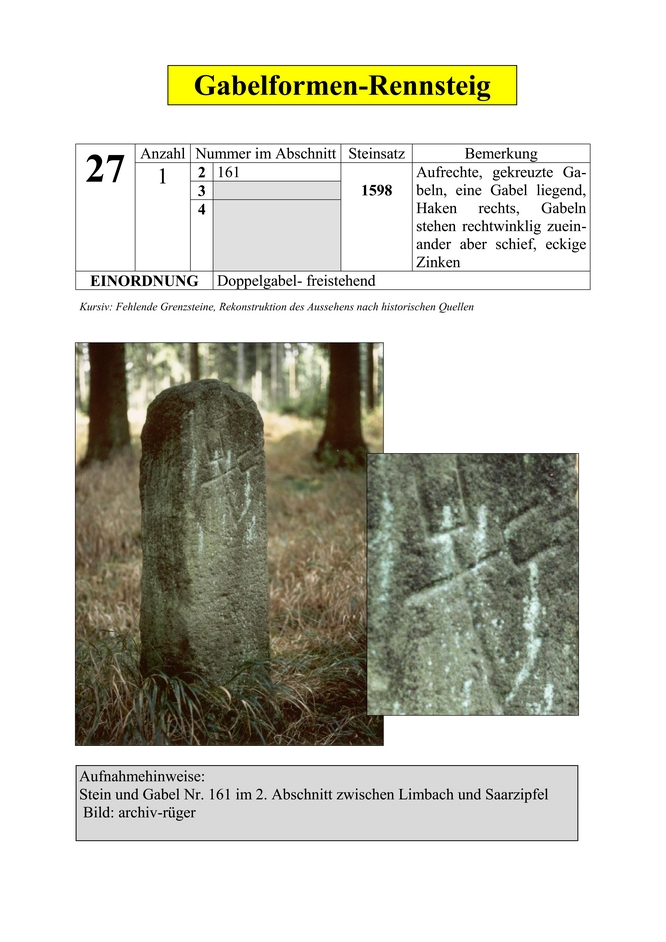
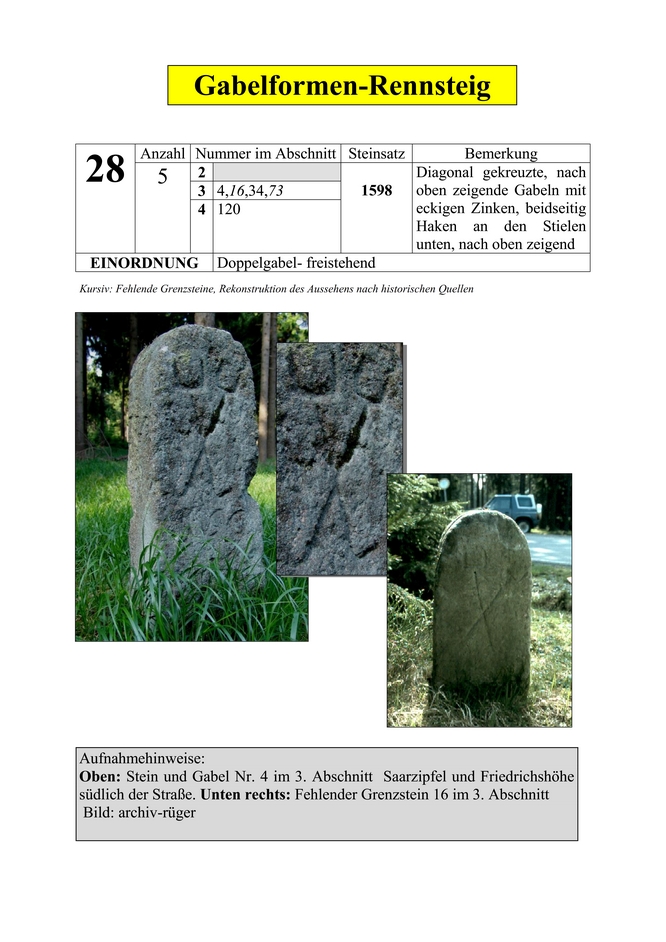
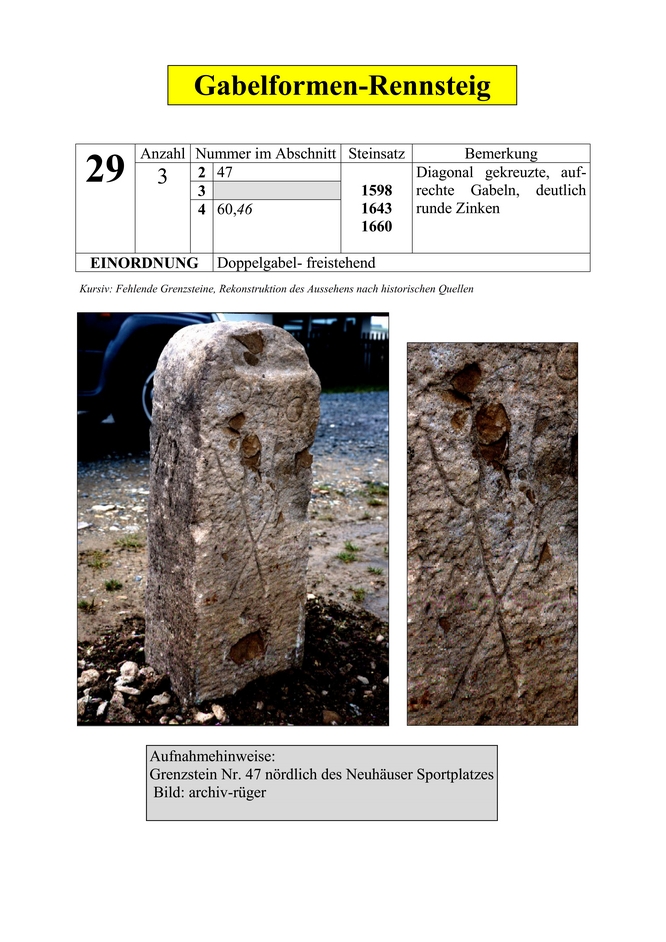
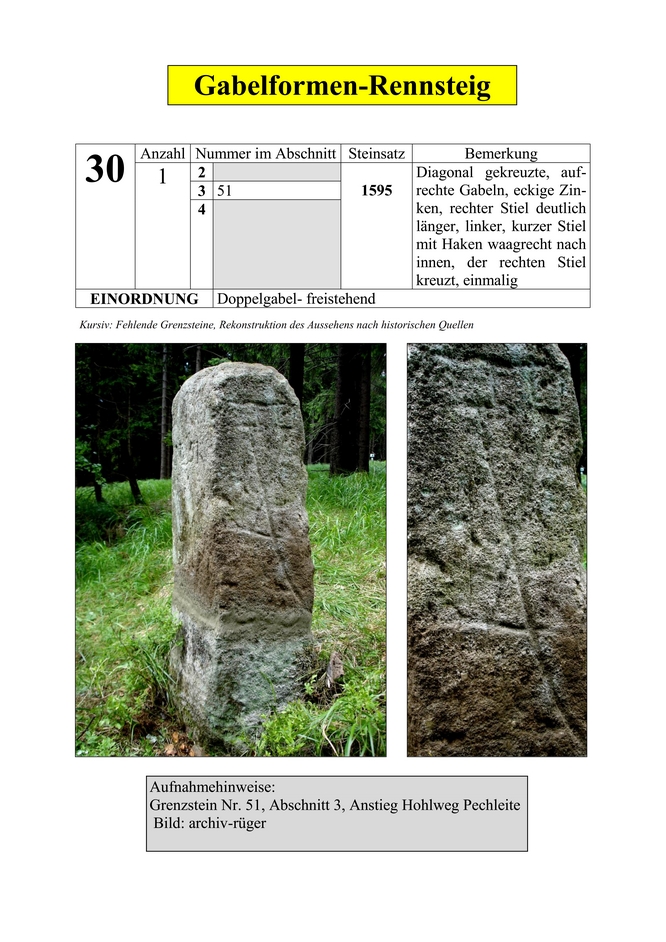
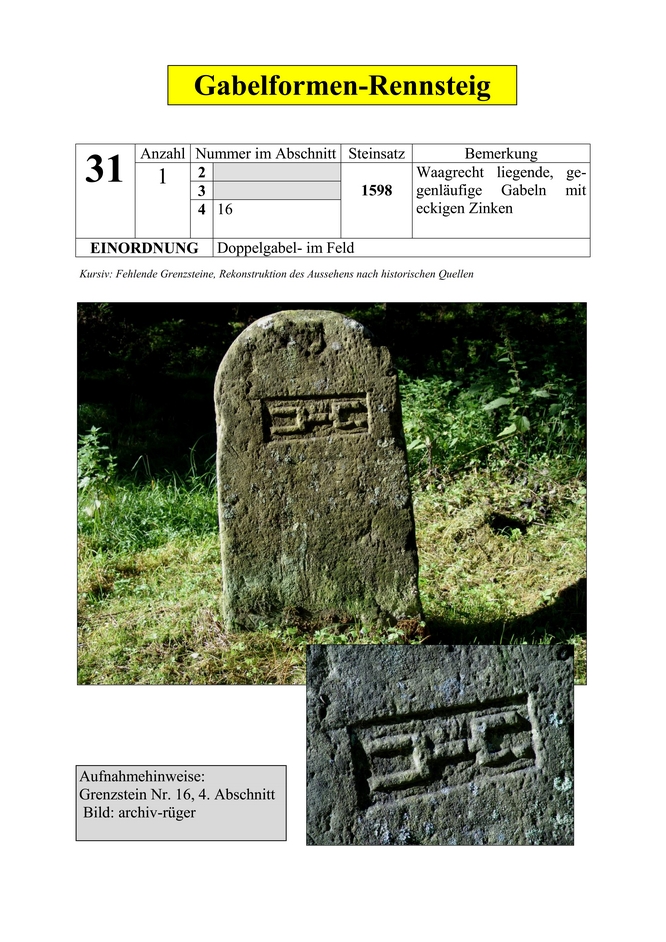
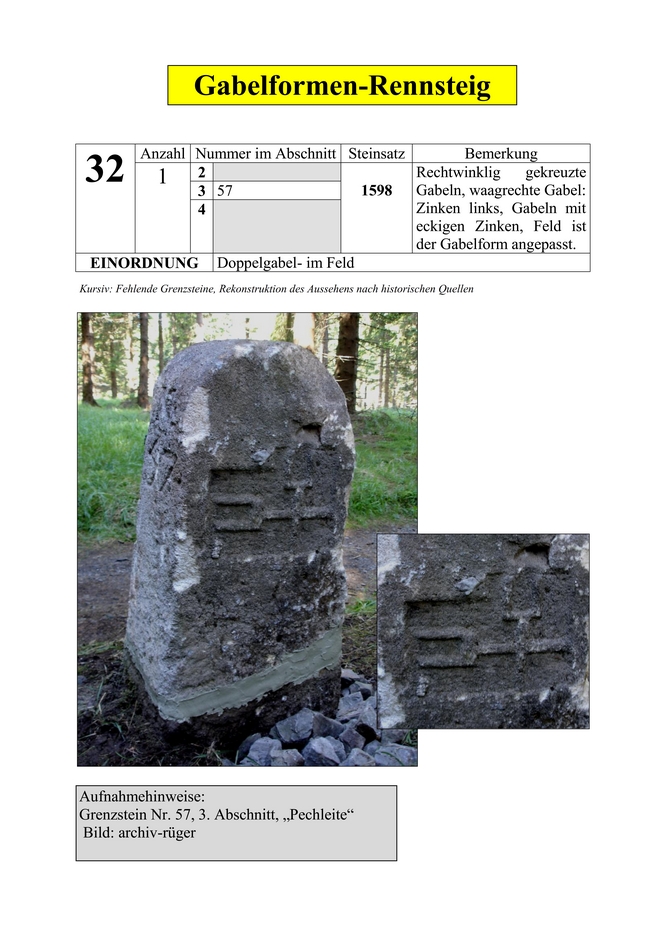
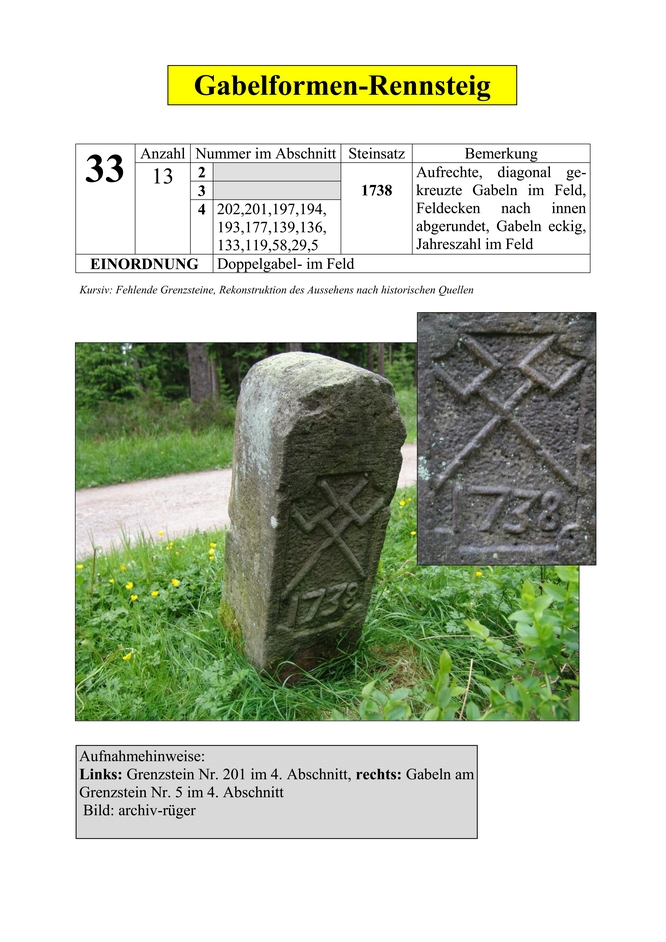
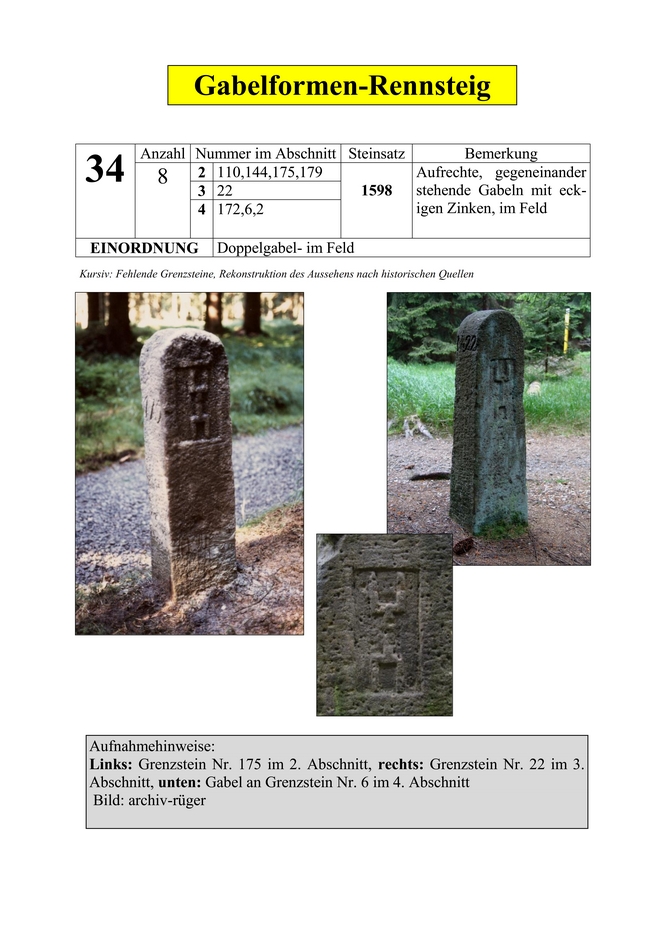
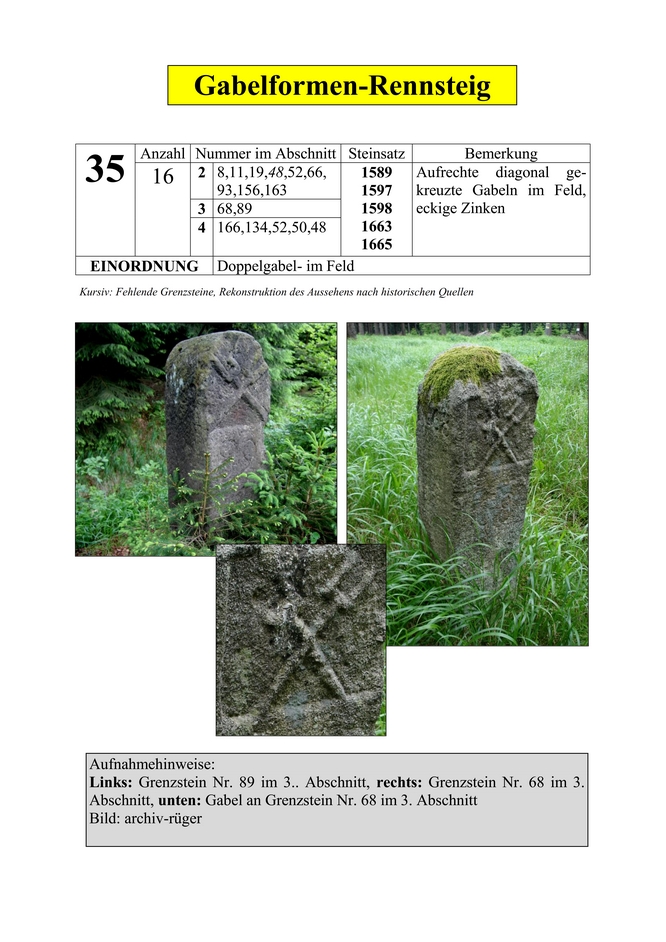
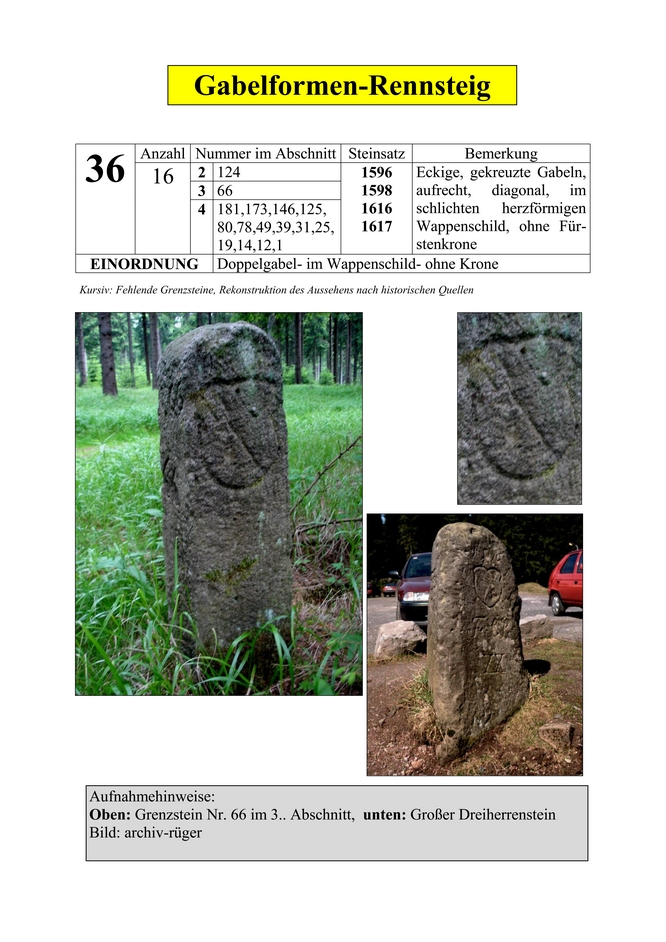
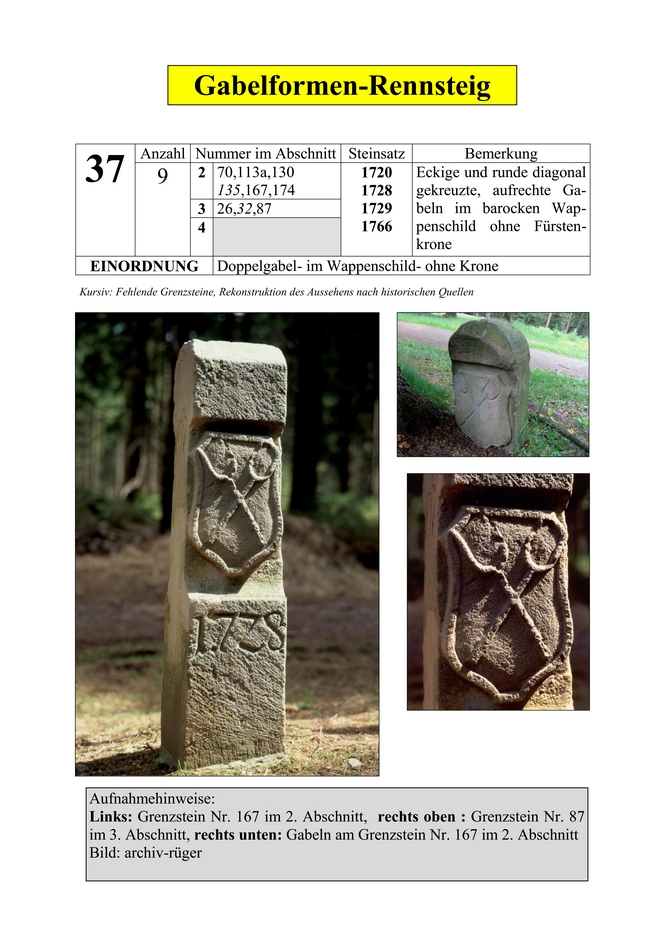
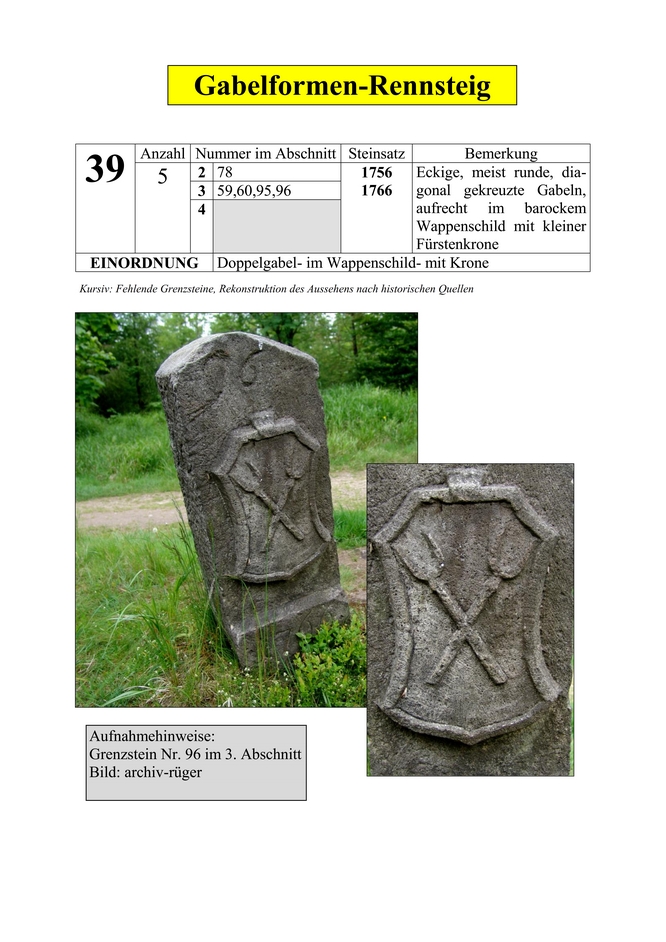
Scobel, Albert E. P.
* 05. November 1851 in Glogau
† 07. Februar 1912 in Kastelruth

Schon in seiner Jugend trat er in die geographische Anstalt von Carl Flemming ein, bildete sich später in Berlin und Wien weiter. 1877 wurde er als erster Kartograph in die geographische Anstalt von Velhagen und Klasing in Leipzig aufgenommen. Bis 1890 arbeitete er unter der Leitung von Professor R. Andrees. Nach dessen Ausscheiden übernahm er die Leitung des Institutes.
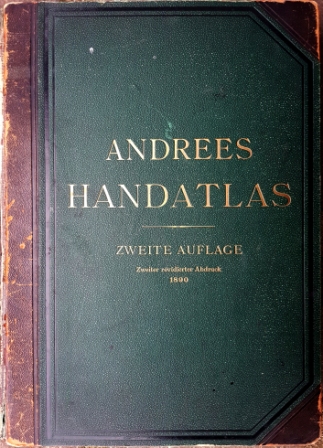
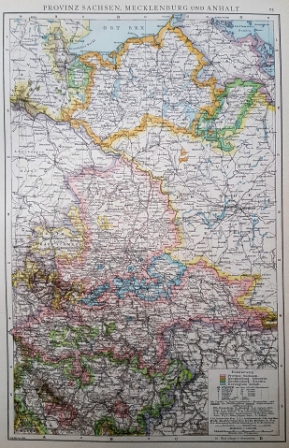
Außer der 5. Auflage von Andrees Handatlas (1908), Velhagen und Klasings Volks– und Familienatlas (1902) und dem geographischen Handbuch (5. Auflage 1908) gab S. Land und Leute, Monographien zur Erdkunde heraus. Aus dieser Reihe erschien auch der Band Thüringen in mehreren Auflagen. Darin enthalten ist eine umfangreiche Beschreibung des Rennsteiges. Er war seit dem 05. Februar 1904 Mitglied des Rennsteigvereines 1896 e.V..

Als leidenschaftlicher Wanderer kannte und liebte S. den Thüringer Wald und hier besonders den Rennsteig. Oft zog es ihn nach Rodacherbrunn und Brennersgrün direkt auf den Rennsteig.
Albert Scobel war ein Mensch, der sich mit eigener Kraft zu einer hochangesehenen Stellung empor gearbeitet hat. Charakterstärke und ein großes Wissensspektrum kennzeichneten das Leben von Scobel.
Er starb an den Folgen eines Schlaganfalles.
Seine letzte Ruhe fand S. in Kastelruth in Südtirol. Die Grabstätte von Albert Scobel wurde nach Auskunft der Friedhofsverwaltung allerdings aus Platzgünden einplaniert.

Kastelruth
Streller, Elisabeth
Am 17. Oktober 1879 in Reichenbach bei Behringen geboren, gestorben am 14. Januar 1939 in Eisenach.
Sie konnte keinen Beruf erlernen, war aber trotzdem zuerst in Hildburghausen, später in Eisenach tätig. Mit der Pfingstrunst 1912 trat sie dem Rennsteigverein bei und wurde bald eines seiner aktivsten Mitglieder. Sie war Wanderer und Forscherin in einer Person, unermüdlich, ja schier unverwüstlich. Kein Wetter war ihr zu schlecht, kein Weg zu weit, keine Aufgabe zu schwer. Fast drei Jahrzehnte hindurch galt ihre vorbildliche Arbeit dem Rennsteigverein und der Erforschung der Rennsteige des deutschen Sprachgebietes. Von Ihr kann man wirklich sagen, dass sie ohne den Rennsteig nicht zu leben vermochte, dass sie immer wieder zu ihm zurückkehren und auf ihm wandern musste. Ein schweres Schicksal hatte ihr Wesen äußerlich hart und derb gemacht, umso weicher war ihr Herz, um so gütiger war ihr Gemüt.
Sie war eine von jenen selbständigen Frauen, für die der Kampf Lebenselement war. Ihre Tätigkeit im Rennsteigverein betraf u.a. die Mitarbeit bei der Herausgabe des Führer 1 und 2, bei der Bezeichnung des Sallmannshäuser Rennsteiges und später dessen Betreuung, die maßgebliche Beteiligung an der Erwanderung des Thüringen-Rhein-Höhenweges und des Germanischen Rennweges. Wo immer wir wandern, wo immer wir im Schrifttum und in den Akten des Rennsteigvereins blättern, überall können wir der segensreichen Arbeit der Altrennerin begegnen, auch als Mitbegründerin der Ski-Runst ebenso sicher wie auf Schusters Rappen.
Das goldene Ski-Ehrenschildchen schmückte neben anderen zahlreichen Auszeichnungen ihre Brust. Sie war wie die Waldfrau Luise Gerbing ihrer Gesinnung und ihrem Wesen nach eine Königin des Rennsteiges. Elisabeth Strellers umfangreichstes Werk war die große Rennsteig-Grenzstein-Inventur, die sie 1934 vorlegte: ein Verzeichnis über 1315 Steine (Zahl ist in dieser Höhe nicht korrekt, Anmerk. des Autors) mit genauen Angaben zu Standort, Kompassrichtung, Wappen, Inschrift, Nummer und Verfassung jedes Steines.
Die damals dem Rennsteigverein übergebenen Unterlagen sind verloren gegangen und konnten bis heute nicht mehr aufgefunden werden.
Die Vorwanderung über den Germanischen Rennweg im August 1938, die sie führte, war ihre letzte Wanderfahrt. Sie starb am 14. Januar 1939 in Eisenach. An einem Stein des Glöcknerehrenmales ist ihr Name zur ewigen Erinnerung eingemeisselt. Die Einweihung des Gedenksteines erfolgte am letzten Tag der Pfingstrunst am 17. Mai 1940.
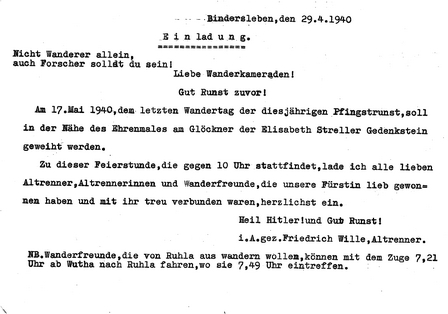

Verewigt am Glöckner-Ehrenmal

immer im Dienste des Rennsteigvereins

1935, E.Streller ganz rechts hinten

1935, 2. von links, mit Hut
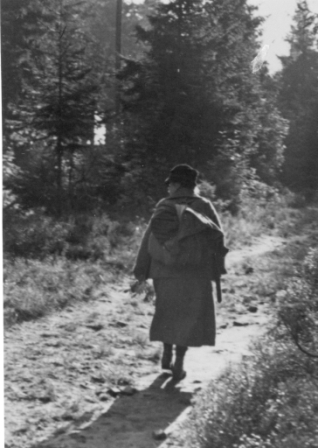

1935

1935
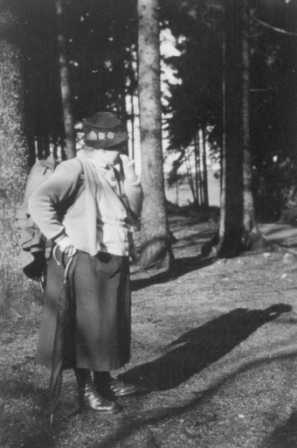
1935

1935, Anmerkung: Die Runstfotos stammen aus dem Archiv des Rennsteigvereins und wurden
von mir anhand der Photoplatten digitalisiert



einzige, noch vorhandene (bisher "gefunden" und archiviert im Rennsteigmuseum
Neustadt am Rennsteig) Aufzeichnungen von Elisabeth Streller ihrer Erfassung der Grenzsteine
am Rennsteig, hier vom Schönwappenweg, Dreiherrenstein am Kießlich bis Kurfürstenstein
(Fotos: Manfred Kastner)
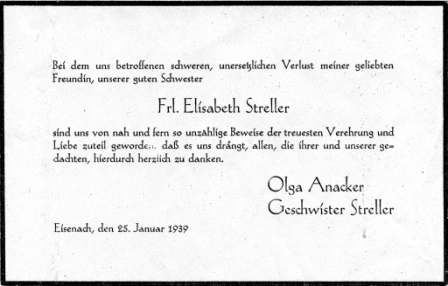
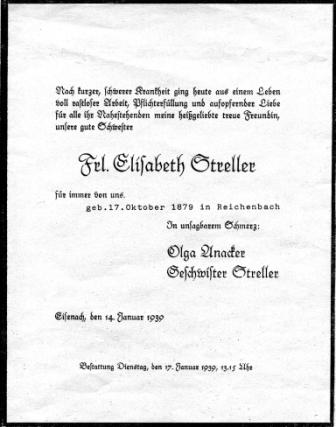
Tourentaler
Was sind Tourentaler?
Tourentaler sind Andenken gleichzeitig auch "Besuchsbeleg" und Sammelobjekt. Sie bestehen aus Holzscheiben, die beidseitig das Symbol des besuchten Reise-, Wanderzieles, Wanderweges oder Ereignisses abgebildet haben und einem daran anhängenden Sammelcoupon.
Auf den Tourentalern sind Schlösser, Burgen, Berggipfel, Naturbesonderheiten, historische Städte, Schauhöhlen, u.v.m. abgebildet. Die Tourentaler sind fortlaufend durchnummeriert. Tourentaler, die ein Symbol vom ganzen Wanderweg abbilden, nennen wir Wanderweg-Tourentaler.
Jedes Tourentaler-Motiv wird nur an einer begrenzten Anzahl der Verkaufsstellen in der Umgebung des Reisezieles angeboten, wie z.B. Kassen an den denkmalgeschützten Objekten, Tourist-Informationen, Souvenir-Geschäften, Hotels und Gaststätten.
Historie
Tourentaler werden seit 1998 als „turistická známka“ von der Firma Turistické známky s.r.o. Rýmarov hergestellt und in vertrieben. Das ganze System hat sich vom einfachen Andenkenartikel bis zur systematischen nummerierten Einordnung der Taler in gedruckten Landkarten mit Verkaufsstellen und zum motivierenden Sammelspiel entwickelt.
Das System freute sich nach kurzer Zeit großer Beliebtheit zwischen Touristen und verbreitete sich in 14 weitere europäische Länder.
Sie bilden mit den Tourentalern Ihre individuelle Sammlung als Erinnerung an Orte, wo Sie schon mal waren, denn nur am jeweiligen Ort sind die Tourentaler zu erhalten!
Sie haben für das Ansammeln von 10 aufeinanderfolgenden Tourentaler-Nummern (wird durch Einsendung von Sammel-Coupons nachgewiesen) einen Anspruch auf einen Prämien-Tourentaler gratis. Für jede weitere 10er-Reihe erhalten Sie einen anderen Prämien-Tourentaler.
Die Tourentaler haben 60 mm Durchmesser und sind 9 mm dick. Der Verkaufspreis eines Tourentalers ist deutschlandweit 2,50 €.
Manche Verkaufsstellen führen Tourentaler wie Wandermarken oder Tourenmarken (früher unter www.tourenmarken.de) - diese werden stufenweise durch Tourentaler ersetzt.
Sie haben jetzt noch die Möglichkeit künftige Sammel-Raritäten zu ergattern!
Wo Sie die Tourentaler kaufen können?
Das System wächst ständig. Eine jährlich aktualisierte Deutschlandkarte führt Sie zu den teilnehmenden Verkaufsstellen.
Sie können Tourentaler auch in anderen europäischen Ländern sammeln.
Mit Tourentaler-Sammeln haben Sie jede Menge Spaß und nebenbei nicht nur Ihre Heimat besser kennengelernt, sondern auch für Ihre Gesundheit etwas getan.
Wichtige Informationen finden Sie dazu unter: www. tourentaler.de
Auch von der Rennsteigregion gibt es verschiedene Tourentaler, die ich Ihnen hier vorstellen möchte:


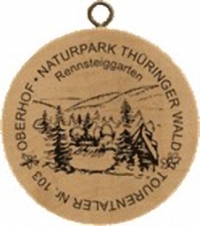
Nr. 101 Nr. 102 Nr.103



Nr. 104 Nr. 105 Nr. 106
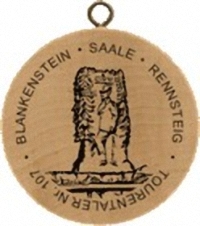


Nr. 107 Nr. 108 Nr. 109


Nr.121 W01
Verkaufsstellen (Angaben ohne Gewähr)
101 - Wilde Sau Tourist-Information, Markt 9, Eisenach, www.eisenach.info
102 - Großer Inselsberg Hotel und Gasthaus Kleiner Inselsberg, Am Rennsteig, Brotterode, www.kleiner-inselsberg.de
103 - Rennsteiggarten Rennsteiggarten, Am Pfanntalskopf 3, Oberhof, www.rennsteiggartenoberhof.de
Aparthotel, Oberhof, Eckardtskopf 1+3, www.aparthotel-oberhof.de
104 - Plänckners Aussicht Suhler Hütte, Am Rennsteig, www.suhlerhuette.de
105 - Eselsbergturm vorübergehend in der Tourist-Information Neuhaus am Rennweg (s.106)
106 - Neuhaus am Rennweg Tourist-Information, Neuhaus am Rennweg, Marktstraße 3, www.neuhaus-am-rennweg.de
107 - Blankenstein Fremdenverkehrsbüro, Rennsteig 2, Blankenstein, www.blankenstein-am-rennsteig.de
108 - Altvaterturm Gaststätte Altvaterturm, Lehesten, Wetzstein, www.altvaterturm.de
109 - Schneekopf Neue Gehlberger Hütte, Schneekopf (nicht immer im Sortiment), www.neue-gehlberger-huette.de
121 - Wartburg Tourist-Information, Markt 3, Eisenach, www.eisenach.info
W01 - Rennsteig Gasthaus "Zum Frankenwald", Grumbach 40, Grumbach (in Kürze)
Venetianer
Ein romantisches Gebirgsräthsel des mittlern Deutschlands.
Von Ludwig Storch, 1862 ("Gartenlaube")

Seit die Gebrüder Grimm uns das mystische Gebiet des Volksglaubens und der Volkssage erschlossen, enthüllt sich uns eine ganz neue Welt, die in der Morgenfrühe unseres Volkslebens im Nebel der Vergessenheit lag; das scheinbar Unbedeutende und Widersinnige gewinnt Bedeutung und Zusammenhang mit der allgemeinen Strömung des Deutschthums, und aus mißachteten und verhöhnten Sagen und Erinnerungen entwickeln sich überraschende Klarsichten über ganz vernachlässigte Partien dieses unseres Volksthums und seiner eigenthümlichen Gestaltung im Laufe der Geschichte. Je mehr der Aberglaube und die Volkssage an ihrer moralischen Wichtigkeit verlieren, desto mehr gewinnen sie zu gleicher Zeit an kulturhistorischer, und das Auge, das über die in ihm sich kundgebende Volksnaivetät lächelt, wird entzückt von den aus ihm hervortretenden Spuren specifisch deutscher Sitte, Denk- und Handlungsweise.
Eine höchst seltsame, räthselhafte, von der Forschung fast noch gar nicht beachtete und deshalb auch noch nicht erklärte Erscheinung im Volksleben der Gebirgsbewohner des mittlern Deutschlands sind die in der Volkssage so lebendig und drastisch auftretenden fremdländischen Metallurgen, Rhabdomanten und Adepten, kurz jene romantischen und geheimnißvollen Goldschürfer, welche entweder „Venetianer“ oder „Walen“ genannt, oder auch mit beiden Namen zugleich belegt werden, deren Spuren sich zurück bis über das zwölfte Jahrhundert unserer Zeitrechnung verfolgen lassen, und die erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts von den Schauplätzen ihrer Wirksamkeit verschwunden sind. Die Gebirge, in welchen sie ihr mysteriöses Wesen vorzugsweise trieben, und in deren Sagen sie deshalb noch so frisch und farbig fortleben, sind, so weit mir bekannt geworden, der Thüringerwald, das Fichtelgebirge und der Baier- und Böhmerwald. Auch im Harz sollen sie vorgekommen sein, doch habe ich dafür keine Anhaltepunkte. Ob ihre Existenz auch in andern deutschen Gebirgen sicher nachzuweisen ist, muß anderweitiger Forschung überlassen bleiben.
Sie treten im ganzen Thüringer Walde auf, zumeist an dessen Knotenpunkten, am Inselsberg und am Schneekopf, und im ganzen Gebirge heißen sie „Venetianer“. Den Namen „Walen“ kennt man hier nicht. Aber weit schärfer und individueller ausgeprägt als im Thüringerwald ist ihre Physiognomie im Fichtelgebirge, und hier heißen sie vorzugsweise „Walen“. Matter und verschwommener wird ihre Gestalt wieder in der Oberpfalz und in den böhmischen Bergen. Ueber die Donau hinüber kennt man sie nicht, aber in Regensburg, der uralten Römercolonie, steht gleichsam ihr Schluß- und Denkstein in der Wallerstraße, im Mittelalter „W alenstraße“ genannt, einer der schönsten und von je bedeutendsten Verkehrswege der einst so reichen Stadt. In dieser Straße wohnten die geschickten und weltberühmten wälschen Goldschmiede.
Wer waren diese Leute, die in der Volkssage zwar einen mythischen Anstrich erhalten haben, deren wirkliche, menschliche Existenz aber über allen Zweifel erhaben ist? Was trieben sie in unsern Gebirgen? Und wie kamen sie zu diesem seltsamen Doppelnamen?
Sie waren Fremdlinge, nicht in diesen Bergen Geborne, nicht da Aufgewachsene, nicht da Heimische. Sie trugen fremdländische Kleidung, sie sprachen eine fremde Sprache. Von Zeit zu Zeit erschienen sie auf geheimnißvolle Weise in spärlicher Anzahl; sie ließen sich mit der heimischen Bevölkerung so wenig als möglich ein, umhüllten sich und ihr Thun und Treiben mit dem tiefsten Schleier des Geheimnisses und benutzten dazu alte furchterregende Volkssagen; sie hantirten nur bei Nacht und nicht ohne ausgestellte Wachen, so daß sie nicht leicht bei ihrer Arbeit überrascht werden konnten, und verschwanden nach einiger Zeit wieder ebenso plötzlich und auf so seltsame Weise, wie sie erschienen waren. – Da tritt uns denn zuerst das altdeutsche Wort Walah, altnordisch Wal, ein Fremder, Ausländer, entgegen. Walise, wälsch war alles Fremdländische, und da das deutsche W in den romanischen Sprachen stets in G umlautet (z. B. Welfen und Waiblinger in Guelfen und Gyibellinen; Wilhelm in Guilelme etc.), so ist doch wohl Wale und Walle, auch Waller (alle diese Wortformen kommen vor) und Gallier ein und derselbe Name. Wallonen, Walliser, Waleser und Gälen sind immer derselbe Name in verschiedener Umlautung. Der Name Walen bedeutet also nichts weiter als Fremdlinge.
Was aber ist mit dem Namen Venetianer anzufangen? Alle Volkssagen der genannten Gebirge weisen auf die reiche, stolze und mächtige Handelsrepublik auf den Laguneninseln hin. Dort sollen die „Walen“ unserer Berge als geschickte Goldschmiede in einer eignen Straße gewohnt haben, gerade wie in Regensburg. Sie waren nicht romanischen Stammes, sie bildeten einen Volksstamm für sich. Sehr charakteristisch ist, daß sie stets nur mit Gold zu thun haben. Mit anderem Metall befassen sie sich nicht. In unsern Bergen suchen und finden sie nur Gold, in Regensburg und Venedig sind sie nur Goldschmiede. Auf überraschende Weise stimmt damit nun eine Angabe des älteren Plinius in seiner Naturgeschichte überein. Im 11. Capitel des 6. Buches dieses Werkes wird nämlich berichtet, daß „vor den Pforten des Kaukasus durch die gordyäischen Berge die Wallen und Swarnen (Valli, Suarni), freie Völkerschaften, wohnen, die nur auf Gold schürfen.“ An einer andern Stelle (6. 7) nennt Plinius die Walen mit den Serben und andern nicht mehr bekannten Volksstämmen zusammen, die am kimmerischen Bosporus und am schwarzen und asowischen Meere wohnten, und bezeichnet die Sarmaten als ihre Nachbarn. Endlich nennt derselbe Schriftsteller mit den Sarmaten und andern Völkerschaften auch die Veneden (Venedi). Dieser letztere slavische Volksstamm war wahrscheinlich mit den Venetern im nordöstlichen Italien verwandt, welche die Begründer Venedigs wurden; ja, es ist sehr wahrscheinlich, daß der Name Veneder oder Wenden der Collectivname aller slavischen Stämme in Deutschland war.
Die Walen setzten sich mit den Venedern, aus Vorderasien ausgewandert, im Fichtelgebirge fest, dessen Goldreichthum sie zuerst entdeckten. Vom Fichtelgebirge aus verbreiteten sie sich nördlich im Thüringerwald, südlich im Baier- und Böhmerwald, oder besuchten wenigstens diese Gegenden periodisch, dem Goldreichthum der Berge nachspürend. Mit ihnen theilten die Kelten, die Hauptbesitzer des Landes, die Neigung zum Bergbau, nur daß letztere auf alle Metalle schürften.
Mit den Kelten theilte sich ein anderes mächtiges Volk verschiedenen Ursprungs und Charakters in den Besitz des Landes, die durch ihre riesige Größe vor den kleingestalteten Kelten und Walen hervorragenden Tschuden. Dem gewaltigen Anpralle der ebenfalls von Hochasien in ungezählten Schaaren heranziehenden germanischen Völkerschaften erlagen alle frühern Bewohner der Länder von der Ostsee bis zu den Alpen. Die Römer waren zum Theil schon Herren der Länderstriche am Rhein und an der Donau, und die weniger kriegerischen als gewerbsleißigen Kelten ihnen bereits unterworfen. Die Tschuden und Römer wichen vor der wilden Uebermacht der Germanen zurück und die erstern verschwinden; die Kelten unterwerfen sich abermals. Die kleinen Volksstämme wie die Walen und Veneder verstecken sich in die unzugänglichen Berge, bis sie, auch aus diesen Schlupfwinkeln vertrieben, weiter und weiter nach Süden wandern und mit den uralten Venetern verschmelzen.
Aber nun leben alle diese frühern unterlegnen und vertriebnen Besitzer des Landes in der deutschen Volkssage wieder auf und spielen, die Tschuden und Römer (die Erbauer der starken Burgen) als Riesen, die Kelten und Walen als Zwerge, ihre mythische-elbische bedeutsame Rolle. Ihr geschichtliches Schicksal wird von der Sage in seinen Grundzügen treu wiedergegeben, aber mythisch-phantastisch ausgeschmückt. In nebelhaften Hintergrund treten die Riesen, in den hellern Vordergrund die Zwerge. Diese werden zu fleißigen Haus- und Feldgeistern, und der ganze, fast übergeile Reichthum der Zwergensage gaukelt nun im phantastischen Arabeskenschmuck an unserm Auge vorüber. Weniger bedeutsam und mythisch ausgeschmückt als die Kelten-Zwerge erscheinen die Walen, die nicht mehr im Lande unter den Germanen wohnten, sondern nur auf geheimnißvolle Weise in einzelnen Gruppen periodisch wiederkehrten, um in ihren ehemaligen gebirgigen Wohnsitzen ihre verlassene Arbeit, den Bergbau auf Gold, wieder aufzunehmen, worin ihnen die neuen Besitzer des Landes keine Concurrenz machten. Denn die Germanen trieben keinen Bergbau, wie Tacitus ausdrücklich von ihnen anführt. Viele Jahrhunderte lang und aus der mythischen Vorzeit unsres Volkes in die geschichtliche Zeit herüber mögen die Walen, die nun mit den Venedern und Venetern identificirt und auch Venetianer genannt werden, die reichste Goldbeute aus unsern Bergen fortgetragen haben, eh’ es den Deutschen einfiel, sich auch an diesem herrlichen Gewinn ihres Landes zu betheiligen. Und da war es denn merkwürdiger Weise wieder das Fichtelgebirge, in welchem der Deutsche den ersten Bergbau, und zwar ebenfalls auf Gold, betrieb. Nach dem Berichte des Mönchs Otfried von Weißenburg ist dies zur Zeit König Ludwigs des Deutschen (843–876) geschehen, und von hier aus verbreitete sich der Bergbau allmählich in Deutschland. Aber fort und fort waren die geheimnißvollen Walen oder Venetianer in ihrer Weise in denselben Bergen thätig, und geschichtlich sind sie bis in’s 12. Jahrhundert hinab zu verfolgen. Erst im 14. Jahrhundert wurde die bedeutende Goldzeche zu Goldkronach gegründet und die Stadt gebaut, aber wiederum von Slaven und nicht von Deutschen, wie der Name beweist.
In der Volkssage theilen die Walen oder Venetianer mit den Zwergen die elbische Natur, auch sie sind von zwerghafter Gestalt, auch sie können sich unsichtbar machen und im Nu nach jeder beliebigen Stelle versetzen, auch sie vermögen Wetterstürme zu erregen und fahren unsichtbar in der Windsbraut einher; auch sie sind zaubermächtige, wunderbar geschickte Goldschmiede. Und so erscheinen sie regelmäßig, vom Gebirgsvolk mit ehrfurchtsvoller Scheu betrachtet, als ausgestattet mit der geheimen oder vielmehr übernatürlichen Kunst des Ruthenschlagens, Goldfindens und Scheidens des edlen Metalls vom tauben Gestein und des kunstreichen Verarbeitens desselben. Die Wünschelruthe ist von ihnen unzertrennlich; sie ist ihr Stab und Wegweiser im wilden, schauerlichen, einsamen Gebirg, auf und unter dem Boden. Erst in der Mitte des vorigen Jahrhunderts treten sie aus der mythisch elbischen Hülle heraus und werden zu wirklichen Menschen; die mystische legen sie niemals ab, bis sie gegen Ende des Jahrhunderts ganz verschwinden.
Man kann sich denken, wie sich die ohnedies so lebhaft aufgeregte Volksphantasie dieses an Gold und Geheimniß so reichen und durch die stete Wiederkehr schier unerschöpflichen Stoffes bemächtigte! Fast keine Sage ist so dramatisch lebendig und buntfarbig, als die von den Venetianern oder Walen. Unzählige romantische Geschichten werden in allen Gebirgsorten des Fichtelgebirgs, des Thüringerwaldes und des Baier- und Böhmerwaldes von ihnen erzählt, die meist darauf hinauslaufen, daß Gebirgsbewohner, von einem Geschäft oder vom Zufall nach der Lagunenstadt geführt, hier die Männer, die sie in ihren heimischen Bergen als unscheinbare, geheimnißvolle Arbeiter gekannt, als wahre Goldfürsten wieder finden.
Aber nicht allein als Goldschürfer und Scheidekünstler werden sie gepriesen, sie genießen auch den Ruhm als Pharmaceuten und Aerzte, als Magiker und Wahrsager. Und so fallen sie vielfach mit den Zigeunern zusammen. In meiner Geburtsheimath, dem nordwestlichen Thüringerwalde, ist das Andenken an sie noch so lebendig, daß man in Ruhla die Häuser bezeichnet, wo Einzelne gewohnt, die Schmiedeessen, wo sie bei nächtlicher Weile gearbeitet, und die Familien, mit welchen sie wenn auch nur dürftigen Umgang gepflogen, und die sich ihrer Gunst durch werthvolle Goldgeschenke erfreut haben. In der geheimnißvollen Geschichte des berühmten Naturarztes Johannes Dicel in Seebach bei Ruhla, von dem ich in einem frühern Jahrgange der Gartenlaube erzählt, spielt ein Venetianer eine sehr wichtige Rolle. Dicel fand als junger Mann diesen Fremden krank bei Nacht im Gebirge, trug ihn heim und pflegte ihn bis zu dessen Genesung. Dafür lehrte ihm der Venetianer die Zubereitung seltner und kostbarer Arzneien und unterwies ihn überhaupt in der medicinischen Chemie. Dicel erhielt von ihm gleichsam die letzte Weihe als Arzt und Apotheker und wurde von nun an ein gesuchter Heilkünstler und reicher Mann.
Auch im Thüringerwalde ist, wie im Fichtelgebirge, der Volksspruch im Schwange: „Mancher wirft einen Stein nach der Kuh, und der Stein ist mehr werth als die Kuh.“ Daher müssen die Venetianer auch im Thüringerwalde ihre reichliche Rechnung gefunden haben, sonst wären sie nicht mit solcher Beharrlichkeit wiedergekehrt, denn zu Scherz und Schein haben sie nicht in den Schmiedeessen Nachts hantirt. In Ruhla wird vorzüglich eine sagengeschmückte Berghöhle am Wartberg (volksthümlich Marktberg) bei Seebach als Fundgrube der Venetianer bezeichnet, und allerdings findet sich darin ein goldglänzender Sand. Der Bergbau auf Gold ist später von der einst so wichtigen Bergstadt Saalfeld, besonders am Goldberg bei Reichmannsdorf, und ebenso erfolgreich von der nun zu einem armen Dorfe herabgekommenen ehemaligen Bergstadt Steinheide betrieben worden, wo dieser Betrieb im dreißigjährigen Kriege zu Grunde ging.
Die Venetianer sind endlich ausgeblieben, obgleich man sie zu Pfingsten und Frohnleichnam noch jetzt an manchen Berghängen der Oberpfalz arbeiten sehen will; aber es ist bekannt, daß die sonst so bedeutende Ergiebigkeit des Bergbaus auf edle Metalle in allen Ländern Europa’s sich sehr vermindert hat, sodaß manche Bergwerke die Betriebskosten nicht mehr abwerfen. Diese Thatsache sollte aber doch nicht von Versuchen abschrecken, die Fingerzeige der alten Walen zu verfolgen. Auf der andern Seite sollten neuere Geschichtsforscher sich angelegen sein lassen, das räthselhafte Wesen dieser Fremdlinge zu ergründen und über die ganze Angelegenheit möglichst helles Licht zu verbreiten. Auch die Poesie hat sich des schönen und gehaltreichen Stoffes noch in keiner würdigen erschöpfenden Weise bemächtigt, und so wäre es doch gewiß recht hübsch, wenn die alten halb mythischen Venetianer den Bergmann, den Geschichtsforscher und den Dichter veranlaßten, in ihren verlassenen Gruben Gold zu schürfen.
Zum Schluß noch eine von den vielen Venetianersagen aus dem Baierwalde, welche Schönwerth in seinem vortrefflichen Werke „Aus der Oberpfalz“ mittheilt und die ich als ganz besonders charakteristisch auswähle. „Es wurde einmal Heu heimgefahren. Da erhob sich das Windgespreil (Wirbelwind). Ein Bube, der neben dem Wagen ging, warf sein Messer hinein. Dieses wurde nicht mehr gefunden und die Sache vergessen. Der Bube wuchs zum Manne und mußte eine Reise nach Venedig machen. Wie er nun herumgeht, die Wunderstadt zu beschauen, sieht von einem Hause Einer zum Fenster heraus, der ihn hinaufruft und gastlich bewirthet. Als er ihn entließ, sagte er: „Ich habe nur ein Auge. Das verdanke ich Dir.“ Der Fremdling war darüber um so mehr betroffen, als er den Mann gar nicht kannte. Da ging der Wirth hinaus und kam nach einiger Zeit als Venetianer gekleidet herein und zeigte dem Gaste ein Messer, ob er es nicht kenne. Nun gingen diesem die Augen auf; er erkannte den Venetianer, den er als Knabe gar oft in seiner Gegend nach Goldsand suchen gesehen hatte.“

am Venetianerstein, westlich vom Großen Inselsberg, 1903

1931

der Venetianerblick an der Westflanke des Großen Inselsberges
Weiß, Günther
* 13. März 1925 in Achelstädt, Kreis Arnstadt
† 14. Oktober 1991 in Scheibe-Alsbach, Kreis Neuhaus am Rennweg

Als Sohn eines Lehrers wurde sein Interesse für die Natur bereits in frühen Jahren gefördert.
Er besuchte von 1932 bis 1942 die Schule in Arnstadt. Nach der Mittleren Reife begann er eine Lehre im Forstamt Katzhütte.

Günther Weiß als Lehrling
Infolge des Krieges musste er 1943 seine Lehre abbrechen und wurde zur Wehrmacht einberufen. Es folgten schwere Jahre in einem Pionierbataillon an der Ostfront. Zwei lebensgefährliche Verletzungen und Gefangenschaft waren das Ergebnis seines Kriegseinsatzes.
Nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft schloss Günther Weiß seine Lehre am Forstamt Katzhütte ab.
Ab 1946 besuchte er die im Mai des gleichen Jahres neu gegründete Forstfachschule Schwarzburg. Dort legte er im Jahre 1947 die Försterprüfung ab.

Anschließend wurde er vom Rudolstädter Kreisforstamt als Revierleiter in Scheibe-Alsbach eingesetzt.
Noch 1947 heiratete er die Tochter des dortigen Revierförsters Büttner, Hanna. Mit einigen Unterbrechungen lebte Günther Weiß, seine Frau und seine fünf Kindern im Forsthaus Scheibe.

Forsthaus Scheibe-Alsbach
1947 wurde er für vier Monate zur Borkenkäferbekämpfung nach Erlau abgeordnet.
Nach der Ablegung der Revierförsterprüfung im Jahr 1949 machte Weiß Station in der Jugendoberförsterei Leinefelde, deren Leitung er auf eigenen Wunsch schon zwei Monate später wieder aufgab.
1951 nahm Günther Weiß an einem Lehrgang für Standortkartierung und Waldwirtschaft in Ruhla teil. Daraufhin wurde er 1952 technischer Assistent an der Versuchsabteilung für Forstliche Standortskartierung Jena, die damals von Forstmeister Jäger geleitet wurde.
Im Oktober 1952 wurde Günther Weiß Mitglied im Kulturbund.
Von 1959 bis 1961 belegte er ein Fernstudium an der Fachschule für Forstwirtschaft in Ballenstedt. Dieses Studium schloss er im Jahre 1961 mit „Auszeichnung“ als Forstingenieur ab.

Von 1968 bis 1974 war er Abteilungsleiter für Rohholzerzeugung im damaligen Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb Neuhaus am Rennweg in Katzhütte.
Aufgrund seiner Ziele und Vorstellungen von einem standortgerechten und naturnahen Waldbau, die in der damaligen DDR aufgrund wirtschaftlicher Zwänge nicht zu erfüllen waren, resignierte er und gab im Jahre 1978 seine Tätigkeit als Revierförster auf. Er übernahm die Stelle des Sekretärs des Kulturbundes im Kreis Neuhaus am Rennweg.

Aufgrund der gesellschaftlichen Situation konnte er zwar auch hier nicht seine Fähigkeiten in der Praxis voll umsetzen, trug aber durch seine Arbeit wesentlich dazu bei, dass im Bezug auf Bodendenkmalpflege, Heimatgeschichte, Botanik und Ornithologie wesentliche Impulse seiner nimmermüden Tätigkeit der Region zum Vorteil gereichten. Obwohl er die Möglichkeit hatte, übte der Forstmann Weiß nie die Funktion eines Jägers aus.
So war Weiß maßgeblich an der Errichtung von Naturschutzgebieten im Bereich Scheibe-Alsbach (Löschleite, Großer Farmdenkopf, Wurzelberg) beteiligt.
Er erforschte die Entwicklung der Märbelmühlen im Oberen Schwarzatal. Sein heimatgeschichtliches Engagement galt weiter der keltischen Besiedlung am Bleßberg und der Untersuchung des Streites um die Werra (Saar)- Quelle.
Bei allen neuen Initiativen dürfen wir jedoch die Sicherung und Erhaltung des alten Rennsteiges selbst nicht vergessen. Das verlangt auch eine richtige Einordnung dieser Maßnahmen. In dieser Hinsicht sind wir noch den Generationen nach uns, nicht nur den Lebenden verpflichtet.[1]
Besonders wichtig für die Belange des Rennsteiges waren seine Arbeiten zur Erfassung der historischen Grenzsteine zwischen der Hohen Lach und dem Dreiherrenstein Hoher Heide, die er über 2 Jahrzehnte betrieb.
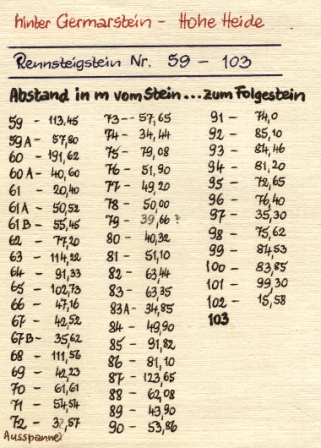
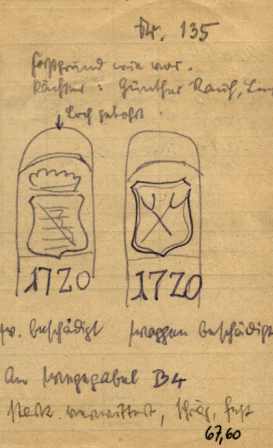
Aus den Aufzeichnungen von Günther Weiß

Einer von vielen Grenzsteinen rund um Neuhaus, die wegen Baumaßnahmen zerstört wurden


umgedrückter Grenzstein bei Igelshieb

Grenzstein Nr. 135, Limbach, nicht mehr vorhanden, zerstört beim Bau einr Gasversorgungsanlage


die beiden Grenzsteine Nr. 176, der ältere von 1617, der neuere von 1847, bei Siegmundsburg

reparierter und wieder zerstörter Grenzstein bei Neuhaus


ehemaliger Schwarzburger Meilenstein, der jetzt in der Nähe der Neuhäuser Postkreuzung steht

Winter in Limbach am Anstieg zum Alsbachberg

Dreistromstein mit beschädigter Spitze
Günther Weiß kontrollierte die Grenzsteine, andererseits aber setzte er sich auch ständig für den Erhalt der Grenzsteine ein. Unter seiner Regie wurden in den von ihm betreuten Abschnitten zahlreiche Grenzsteine saniert und wieder aufgerichtet.
Er scheute sich auch nicht, seine schlechten Erfahrungen, die er beispielsweise mit dem damaligen Liegenschaftsdienst in Neuhaus am Rennweg machte, öffentlich im Freien Wort zu publizieren.
Schon vor einem Jahrzehnt sollte der Rennsteigverlauf in unserem Kreis rekonstruiert, auf die veränderten Transportbedingungen umgestellt werden. Hierzu waren eine Anzahl Steine umzusetzen. Zu diesen Vorschlägen sagte der Liegenschaftsdienst nein. Die Steine waren eingemessen und dürfen nicht versetzt werden. Für eine Neueinmessung wären keine Arbeitskräfte vorhanden.
Und übrigens wurde gefragt, dieser Spaß kommt teuer, wer bezahlt ihn?
Inzwischen hat sich die Arbeitskräftesituation beim Liegenschaftsdienst nicht verbessert. Nur eine stattliche Anzahl von zur Umsetzung vorgeschlagenen Rennsteigsteinen ist inzwischen vernichtet worden, obwohl es wegen ihrer Einmessung so wichtige Punkte waren. Damit hat sich freilich der Arbeitsumfang für den Liegenschaftsdienst erheblich verringert.
Das verstehen die Natur- und Heimatfreunde nicht. Umgesetzt werden darf ein Rennsteigstein nicht, weil der Messpunkt verloren geht. Geht der Messpunkt aber verloren, weil der Stein vernichtet wird, kann man es nicht ändern. Das ist auch vor dem Gesetz nicht strafbar.
Nach der Bildung von landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften mussten einige hunderttausend eingemessener Grenzsteine fallen, um überhaupt die Großflächenbewirtschaftung mit Hilfe der modernen Technik zu ermöglichen. Am Rennsteig jedoch darf noch nicht einmal ein Stein versetzt werden, um seinen kulturhistorischen Wert zu sichern.
Sollte dieser Widerspruch wirklich unlösbar für uns sein?[2]

Günther Weiß an der Schwarzaquelle bei der Wildfütterung
Mit Günther Weiß verliert die Rennsteig, hier besonders die Grenzsteinforschung, eine wichtige Persönlichkeit. Seine Erfassungsergebnisse zählen aufgrund der schwierigen gesellschaftlichen Situation, in welcher Weiß oft als „Heimattümler“ abgestempelt wurde, zu den fundiertesten seiner Zeit.

Otto Schneider vom Thüringerwald Verein Neuhaus am Rennweg am Grab von Günther Weiß
auf dem Friedhof Scheibe-Alsbach am 21. Mai 2004
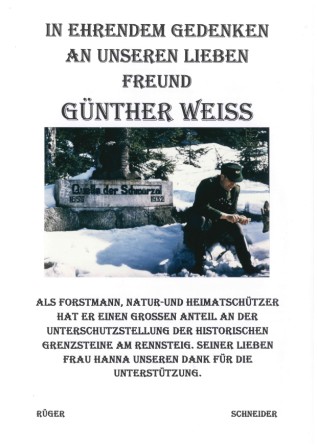
[1] Günther Weiß in seinem Artikel Unser Rennsteig- ein Stück Kulturerbe und Zukunft zugleich im Freien Wort vom 24. Februar 1973 (Artikel in 3 Teilen: 1. Teil am 22.02.1973, Teil 2 am 23.02. 1973, Teil 3 am 24.02.1973).
[2] Freies Wort vom 23. Februar 1973. 3- teiliger Fortsetzungsartikel von Günther Weiß. Unser Rennsteig- ein Stück Kulturerbe und Zukunft zugleich. Teil 2.
Bemerkung: Die dargestellten Fotos stammen aus dem Nachlass von Günther Weiß, der mir freundlicherweise von seiner ebenfalls verstorbenen Ehefrau Hanna zur Verfügung gestellt wurde